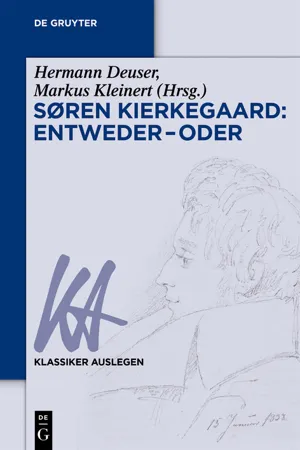1Einleitung
„…an der Richtigkeit des bekannten philosophischen Satzes, dass das Äußere das Innere, das Innere das Äußere sei, ein bißchen zu zweifeln“ (EO1, 11; SKS 2, 11). Ausgespannt zwischen diesem ironischen Hegelzitat, dem Ruf des Posthorns („Der Postillion bläst bereits“ – wenn auch 1½ Stunden verspätet!) und dem zufälligen Manuskriptfund („dass eine geheime Tür aufsprang, die ich nie zuvor bemerkt hatte“ [EO1, 14; SKS 2, 13 f.]) – so präsentiert der pseudonyme Herausgeber Victor Eremita die von ihm tentativ mit Entweder – Oder bezeichneten Texte zweier unbekannter Autoren A und B. Oder war es vielleicht doch nur ein einziger Autor, der für diese beiden so entschieden andersartigen Sammlungen verantwortlich zeichnet? Hinzu kommt noch eine dritte Autorschaft, was zu Beginn gar nicht erwähnt wird, nämlich der von B mitgegebene Predigttext des Ultimatums, gleichsam die knappe Coda eines vorausgegangenen Feuerwerks von Gedanken und Gattungen, vom Aphorismus bis zum weit ausholenden Lehrbrief: im Ganzen ein „Lebensfragment“ (EO1, 9; SKS 2, 9).
Derart durchsetzt von spielerischen Elementen stellt sich eine Philosophie der Lebensanschauungen, der Lebensformen und Handlungssituationen dar. Ihre lehrhaften und analytischen Passagen erscheinen immer zusammen mit romanhaften Vermittlungsformen; man könnte von einer Art Bildungsroman sprechen, wenn auch nicht gleich – mit Odo Marquards ironischem Begriff – von „Transzendentalbelletristik“ (Marquard 2013, 121). Allerdings, Kierkegaards bewundernswerte literarische Fähigkeiten verbunden mit der werkeinheitlichen Programmformel, „was es denn heißt zu existieren“, unterschreiten keineswegs die Erwartungen an das, was heute unter Philosophie verstanden werden kann (Hannay 2010, 37, 46). In historischer Sicht ist Kierkegaards Stellung zu Wissenschaft und Lebensnähe immer wieder und zu Recht mit Schopenhauer und Nietzsche verglichen worden, und die von der Kierkegaard-Lektüre ausgehenden literarischen Einflüsse und Vergleichsmöglichkeiten („with contemporaries like Ionesco and Beckett, or even Monty Python“) liegen auf der Hand. „Philosophisch“ (Hannay 2010, 35f., 45) aber ist vor allem die begriffliche Arbeit am Ort der existentiellen Fragestellung selbst: „es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist, die Idee zu finden, für die ich leben und sterben will“ (DSKE 1, 24). Hier differenzieren sich die Lebensformen des Ästhetischen, Ethischen und Religiösen, und diese müssen in ihren jeweiligen Lebensbedingungen so zur Sprache und Darstellung gebracht werden, dass sie der existentiellen Aneignung nicht im Wege stehen, sondern immer auch auf diese schwierige Umsetzungsproblematik aufmerksam machen. Das verlangt neue Begriffsbildungen, unverbrauchte Kategorien und die literarische Bewusstheit variierender Sprachformen. Konkret wird dieses Programm jeweils durch das spielerische Einüben von Autor-Distanzen, um dadurch erst recht die Instanz der Rezeption, Leserinnen und Leser, auf sich selbst zu verweisen. Deshalb das zufällig gefundene Manuskript geheimnisvoll-unbekannter Herkunft („Hier fand ich zu meiner großen Überraschung eine Menge von Papieren“ [EO1, 14; SKS 2, 14]). Es soll nichts sein, an das man sich halten, über das man einfach verfügen kann; und doch tragen gerade diese bloßen Papiere eine anspruchsvolle Lehre als existentielle Botschaft vor.
Insofern zieht Entweder–Oder durchaus auch eindeutige Linien und bezieht klare Standpunkte. Ästhetisch in actu ist alles, was ein leidenschaftliches Innen-Verhältnis dem Äußeren vorzieht, Unmittelbarkeit erreichen will, auch wenn sie den Lebensbedingungen abgerungen werden muss: Vom sinnlich-erotischen Verhältnis über alle Formen der ironischen Distanzierung bis zur strategischen Reflektiertheit des Verführers. Doch kann das Ästhetische als Lebensform seine eigene Theorie hervorbringen? Ist es an seine konkreten literarischen Formen gebunden, die einer durchaus reflektierten Unmittelbarkeit jeweils Spielraum geben? Welche Rolle spielen Entwicklungsstufen, Stadien, und wissen diese um sich selbst? Wieweit ist Selbstkritik als Grenzreflexion möglich, und worin zeigen sich Abhängigkeit oder begründete Distanz vom Begriff der Ästhetik in Antike, deutschem Idealismus und Romantik? Worin besteht der „Wahrheitsgehalt“ gerade der Ästhetik als Lebensform, ihrer spezifischen „Subjekt-Objekt-Relation“ (Adorno 1966, Kap. I)?
Ethisch, in idealer Betrachtung, ist dagegen die verpflichtende Allgemeinheit vermittelt mit den Realisierungen des individuellen Lebens. Die Entscheidungssituation des Entweder-Oder kann deshalb nur von einem entsprechend moralischen Innen-Verhältnis aus geltend gemacht werden, das jetzt aber das Äußere nicht ignoriert oder umspielt, sondern ernsthaft – von Innen her – zu gestalten versucht. Die stabilen Sozialformen, bevorzugtes Exempel: Ehe und Familie, sind der Ort der Handlung, und die „Papiere von B“ werden nicht müde, die Überlegenheit dieser zugleich konkret wie allgemein wirksamen Sicht der Dinge gegenüber der Isolation ästhetischer Unmittelbarkeit zu preisen. Weil das Äußere in einem neuen Innen integriert wird, ist dieses jenem durch die Aneignung des Fremden überhaupt erst angemessen; ja, die dazu geforderte Lebensentscheidung erkennt die fehlerhafte Bedingtheit der ästhetischen Unmittelbarkeit: B ist es, der A vorrechnet, was in seiner Lebenshaltung an Integrationsleistungen versäumt wird, und B ist es, der damit erst den kritischen Begriff des Ästhetischen entwickelt. Zu ihm gehören nicht nur Unmittelbarkeit und Genuss, sondern auch Langeweile, Schwermut und Verzweiflung. Doch wie steht es hier mit dem Verhältnis von Lebensform und ihrer Darstellung (Deuser/Kleinert 2013, 7ff.)? Erreicht das ethische Programm die gleiche Überzeugungskraft wie das ästhetische, und welche Rolle spielt dabei die Pseudonymität des Autors? Ist es berechtigt zu sagen, Kierkegaard sei „der Erste“ gewesen, der die „ethische Grundfrage nach dem Gelingen und Misslingendes eigenen Lebens mit einem nachmetaphysischen Begriff des ‚Selbstseinkönnens‘ beantwortet“ habe (Habermas 2002, 17)? Ist Kierkegaards Kritik an der idealistischen geschichtsphilosophischen „Reteleologisierung“ (Marquard 2013, 113) als prophetisch und in der Bindung an den einzelnen Menschen, seine Entscheidungssituation des Entweder-Oder, als zeitgemäß und konsequent einzustufen?
Es bleibt im Ganzen die Frage nach dem Verhältnis von Leben und Lehre, Glauben und Handeln, Selbstgewinn und Sozialität, Innerlichkeit und Darstellung – in diesem „Monstrum von einem Buch“ (J.L. Heiberg),1 das Geschichte gemacht hat und beständig nach aktueller Auslegung verlangt.
Der Text, der hier zur Auslegung kommen soll, präsentiert sich also selbst schon unter ganz verschiedenen Hinsichten, fordert trotzdem aber die zentrale Perspektive eines existentiellen Entweder-Oder. Solche Identität und Differenz hat Methode, und ein doppelter Zugang soll versuchen, dieser Sachlage gerecht zu werden: Einerseits durch exegetische, textnahe und die Strategie des Autors einbeziehende Interpretationen, andererseits durch problemorientiert-begriffliche Darstellungen von Positionen und Argumentationen einzelner Textpartien sowie größerer Zusammenhänge. Dieses Verfahren will in seiner Neutralität durchaus eine wissenschaftliche Erschließung von Kierkegaards Frühwerk erreichen – freilich ohne restriktive Begrenzungen einzuführen, sondern umgekehrt: sich unter Beachtung von Mitteilungsform und existentieller Anforderung so sachgemäß wie möglich einstellen zu können. Die dreifache Leitfrage lautet dann: Was kann in existenzieller Hinsicht unter einer Ästhetik der Lebensformen verstanden werden, worin besteht das für die Ethik (und Religiosität) grundlegende Entweder–Oder und wie verhalten sich diese beiden Seiten zueinander?
Kierkegaards philosophische These, es gebe für alle Menschen ein Entweder-Oder, also eine Entscheidungssituation bei klarer Alternative, wird schon durch die Asymmetrie zwischen A und B in dieser Frage kompliziert. In einer Entscheidungssituation zu stehen, eine Wahl zu haben, das ist die ethische Position, die der ästhetischen Lebensform gerade fehlt. Wenn letztere aber doch zu dieser Einsicht findet, werden „die Kraft und die Leidenschaft der Wahl […] den, der wählt, ins Ethische gewissermaßen hineintragen“ – und das heißt umgekehrt, dass das Ästhetische nicht im Ernst gewählt werden kann (MacIntyre 1997, 63). MacIntyre hat genau das bestritten und zwar unter Hinweis auf das Beispiel der Generation von Kriegsteilnehmern nach dem 1. Weltkrieg, für die die Welt der Moral zusammengebrochen war und die daraufhin bewusst das Ästhetische zur Neuorientierung gewählt hat. Das historische Beispiel trägt zwar nicht das Argument: Denn in jedem einzelnen Fall käme es darauf an, was unter ethisch vor und nach den einschneidenden Lebenserfahrungen zu verstehen war bzw. wie sehr ästhetisch, ohne es selbst zu verstehen, längst schon gelebt wurde. Doch die Kritik trifft die dialektisch schwierige Stelle (vgl. Schulz 1994, 256 ff.), an der der Übergang von der einen in die andere Lebensform erklärt werden muss: A kann B eigentlich nicht verstehen, ohne sich selbst aufzugeben, B aber hat im Bewusstsein der entscheidenden Wahl sich selbst und A verstanden, nämlich darin, dass im Ästhetischen nicht ohne die latenten Krisensymptome wie Reue oder Verzweiflung gelebt werden kann. Wenn diese auftreten und trotzdem nicht ethisch ein sich verantwortendes, Pflicht erkennendes Leben gewählt wird, geschieht eine inkonsequente Quasi-Wahl des Ästhetischen. Das ist kennzeichnend für A, für B bleibt es ein Selbstwiderspruch. Das „Wollen“ zu wählen (EO2, 718; SKS 3, 165) ist demnach der entscheidende Selbstgewinn, der die (ethische) Lebensform fundiert und der im Ästhetischen vielfach verborgen bleibt. Reue und Verzweiflung sind dabei die Übergangsphänomene, die die (ästhetische) Selbstverstellung in Unmittelbarkeit von innen her sprengen. In der Perspektive von A gehört dies zum Risiko, das ironisch gebrochen gerade ausgehalten werden muss, für B ist die Selbstwahl kreativ in Bezug auf das Selbstwerden im Leben überhaupt und insofern absolut. Ist dieser existenzdialektische Knotenpunkt aber philosophisch diskursiv noch zugänglich? Heißt wählen zu wollen einen dezisionistischen, kriterienlosen, also irrationalen Akt zu vollziehen (MacIntyre 1997, 64 ff.; vgl. zur Diskussion Rudd 2008; und Davenport im vorliegenden Bd. Nr. 10)?
Die Handlungssituation stellt sich so dar: Der Zustand, in dem sich A präsentiert, will selbstgenügsam erscheinen, ist aber immer wieder unglücklich, gelangweilt, zusammenhangslos und kann deshalb die guten Gründe, die B vorbringt, durchaus hören, in sich verstehen, wenn er sie auch nicht für sich selbst zu realisieren willens ist. Deshalb läuft der Wechsel zwischen ästhetischer und ethischer Lebensform trotz möglichem gegenseitigen Verständnis auf ein ausschließendes Entweder-Oder zu, nämlich auf den Augenblick der Wende, worin aus latenter Reue und Verzweiflung die existentielle Konkretion des (ethischen) Selbst wird, dessen Autonomie und Freiheit eben in diesem Akt der bewussten Selbst-Wahl liegt. Für die Aufhebung der immer drohenden Selbsttäuschung (Rudd 2008, 186, 199; vgl.Wesche, im vorliegenden Bd. Nr. 4), die von A latent geahnt, von B als manifest und Herausforderung des Ethischen erkannt wird, genügt jedenfalls nicht die Einsicht in gute Gründe – die sind im nachholenden Diskurs allerdings von Belang –, sondern sie liegt in einem, trotz Reue und Verzweiflung, plötzlichen Gewinn an „Authentizität“ (Gräb-Schmidt, im vorliegenden Bd. Nr. 11). Dass dies geschieht, das kann B weder A aufzwingen noch hat B selbst dafür die Bedingungen in der Hand. Diese Dialektik von Freiheit und dem radikal Bösen (Kant), das offensichtlich auch gewählt werden kann, ist zugleich Auszeichnung und Gefährdung des freien Willens, der sich nicht selbst aus der Verstrickung helfen kann (Dalferth 2014).
Insofern bleibt für das Ästhetische immer auch ein deutlicher Respekt und eine Selbständigkeit, die ja auch in den Titelüberschriften der beiden Briefe von B an A ihren Ausdruck findet. Während B aber das existentielle Werden dessen, was ein Mensch in gewissem Sinne ist und noch nicht ist, als Lebensprinzip entwerfen kann, muss A mögliche Lebensformen immer an den Rand der Selbstauflösung führen. Wo alles auf ironische Distanz gehalten wird, da hat nichts mehr Bedeutung, und der Triumph dieser Lebens-Modelle liegt allein in ihrer rückhaltlosen Konsequenz, wie sie z. B. bei Don Giovanni genauso zu bewundern ist wie bei dem Verfasser der Diapsalmata: Nihilismus (vgl. Lisi, im vorliegenden Bd. Nr. 5; Kleinert 2005, 184 ff.).
So zu leben fasziniert, kann aber ethisch gesehen nicht empfohlen werden, und darin besteht die Überlegenheit der kritischen Analysen von B. Bei allem auch biederen und betulichen Auftreten des Beamten und Ehemanns ist doch anzuerkennen, dass er die guten Gründe anführen kann, warum im Sinne von A ästhetisch zu leben traurige Ergebnisse zeitigen wird. Ernst Tugendhat hat diesen entscheidenden Punkt schlicht und treffend formuliert: „Gibt es etwas, so lautet doch die Frage, das mir als Wollendem als Bezugspunkt dient, auf den hin ich mein einzelnes voluntatives Verhalten sammeln kann? Darauf kann man nicht antworten: ja, die Frage selbst. Denn damit hätte man der Frage ihren Gehalt genommen.“ (Tugendhat 2003, 113) Die von A vorgeführten Konsequenzmodelle geben ihre Antwort im tautologischen, ironischen, nihilistischen, immer neu variierenden Spiel mit dem Rückgriff auf „die Frage selbst“. Das macht die Sache zugleich interessant und anfällig für Selbsttäuschungen, B aber weiß wo und wie es enden wird, wenn der „Gehalt“ dieser Frage neutralisiert wird. Deshalb ist das bewusst-gewordene Wollen des Wählens ethisch und anthropologisch gesehen so fundamental, und auf dieser Basis allein kann dann Bestimmtes, nämlich das Gute, gewählt werden. An die Stelle der ästhetischen Indifferenz im (Nicht‐) Wählen tritt die im Namen des Guten gewählte ethische Differenz zwischen Gut und Böse (vgl. Schulz 1994, 260ff.).
Die Forschungs- und Rezeptionsgeschichte haben gezeigt, wie verzögert, bruchstückhaft und zurückhaltend Entweder–Oder postum rezipiert wurde (Schwab 2008).2 Vor allem das ästhetisch-erotisch ‚Interessante‘ weckte ebenso Bedenken wie Begeisterung, und erst mit der Zeit wird die philosophische Problemstellung der Zuordnung von A und B sine ira et studio herausgearbeitet. Der hedonistische Lebensentwurf des „reflektierten Genusses“ ist respektabel, bleibt in seiner Konsequenz aber egozentrisch und ohne sozial lebendige Kommunikation (Pieper 2001, Kap. 2). Doch nach welchem überlegenen Maßstab wird dies beurteilt? Den vorgetragenen Lebensentwürfen gemeinsam ist die praktizierte und sich aufdrängende Kritikfähigkeit gegenüber den misslingenden Formen des Selbstwerdens (Wesche, im vorliegenden Bd. Nr. 4), und auch der Ethiker hat das gute Leben nicht gepachtet, sondern steht in der gleichen Gefahr der Selbsttäuschungen: „Maskeraden“ der Existenz, die zur wahren Selbstbestimmung noch nicht vorgedrungen sind (Gräb-Schmidt, im vorliegenden Bd. Nr. 11).
Die Schwierigkeit besteht darin, sich nicht einfach an Vorgegebenes halten zu können. Existentiell gesehen können Lebensentwürfe nicht direkt übernommen, sondern sie müssen angeeignet werden. Um dies zu erreichen, müssen die literarischen Personen ...