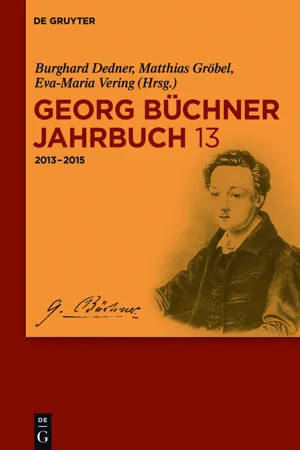
- 358 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Das Georg Büchner Jahrbuch soll als ein Forum der Bestandsaufnahme und der Innovation, der Reflexion und der Debatte, der Quellendokumentation wie der raschen Mitteilung, der Auseinandersetzung wie der Verständigung dienen und dabei die gesamte Breite der Forschungsergebnisse und -diskussionen erfassen. Dieser Zielrichtung sucht das Jahrbuch in seinen Abteilungen Aufsätze, Debatten, Dokumente und Materialien sowie Rezensionen gerecht zu werden.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
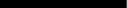
Aufsätze
Heinrich Detering (Göttingen)
Georg Büchner und sein Preis
Rede zur Eröffnung des 3. Internationalen Büchner-Kongresses 2012
Verehrte Damen und Herren,
die Geschichte des Georg-Büchner-Preises beginnt im »Volksstaat Hessen« während der Weimarer Republik. Langwierige Streitigkeiten wurden im Darmstädter Landtag vor allem um den passenden Namenspatron für die neu zu schaffende hessische Auszeichnung geführt; die Vorschläge reichten von Büchner bis zum Datterich-Autor Ernst Niebergall. Der gegen zähe Widerstände dann nach Georg Büchner benannte Preis wurde in der NS-Zeit nicht verliehen. Der Versuch seiner Wiederetablierung als hessischer Kulturpreis nach 1945 brachte immerhin noch die Auszeichnung von Elisabeth Langgässer und Anna Seghers zustande, ehe der Preis dann der 1949 gegründeten Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung als Willkommensgeschenk Darmstadts überlassen wurde. Seit 1951 existiert er nun als deren Literaturpreis, und sehr bald schon erwarb er sich seinen Ruf als die höchste literarische Auszeichnung des deutschen Sprachraums.1 Dabei entsprang die Entscheidung für Gottfried Benn als den ersten Preisträger nicht nur dem Wiedergutmachungswillen gegenüber der ästhetischen Moderne, sondern auch dem Ungeist einer vorgeblichen Selbstbehauptung gegen das Exil – namentlich gegen Thomas Mann – und gegen das, was Benn verächtlich das »Vierte Reich« nannte. (In die parallel gegründete Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur wurde Benn bekanntlich nicht aufgenommen, wesentlich auf den Einspruch Alfred Döblins hin.) Die Liberalisierung der Deutschen Akademie und ihres bekanntesten Preises wäre eine Geschichte für sich.2
Zwar ist dieser Preis keineswegs der einzige, den die Deutsche Akademie vergibt; vier weitere sind nach und nach hinzugekommen: der Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, der Merck-Preis für literarische Kritik und Essay, der Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland und der Voß-Preis für Übersetzung. Aber der Büchner-Preis wurde rasch der mit Abstand bekannteste, und er wurde zu einem Lieblingsritual des literarischen Betriebs.3 An keinem Literaturpreis hat die literarische Öffentlichkeit so kontinuierlich Anteil genommen wie an ihm; alljährlich werden die unter Büchners Patronat stehenden und ganz überwiegend auch von ihm handelnden Dankreden der Preisträger in den großen Feuilletons abgedruckt und kommentiert. Denn unter den rituellen Reden der Republik ist die Büchnerpreisrede, wie die Paulskirchenrede zum Friedenspreis, beinahe zu einem eigenen Genre geworden.4
Denn eine Dankrede müssen ja alle Preisträger halten. Und es ist lehrreich zu sehen, wie Grundfiguren der politischen und literarischen Auseinandersetzungen, die in der Weimarer Republik um die Einsetzung des Preises geführt wurden, sich vom Neubeginn an in den Dankreden für seinen Empfang wiederholen.
Helmut Heißenbüttel hat das Genre bereits 1969 zum Gegenstand seiner Rede gemacht: »Eine Rede ist eine Rede heißt eine Rede ist eine geredete Rede […] Das Konzept der Rede entwickelt sich aus dem Anlaß der Rede. […] Der Anlaß dieser Rede hängt mit dem deutschen Schriftsteller Georg Büchner zusammen. […] Soll ich über das Werk Büchners reden? Soll ich über die Person Büchners reden? Soll ich über die politischen Überzeugungen Büchners reden? Soll ich über mein persönliches Verhältnis zum Werk Büchners reden?« Außerdem: Welche Analogien lassen sich von der Zeit Büchners zur eigenen herstellen? Welche aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Zustände gilt es anzumahnen?
Den Erwartungen, die Heißenbüttel parodiert, bemühen sich tatsächlich die meisten Redner auf die eine oder andere Weise zu entsprechen. Und sehr bald nach seiner Gründung schon beginnt der Preis sich selber historisch zu werden. Bereits 1966 bekennt Wolfgang Hildesheimer, er habe sich auf seine eigene Dankrede zuerst durch die Lektüre der bisherigen vorbereitet – und liefert damit seinerseits eine Vorlage für Heinz Piontek, der zehn Jahre später ebendiesen Satz zitiert und damit eine Art Historisierung in zweiter Potenz erzeugt. Kurz zuvor, 1974, verweist Hermann Kesten schon auf die Sammlung der Büchnerpreisreden, erschienen »bei Reclam« unter dem Titel Büchner-Preis-Reden 19511971.
So beziehen die Dankreden sich zunehmend wie auf Büchner so auch aufeinander. Wie Erich Fried 1987 seine politische Redeabsicht mit einem Verweis auf Heinrich Bölls zwanzig Jahre zurückliegende Rede legitimiert, so entwickelt Peter Rühmkorf 1993 seine eigenen Überlegungen aus der Rede Enzensbergers von 1963: »Es sind jetzt auf den Schlag dreißig Jahre her, daß mein kritisch verehrter Sangesbruder Hans Magnus Enzensberger an dieser Stelle stand und ein verflixt gebrochenes Deutschland-Deutschland-Lied anstimmte« – das Rühmkorf nun gerade frei nach Heine unter der Überschrift »Deutschland, ein Lügenmärchen« weitersingt. Als Wolfgang Hilbig 2002 mit der Erinnerung an Hans Erich Nossacks Dankrede beginnt, die kurz nach dem Mauerbau gehalten wurde, sind gar schon einundvierzig Jahre vergangen. Und bereits 1978 blickte die Deutsche Akademie selbst zum ersten Mal auf die bisherige Geschichte ihres Lieblingsrituals zurück, in einer mit dem Marbacher Literaturarchiv veranstalteten Ausstellung: Der Georg Büchner-Preis 1951–1975. Zum sechzigjährigen Jubiläum schließlich widmete sie ihm 2011 eine Veranstaltung, in der drei lebende Preisträger (Durs Grünbein, Adolf Muschg und Brigitte Kronauer) Dankreden von vier toten Vorgängern (Paul Celan, Gottfried Benn, Max Frisch und Ernst Jandl) neu lasen und kommentierten.
Ihrem Beispiel bin ich gefolgt, indem ich auf Bitten der Veranstalter dieses Kongresses alle Büchnerpreisreden wiedergelesen habe, unter der Leitfrage nach ihrem Umgang mit Person und Werk Georg Büchners. Das sind, schlecht gerechnet, sechshundert Druckseiten; und das hauptsächliche Ziel meines Vortrags ist es, Ihnen deren vollständige Lektüre zu ersparen. Dafür ist eine knappe Stunde eine vorteilhafte Investition. Dafür ist aber leider auch in Kauf zu nehmen, dass es auf eine annotierte Zitatcollage hinausläuft. Wenig Theorie also, viele O-Töne: ein anekdotisches Divertimento, bevor morgen die Wissenschaft beginnt.
Sechzig Mal der Büchner-Preis, von 1951 bis 2011: das bedeutet sechzig Dankreden. (Drei Preisträger – Ernst Meister, Peter Weiss, Oskar Pastior – sind kurz vor der Verleihung gestorben; an ihrer Stelle sprachen Freunde oder Angehörige.) Und es bedeutet sechzig Mal die Publikumserwartung eines signifikanten Bezugs auf den Namenspatron. Dabei war dieser Bezug niemals ausdrücklich gefordert. Keine Statuten, weder vor noch nach der NS-Zeit, verlangten, dass eine Büchnerpreisrede von Büchner zu handeln habe. Dennoch bemerkt Karl Krolow bereits 1956, also erst in der fünften Preisrede nach der Neubegründung des Preises: »Es wurde üblich und liegt nahe, sich in der Stunde der Verleihung des Georg-Büchner-Preises mit […] dem Andenken dessen für ein kleines [sic] auseinanderzusetzen, der dieser literarischen Dekoration nicht nur ihren Namen, sondern vor allem […] ihre Tendenz – wenn ich so sagen darf – gab«. Aber welche Tendenz sollte, könnte das sein?
Nur wenige Preisträger machen von der Lizenz zum Beschweigen Büchners Gebrauch. So wenig Reiner Kunze und Thomas Bernhard, Sarah Kirsch, Uwe Johnson und Peter Handke gemeinsam haben – dies immerhin verbindet sie. (Kunze gibt seiner Rede über die Repressionen in der DDR und seinen schreibenden Widerstand allerdings eine überraschende und wirkungsvolle Schlusswendung, indem er im letzten Satz fragt: »Habe ich an Büchner vorbeigesprochen?«) Im übrigen aber beziehen sich die meisten Redner mehr oder weniger ausführlich auf den Namenspatron, oder auf Büchner und sein Werk, oder auf Büchners Werk und ausdrücklich nicht auf Büchner. Sie tun das in weit ausgreifenden literarischen, philosophischen, politischen Räsonnements oder in pointierten Aperçus, mit langen Textzitaten und in knappen Nennungen von Namen und Titeln. Aber sie tun es, fast alle. Und sie lesen nicht nur, in der Rangfolge der Nennungen, Dantons Tod, Woyzeck und den Hessischen Landboten, dicht gefolgt von Lenz und Leonce und Lena. Gleich zwei Preisträger, Albert Drach und Tankred Dorst, beschäftigen sich mit einem Stück, von dem nur der Titel überliefert ist – Pietro Aretino. Und sie kommen dabei, was ich noch bemerkenswerter finde, zu durchaus unterschiedlichen Interpretationen. Was bei Dorst insofern einleuchtet, als er sich das Drama zum Titel zunächst selber ausdenkt. Reinhard Jirgl streift die Cato-Rede, Josef Winkler die Gedanken Über den Selbstmord, und für Friedrich Dürrenmatt wie für Durs Grünbein steht die physiologische, die im Wortsinne sarkastische Anthropologie der Vorlesung Über Schädelnerven im Mittelpunkt scharfsinniger Analysen.
Eine gewisse perspektivische Begrenzung ergibt sich aus der Redesituation: Da die meisten Redner es als Publikumserwartung empfinden, sich – mit Erich Kästners Formulierung – »als Schüler und Schuldner Büchners« darzustellen, sprechen sie überwiegend vom subjektiven Erlebnis dieses Werks; Ansätze zu einer literatur- oder ideengeschichtlichen Reflexion fallen aus der Reihe und ebendeshalb umso mehr ins Auge. Aber auch innerhalb des derart begrenzten Spektrums der Themen und Zugänge lassen sich erhebliche Unterschiede der Reden beschreiben, im Blick auf die Auffassungen von Büchner wie im Blick auf die Haltungen, aus denen diese Auffassungen hervorgehen, auf rhetorische Strategien und argumentative Bewegungsmuster.
Da eine Büchnerpreisrede also gewohnheitsmäßig auch von Büchner handeln soll und da mit ihr überdies ein erheblicher Geldbetrag und ein noch größeres symbolisches Kapital verbunden sind, mögen alle Preisträger Büchner. Fast alle. Die schönste Ausnahme macht Martin Walser, der seine Rede 1981 mit der Bemerkung beginnt: »Bis vor ein paar Wochen kannte ich Büchners Prosastück ›Lenz‹ nur vom rühmenden Hörensagen. Gewohnt, Lektüre der Lebensstrategie zu unterwerfen, schob ich den ›Lenz‹ auf, um, wenn der Büchnerpreis anfiel, ein frisches Leseerlebnis in Gebrauch nehmen zu können.«
Glaubt man aber den meisten anderen Rednern, dann hat nicht nur kein anderer Autor so von früh an und so nachhaltig ihr eigenes Schreiben geprägt. Sondern dann gibt es auch keinen anderen Dichter, der ihm an ästhetischem und moralischem Rang und lebensbestimmender Wirkung auf die Redner gleicht. Schon Ernst Kreuder, nach Benn der zweite Preisträger, kann 1953 die Ehrung »nur in Demut und ergriffener Dankbarkeit hinnehmen. Ich bin mir bewußt, diese außerordentliche Auszeichnung besitzt ihre Bedeutung in der unvergeßlichen Größe des deutschen Dichters, dessen Gedächtnis wir hier ehren.« Wolfgang Hildesheimer bekennt 1966, er habe sich »noch niemals vor einem Thema so versagen sehen wie vor diesem«. Wolf Biermanns Rede 1991 übertrifft auch in dieser Hinsicht alle anderen an hyperbolischer Wucht. Er sieht in Büchner das »Jahrtausendgenie«; selbst Brecht bleibt dagegen als »immerhin ein Jahrhundertgenie« chancenlos zurück.
Martin Kessel war von Büchner »seit je fasziniert«, Manès Sperber liebt ihn »seit fünfundfünfzig Jahren«. Frühe Büchner-Erlebnisse prägen Hans Erich Nossack (»Etwa 1935 schrieb ich ein Theaterstück ›Der Hessische Landbote‹«) und Hermann Lenz, der in einer Schüleraufführung von Leonce und Lena mitgespielt hat. In einer eindrucksvollen Szene erinnert sich Reinhard Jirgl, wie er, »mit 15 oder 16 Jahren, im Bücherregal der Eltern auch einen schmalen Band entdeckt, auf dessen Rücken stand: ›Georg Büchner. Dichtungen‹. Ich blätterte das Buch aufs Geratewohl auf und las: ›Haben Sie schon gesehn, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnt!‹ Es war diese Stelle im Woyzeck, die mich auf einen Schlag an diesen Dichter fesselte.« Auch Wolfgang Koeppen will in seiner Rede 1962 »von Herzen bekennen: Georg Büchner war mir am deutschen Himmel immer der nächste von allen Sternen.« Dies allerdings erst, nachdem er eher halblaut und zögernd bekannt hat: »Es wird wohl erwartet, daß sich der Empfänger des Preises mit dem Namensgeber in ein gutes Verhältnis setzt. Wie aber konnte ich das! Wie durfte ich mich auch nur einen Augenblick in dieses Licht bringen, […] ohne mich lächerlich zu machen?«
Büchner-Bewunderung und Demutsgeste gehen fast überall zusammen. Dabei beziehen nicht wenige Preisträger in das demütige Bekenntnis, der Auszeichnung nicht würdig zu sein, mit umstandsloser Selbstverständlichkeit auch alle übrigen mit ein. Ingeborg Bachmann tut das 1964 mit biblischer Verve: »Wie jeder, der hier gestanden ist und es nicht wert war, Büchner das Schuhband zu lösen, habe ich es schwer, den Mund aufzutun«. (Es wird dann aber doch eine der längeren Reden.) Wieder setzt Biermann noch eins drauf: »Gemessen an diesem frühgestorbenen Riesen sind wir alle nur langlebige Zwerge.« Aber was hilft das, so Biermann – »messen muss sich jeder Preisochse in Darmstadt an diesem Büchner. Sowas tut weh.« Dialektischer Peter Rühmkorf 1993: »Daß keiner der in seinem Namen Geehrten an Geor...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Siglen und abgekürzt zitierte Literatur
- Aufsätze
- Fußnoten
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu 2013–2015 von Burghard Dedner, Matthias Gröbel, Eva-Maria Vering, Burghard Dedner,Matthias Gröbel,Eva-Maria Vering, Georg Büchner Gesellschaft, Burghard Dedner, Matthias Gröbel, Eva-Maria Vering im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literature & French Literary Criticism. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.