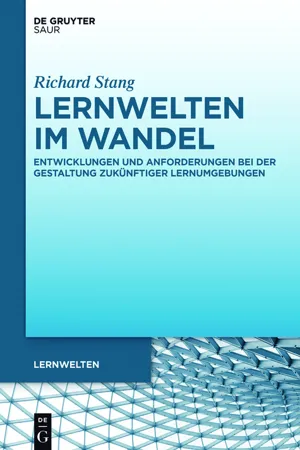
eBook - ePub
Lernwelten im Wandel
Entwicklungen und Anforderungen bei der Gestaltung zukünftiger Lernumgebungen
- 254 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Lernwelten im Wandel
Entwicklungen und Anforderungen bei der Gestaltung zukünftiger Lernumgebungen
Über dieses Buch
Dieser Band stellt die zentralen Entwicklungen bei der Gestaltung von Lernwelten in Hochschulen und damit verbundenen Wissenschaftlichen Bibliotheken, in Öffentlichen Bibliotheken, in der Erwachsenenbildung sowie in kommunalen Kultur- und Bildungszentren systematisch dar. Auf dieser Grundlage werden Empfehlungen gegeben, wie Lernarrangements und Wissensräume in Zukunft gestaltet werden können. Dabei spielt die Perspektive eines integrierten Optionsraums für Lebenslanges Lernen eine zentrale Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Lernwelten im Wandel von Richard Stang im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Bibliotheks- & Informationswissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Begriffskontexte
Bei der Diskussion über die verschiedenen Lernwelten – seien sie formal, nonformal oder informell konnotiert – gelangt man schnell an die Begriffsproblematik. Unter anderem tauchen verbunden mit Lernwelten Begriffe wie Information, Wissen, Kompetenz, Lernen, Lehren und Bildung auf, die nur selten voneinander abgegrenzt bzw. klar definiert werden. Eindeutige Definitionen dieser Begriffe sind auch schwierig, da sie in unterschiedlichen wissenschaftlichen Diskurskontexten verschieden verwendet werden. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass z. B. im Bildungsbericht Bildung in Deutschland 2016 (Autorengruppe Bildungsbericht 2016) überhaupt nicht der Versuch unternommen wird, die Begriffe zu bestimmen. Hier bildet das deutsche Bildungssystem aus der Systemperspektive den Bezugspunkt. Die Perspektive des Lernens spielt dabei keine Rolle, das heißt eben auch, dass das Lernen in informellen Kontexten nur in einem eng gesteckten Rahmen betrachtet wird. So wird z. B. die Bibliothek im Bildungsbericht als Lernort nicht berücksichtigt.
Doch je mehr sich Lernwelten entgrenzen, desto wichtiger werden Beschreibungen von dem, was sie auszeichnet und was dabei mit dem Begriff Lernen auch definitorisch verbunden ist. Lernen ist im Prinzip die Umwandlung von vielfältigen Informationen in personengebundenes Wissen. Doch scheint es heute beim Lernen weniger um Speichern von Wissen zu gehen als vielmehr um die Entwicklung von Kompetenzen (Konrad 2014, 8). Übergreifend hat Bildung den am weitesten gefassten Begriffshof. Unter anderem im Kontext des Diskurses über Wissensmanagement in Unternehmen sind integrative Modelle entstanden, die versuchen, die verschiedenen Begriffe systematisch zu hierarchisieren. Besonders hervorzuheben ist dabei die Wissenstreppe von North, die folgende Stufen umfasst (North 2011): Zeichen, Daten, Information, Wissen, Können, Handeln und Kompetenz. Dabei ergeben sich die einzelnen Hierarchiestufen quasi naturwüchsig (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Die Wissenstreppe (nach: North 2011, 36; eigene Darstellung).
Was hier einfach strukturiert wirkt, ist auf der begrifflichen Ebene sehr viel komplexer. Den genannten und hier verhandelten Begriffen Information, Wissen, Kompetenz, Lernen, Lehren und Bildung ist gemeinsam, dass sie vielfältig kontextualisiert sind und teilweise auch unterschiedlich verwendet werden. Dies macht Begriffsklärungen schwierig. Deshalb sollen im Folgenden Annäherungen an die Begriffe versucht werden, um später auch die Dimensionen des Wandels von Lernwelten besser einordnen zu können. In Anbetracht der Vielfalt der disziplinären Diskurse (u. a. in der Erziehungswissenschaft, in der Psychologie und in der Neurobiologie) kann hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.
1.1Information
Der Begriff Information lässt sich nur schwer fassen, da er in verschiedenen Zusammenhängen und wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich verwendet wird (Schüller-Zwierlein 2013, 16). Fuchs und Hofkirchner (2002, 242) konstatieren ebenfalls die fehlende Übereinstimmung bezogen auf den Informationsbegriff, sehen aber Übereinstimmungen auf den Ebenen von Informationsprozessen in der Gesellschaft:
- auf dem Gebiet des Erkenntnisgewinns und der Ideenproduktion durch gesellschaftliche Subjekte (Kognition),
- auf dem Gebiet des Austauschs von Erkenntnissen und des Verkehrs gesellschaftlicher Subjekte über Ideen (Kommunikation) und
- auf dem Gebiet gemeinsamer Aktionen, zu deren Durchführung die gesellschaftlichen Subjekte Erkenntnisse und Ideen in Einklang bringen müssen (Kooperation). (Fuchs/Hofkirchner 2002, 242)
Sie zeigen anhand der historischen Entwicklung unterschiedlicher Informationsmodelle und Informationsbegriffe auf, wie sich der Informationsbegriff konturiert. Sie beziehen sich dabei auf das semiotische Informationsmodell (1916: das Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure; 1938: C. W. Morris), den nachrichtentechnischen Informationsbegriff von Shannon und Weaver (1949), Kybernetik und Information (1948–1962: Wiener, Bateson, von Foerster), die Urtheorie von Carl Friedrich von Weizsäcker (um 1970) sowie Information und Selbstorganisation (ca. 1986 bis Anfang der 2000er Jahre: Luhmann, Synergetik, Cybersemiotik, Evolutionäres Verständnis) (Fuchs/Hofkirchner 2002, 248–277). Unter den verschiedenen Perspektiven werden komplexe Informationsbegriffe formuliert.
Mit Verweis auf Koblitz stellt Ingold drei zentrale Elemente einer Informationstypologie vor (Ingold 2011, 10): die elementare Information, die sich auf die anorganische Natur bezieht, die biologische Information, die im Kontext der organischen Natur verortet ist, und die semantische Information, die sich im Hinblick auf den Alltag (nicht-wissenschaftliche Information) oder im Hinblick auf die gesellschaftliche Arbeit (wissenschaftliche Information) auf die Gesellschaft bezieht.
Buckland (2012) unterscheidet drei Zustände von Information:
–Information-as-knowledge for knowledge imparted, what was learned as a result of being informed;
–Information-as-process for becoming informed, for learning; and
–Information-as-thing for bits, bytes, books, sounds, images, and anything physical perceived as signifying. (Buckland 2012, 2, H. i. O.)
Er verbindet dabei den Begriff Information mit Wissen, Lernen und Daten und liefert damit einen sehr weitgefassten Informationsbegriff. Eine erweiterte anwendungsorientierte Systematisierung nimmt ebenfalls Ingold vor, indem sie den alltagssprachlichen, den informationstechnischen, den dokumentarisch-informationswissenschaftlichen und den betriebswirtschaftlichen Informationsbegriff unterscheidet und die Unterschiede herausarbeitet (Ingold 2011, 21–43):
Während der Alltagsbegriff ursprünglich den dokumentarisch-informationswissenschaftlichen und teilweise auch den informationstechnischen sowie den betriebswirtschaftlichen Informationsbegriff geprägt hat, beeinflusst heute ein naturalistisches, von der Informationstechnologie geprägtes Begriffsverständnis alle anderen Bereiche, was wiederum zu einer zunehmenden Verschiebung der spezifisch auf menschliche Kognition und Kommunikation bezogenen Begriffsinhalte vom Informations- zum Wissensbegriff geführt hat. (Ingold 2011, 43)
Damit wird auf ein Grundproblem des aktuellen Diskurses zum Informationsbegriff verwiesen: die Abgrenzung zum Wissensbegriff. Kuhlen plädiert in Unterscheidung zu einer Hierarchisierung von Daten, Information und Wissen für ein pragmatisches Verständnis der Beziehung der Begriffe: „Information nimmt ihren Ausgang nicht von den Daten und produziert auch nicht Wissen, sondern nimmt sozusagen in einem doppelten Transformationsmodell ihren Ausgang von bestehendem Wissen“ (Kuhlen 2014, 3).
Nimmt man den äußerst heterogenen Diskurs über den Begriff Information in den Blick, lässt sich zumindest herausarbeiten, dass Daten und Information als Grundlage von Wissen gelten. Ob nun Information schon kondensiertes Wissen ist oder sich Wissen überhaupt erst im Individuum durch Aneignung von Information realisieren kann, bleibt eine begrifflich offene Frage, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt. Erpenbeck und Heyse bringen das Verhältnis auf folgenden Nenner:
Information ist keine Wissensform, sondern eine Kommunikationsform von Wissen. In der modernen Informationswelt driften Wissen und Information auseinander, oft tritt Information an die Stelle des Wissens, wird mit diesem verwechselt. Informationen informieren über Wissen, Gewißheiten, Meinungen, Vermutungen und Glauben gleichermaßen. Sie ebnen die unterschiedlichen Wissensformen ein. (Erpenbeck/Heyse 2007, 34, H. i. O.)
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, sich etwas eingehender mit dem Begriff Wissen zu beschäftigen, um diesen präziser zu beschreiben.
1.2Wissen
Bei der Beschäftigung mit Lernwelten ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Wissen von zentraler Bedeutung, da ein Ziel von Lernen die Generierung von Wissen ist. Bevor man sich dem Begriff unter einer pädagogischen Perspektive zuwendet, ist es sinnvoll den Begriff zunächst unter psychologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sichtweise zu betrachten (Nolda 2010, 311).
Mit Bezug auf eine Analyse von Wissensbegriffen, wie sie sich in Konversationslexika und Enzyklopädien finden, arbeitet Niehaus unter einer etymologischen Perspektive folgende zentralen Aspekte von Wissen heraus:
–Der Wahrheitsbezug von Wissen: Wissen hat immer einen Wahrheitsanspruch und unterscheidet sich darin von anderen Aussageformen wie etwa der bloßen Meinung oder dem Glauben.
–Die Begründung des Wahrheitsanspruchs durch Erklärung: Der Wahrheitsanspruch des Wissens muss sich begründen lassen. Diese Begründung kann aus unterschiedlichen subjektiven sowie objektiven Gründen erfolgen.
–Wissen als der Besitz von Kenntnissen und Erfahrungen: Damit gemeint ist ein Sach-und Faktenwissen (Ich weiß, dass …), das sowohl aus intersubjektiver empirischer Erfahrung als auch aus persönlicher Intuition stammen kann. Dieses Wissensverständnis knüpft an den etymologischen Stamm des Wortes Wissen an: Ich habe gesehen. (Niehaus 2004, 14–15, H. i. O.)
Dabei lassen sich nach Niehaus vereinfacht vier Formen von Wissen unterscheiden: knowledge of: Kennen, knowledge that: Faktenwissen, knowledge how: Begründungswissen sowie Alltagswissen/Handlungswissen (Niehaus 2004, 15). Bodrow und Fuchs-Kittowski führen folgende Dichotomien, bezogen auf Wissen, aus: deklaratives/prozedurales Wissen, strukturiertes/unstrukturiertes Wissen, Erfahrungswissen/Rationalitätswissen; praktisches/theoretisches Wissen; neues/altes Wissen; individuelles/kollektives Wissen; internes/externes Wissen; implizi-tes/explizites Wissen (Bodrow/Fuchs-Kittowski 2011, 63).
Erpenbeck und Sauter unterscheiden zwischen Faktenwissen und prozeduralem Wissen, das „durch fachlich-methodische Kompetenzen geprägt [ist, d. A.], die ein Individuum zur Lösung von Problemen benutzt. Es beeinflusst damit nachhaltig die Werthaltung und das Handeln der Menschen“ (Erpenbeck/Sauter 2013, 38). Faktenwissen wird auch als deklaratives Wissen bezeichnet. Weitere Unterscheidungen, die in diesem Kontext verwendet werden, sind: Sach-und Handlungswissen, know that und know how oder explizites und implizites Wissen (Nolda 2010, 311–313).
Erpenbeck und Heyse unterscheiden zwischen Wissenschafts-, Alltags- und Handlungswissen. Wissenschaftswissen zeichnet sich durch die Methoden aus, mit denen rational begründbare Erkenntnisse gewonnen werden (Erpenbeck/Heyse 2007, 41). Das Alltagswissen generiert sich aus alltäglichen Handlungen und Erfahrungen, die gemacht werden. In diesem Zusammenhang kann auch von Erfahrungswissen gesprochen werden, das sich in Handlungswissen manifestiert (Erpenbeck/Heyse 2007, 49–50). Eine weitere Unterscheidungsstruktur ist die Unterscheidung zwischen Informations-, Verfügungs- und Orientierungswissen.
–Informationswissen bildet einen Teil des Verfügungswissens,
–Verfügungswissen ist jedes instrumentelle Wissen, das Ursachen, Wirkungen und Mittel zur Erreichung eines Ziels verfügbar macht‚
–Orientierungswissen ist – im Gegensatz zum Verfügungswissen – regulatives Wissen, es orientiert auf der Grundlage von Informations- und Verfügungswissen über das ‚Wozu‘ von Zwecken und Zielen, es ist Zweck- und Zielwissen. Orientierungswissen ist damit ganz wesentlich Wertwissen. (Erpenbeck/Heyse 2007, 34, H. i. O.)
Unterschiedliche Perspektiven auf Wissen lassen sich bereits im Begriffszugang von Platon und Aristoteles finden. Pointiert formuliert lässt sich für Platon Wissen deduktiv durch logisches Denken unabhängig von Sinneseindrücken erschließen (Rationalismus), während für Aristoteles allein die Sinneserfahrung den Zugang zu Wissen ermöglicht, also induktiv (Empirismus) (Reinmann-Rothmeier/Mandl 2000). Hilliger pointiert den Gegensatz:
Die Rationalisten sind von der Existenz eines apriorischen Wissens überzeugt. Sie können die absolute Wahrheit durch logisches Denken erschließen. Der Empirist vertritt die Lehre, dass alle Erkenntnis nur auf Erfahrungen beruhen kann. (Hilliger 2012, 116)
Die Wissenssoziologie hat spätestens seit den 1960er Jahren im Hinblick auf die gesellschaftliche Relevanz von Wissen den Fokus auf das Verhältnis von Alltags-und wissenschaftlichem Wissen gerichtet. Dadurch haben sich die Perspektiven des Diskurses über Wissen verschoben. Berger und Luckmann definieren Wissen „als die Gewißheit, dass Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben“ (Berger/Luckmann 1980, 1). Dies gilt sowohl für die...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort zur Reihe
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Begriffskontexte
- 2 Lernwelten im Wandel
- 3 Zukünftige Perspektiven
- Literatur
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Zum Autor
- Register
- Fußnoten