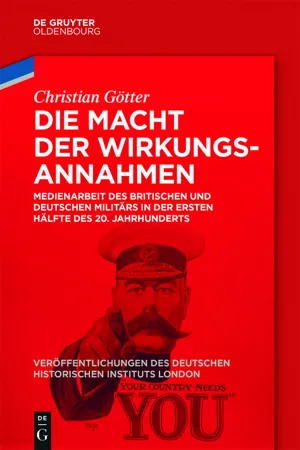![]()
1.Einleitung: Militärische Medienbeziehungen
Am Anfang des 20. Jahrhunderts begann der First Sea Lord der Royal Navy, Admiral Sir John Fisher, die britische Marine nach seinen Vorstellungen zu reformieren. Um seine Reformen in der Marine, im Parlament und in der Öffentlichkeit durchsetzen zu können, zählte er auf Kontakte zu ausgewählten Medienvertretern. Später schrieb er: „Without the Press it couldn’t all have been donef1 Ein halbes Jahrhundert später konnten die Stabschefs der britischen Teilstreitkräfte2 auf ausgewiesene Spezialabteilungen zurückgreifen, wann immer sie mit den Medien interagieren wollten. Im Kalten Krieg bestand hieran ein gesteigertes Interesse. Großadmiral Bruce Fraser brachte dies im Oktober 1949 auf den Punkt, als er festhielt „that much more can be done by propaganda and other means to develop the offensive in the Cold War.“ Nicht zuletzt müsse der „Communist press and propaganda“ in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich entgegengetreten werden.3 Der Umgang mit den Medien und ihren Vertretern, die Medienarbeit,4 war für die britischen Streitkräfte von einer Ausnahmebeschäftigung zur Routinetätigkeit geworden. Das deutsche Militär vollzog eine ähnliche Entwicklung. Setzte zunächst allein der Staatssekretär im Reichsmarineamt, Admiral Alfred von Tirpitz, darauf, dass „ein starkes Durchsetzungsbüro […], nebst Pressebüro“5 ihm helfen werde, der kaiserlichen Marine eine Schlachtflotte von Weltrang zu verschaffen, so rechnete die Wehrmacht auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs auf die Unterstützung von 15 000 Mitgliedern ihrer Propagandatruppen, die als eigene Waffengattung organisiert waren.6
Die ,Normalisierung‘ der Medienarbeit, die im britischen und deutschen Militär im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattfand, war kein gleichförmiger Prozess. Es gab Unterschiede im Umfang der Institutionen, die mit der Medienarbeit betraut waren, ebenso wie in der Aufmerksamkeit, die ihr die Streitkräftespitzen widmeten. Insbesondere nach dem Anstieg im Ersten Weltkrieg folgte ein Einbruch in der Medienarbeit des Militärs. Doch wo sich Militärspitzen zu Beginn des Jahrhunderts noch persönlich für eine von ihnen gewünschte Medienarbeit engagieren mussten, konnten ihre Nachfolger auf routiniert arbeitende Spezialisten zurückgreifen.7 Mit ihnen wurde militärische Medienarbeit präsenter und zunehmend komplex.8
Wie kam es zu diesen Veränderungen? Die Antwort auf die Frage nach dem ,Warum‘ der militärischen Medienarbeit lautet zumeist: Medienarbeit wurde gemacht, weil sie andere Menschen, sogar ganze Bevölkerungen, beeinflussen konnte.9 Versuche, entsprechende Wirkungen zu messen, enden meist im Zirkelschluss des ,Propagandasyndroms‘: Medienarbeit wurde gemacht, weil sie wirkte – und weil sie gemacht wurde, wird sie für wirksam gehalten.10 Ein solcher Erklärungsansatz, der Medienwirkungen im Sinne einer überprüfbaren, absichtsvollen und gezielten Einflussnahme auf Einstellungen und Handlungen der Rezipienten in den Vordergrund stellt, ist jedoch nicht nur wenig erhellend. Er verstellt sogar den Blick auf die wesentlichen Ursachen und Dynamiken der militärischen Medienarbeit.
Die Militärspitzen widmeten sich der Medienarbeit nicht aufgrund empirisch gesicherter Wirkungsnachweise – die es nicht gab. Sie widmeten sich der Medienarbeit, so meine These, vor allem wegen ihrer eigenen Medienwirkungsannahmen. Ohne gesicherte Erkenntnisse über Medienwirkungen (oder eben deren Ausbleiben) konnten die führenden Soldaten jederzeit auf eine Wirkung hoffen. Dies galt insbesondere in Krisen – in Situationen also, in denen sie ihre etablierten Handlungsoptionen versperrt sahen oder in denen diese nicht die gewünschte Wirkung zeigten.11 Medienarbeit suggerierte der Militärführung gerade in solchen Notlagen, weiterhin handlungsfähig zu sein. Ihre Suggestivkraft machte sie zu einem Mittel der Krisenbewältigung. Bestärkt wurde dies dadurch, dass die Medienarbeit sich wahrnehmbar in Artikeln, Filmen oder Radiosendungen niederschlug – was letztlich eine Voraussetzung für die weitergehenden Wirkungsannahmen war.12
Weitere Aspekte, nämlich Impulse von außen und das Eigeninteresse mit der Medienarbeit betrauter Spezialisten des Militärs, kamen hinzu und halfen, die Medienarbeit innerhalb der Streitkräfte zur Routineaufgabe zu machen.
Um diese sich gegenseitig verstärkenden Prozesse sichtbar zu machen, stelle ich die Militärspitzen mit ihren Erfahrungen, Wahrnehmungen und Interaktionen mit den Medien in den Mittelpunkt. Dieses Buch nimmt also eine akteurszentrierte Perspektive ein. Es ist somit ein Beitrag zur Kulturgeschichte13 des Militärischen in Krieg und Frieden.
Eine Kulturgeschichte des Militärischen – Zuschnitt und Methode
Das Militär prägte gesellschaftliche und politische Entwicklungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch außerhalb der oft fokussierten Weltkriege entscheidend mit. Im Frieden plante es den nächsten ,Ernstfall‘. Es benötigte, forderte und erhielt Rekruten und Gelder, um mit technologischen und organisatorischen Entwicklungen im Ausland mithalten zu können. Das Flottenwettrüsten, das die Admirale Tirpitz und Fisher zu Jahrhundertbeginn vorantrieben, belastete nicht nur die Haushaltslage Deutschlands und Großbritanniens, sondern verschlechterte auch das politische Klima Europas. Die Medien standen in allen diesen Kontexten immer auf der Agenda der militärischen Führung – sei es, weil die Aktivitäten der Medien eine Reaktion verlangten, sei es, weil die Militärspitzen eigene Pläne mit ihnen verfolgten. Wenn das Militär als legitimierter Gewaltakteur und wichtiger politischer Faktor innerhalb einer Gesellschaft mit der ,vierten Macht‘ interagiert, verdient das eine kritische Untersuchung.14 Freilich ist die vorliegende Untersuchung keine Analyse der Beziehungen des Militärs zu den Medien; es ist ein kulturgeschichtlich ausgerichteter Vergleich der britischen und deutschen militärischen Medienstrategien und Medienbilder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieser Zuschnitt erfordert eine Erläuterung.
Unter Militär verstehe ich die komplexen Organisationen der Streitkräfte mit den häufig untereinander konkurrierenden Teilstreitkräften und zentralen Stellen ebenso wie individuelle Militärvertreter, die als aktive Soldaten im Dienst dieser Organisationen standen.15 Bedingt in diese Gruppe gehören zivile Mitarbeiter (oder auch Minister) der Streitkräfteministerien. Einerseits konnten sie sehr wohl im Sinne oder Auftrag militärischer Spitzen handeln, andererseits aber als Teil einer zivilen, politischen Kontrolle eben dieser Spitzen agieren. Die Führung, deren Perspektive in dieser Studie im Mittelpunkt steht, sind im Wesentlichen die ,obersten Soldaten‘, also die militärischen Spitzen der Teilstreitkräfte, im Falle des deutschen Kaiserreichs beispielsweise auch die Berufsoffiziere auf politischen‘ Posten, wie die Kriegsminister. Hinzu kommen die Organe der Streitkräftespitzen, namentlich das britische Chiefs of Staff Subcommittee (COS) des Committee of Imperial Defence (CID) und das deutsche Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Die Kommandeure einzelner Einheiten oder Kriegsschauplätze ebenso wie die Leiter einzelner Abteilungen innerhalb der militärischen Spitzengliederung zählen nur im Ausnahmefall zur Streitkräftespitze. Ein Beispiel hierfür sind die einflussreichen Kommandeure der britischen Westfront im Ersten Weltkrieg. Diese Konzentration auf die Führung soll nicht implizieren, dass im Militär alles an der Spitze entschieden und dann umgesetzt worden wäre. Ganz im Gegenteil: Gerade innovative Ideen kamen oftmals aus der mittleren Ebene der Hierarchie oder von außen.16 Dennoch waren es die Spitzen, die schließlich die für die gesamten Streitkräfte gültigen Vorgehensweisen festlegten und somit prägend wirkten. Aussagen mit dem Anspruch, die Medienbeziehungen der Streitkräfte einer Nation zu beschreiben, bedürfen der Perspektive der Führungsebene.
Mit Medien sind die ,klassischen‘ Massenmedien gemeint, vor allem die Presse in all ihren Formen, inklusive der illustrierten Zeitungen und Zeitschriften. Die Presse blieb im Untersuchungszeitraum das wichtigste Medium, auch wenn zunächst Bilder und das Kino, dann das Radio und schließlich das Fernsehen einige Bedeutung erlangten.17 Dementsprechend wird der Begriff der Medien als Sammelbegriff für die verschiedenen Medientypen verwendet. Die Inhalte und Entstehungskontexte der einzelnen Medienprodukte, also beispielsweise von Filmen wie In Which We Serve (der an Erlebnissen des Marineoffiziers Lord Louis Mount- batten orientiert war),18 werden nicht untersucht. Stattdessen geht es um die Akteure, also einerseits Organisationen wie Zeitungen, Filmfirmen oder Radiosender, andererseits individuelle Journalisten, Redakteure und Herausgeber. Massenhaft verbreitete andere Medienprodukte wie Plakate, Flugblätter oder Postkarten werden nur am Rande thematisiert.
Die Interaktionen zwischen Militär und Medien, gesehen aus der Sicht der Streitkräfte, also die Medienbeziehungen des Militärs, analysiere ich anhand der Medienstrategien und Medienbilder der militärischen Führung. Medienstrategien sind von der Militärführung entwickelte oder zumindest unterstützte, auf längere Zeiträume ausgerichtete Konzepte für die praktische Medienarbeit, die bestimmte Ziele verfolgten.19 Die Medienstrategien lassen sich anhand ihrer Ziele in vier Gruppen unterteilen: Es konnte erstens das Ziel sein, Medien im Hinblick auf relevante Informationen auszuwerten, um beispielsweise über die Aktivitäten anderer Streitkräfte im Bilde zu bleiben (Informationssammlung). Im Gegenzug galt es zweitens, eigene Informationen vor dem Zugriff anderer zu schützen, insbesondere im Hinblick auf technische Neuerungen oder Truppenbewegungen (Informationssicherheit). Gerade in Demokratien und im späteren Teil des Untersuchungszeitraums kam als drittes Ziel hinzu, Informationen über eigene Aktivitäten auszugeben, ohne damit weitergehende Absichten zu verfolgen (Informationsausgabe). Gezielte Versuche, bestimmte Zielgruppen im Inoder Ausland zu beeinflussen, waren das vierte Ziel (Einflussnahme). Strategien der Einflussnahme konnten in ihrer praktischen Anwendung zu einem regelrechten Medienkrieg zwischen konkurrierenden Streitkräften führen, dann nämlich, wenn die Situation des eigenen Landes im ,heißen‘ oder ,kalten‘ Konflikt mit anderen Ländern über Medienarbeit verändert oder die operative Kriegführung durch sie beeinflusst werden sollte. Die Medien konnten hier sowohl das Mittel bilden, mit dem die Auseinandersetzung geführt wurde, als auch das virtuelle ,Schlachtfeld‘, auf dem diese stattfand.20 Zum Medienkrieg zählen auch Versuche, das eigene Land gegen entsprechende Anstrengungen des Gegners zuschützen oder neutrale Staaten zu beeinflussen.21 Neben diesen kriegstypischen existierten friedenstypische Medienstrategien, zu denen insbesondere die Versuche gehörten, das eigene Ansehen zu steigern oder Ressourcen einzuwerben. Da sich die Militärführungen vor allem für die Medienstrategien der Einflussnahme interessierten, stehen diese im Fokus der Untersuchung. Hinzu kommen die Medienstrategien der Informationssicherheit, die immer als wichtig galten, auch wenn die Streitkräftespitzen sie nur selten diskutierten. Mit den übrigen Medienstrategien befassten sich die führenden Militärvertreter kaum. Sie werden daher nur am Rande behandelt.
Die bekannten Begriffe der Propaganda und Zensur werden in dieser Untersuchung allein verwendet, um Maßnahmen im Rahmen der Medienstrategien zu beschreiben. Denn gerade der Propagandabegriff ist derart weit gefasst, dass er über keine analytische Schärfe verfügt, da er im Grunde jegliches „Handeln in beeinflussender Absicht" bezeichnet.22 Aber auch der Zensurbegriff bezeichnet mehr als die Interaktion mit Medien und ihren Vertretern – beispielsweise bildete Zensur von Briefen und Telegrammen in den Weltkriegen einen wesentlichen Bestandteil der britischen Wirtschaftsblockade gegen Deutschland.23 Hinzu kommt, dass Propaganda und Zensur gleichermaßen genutzt werden konnten, um Einflussnahme oder Informationssicherheit zu erreichen.24 Die Konzentration auf P...