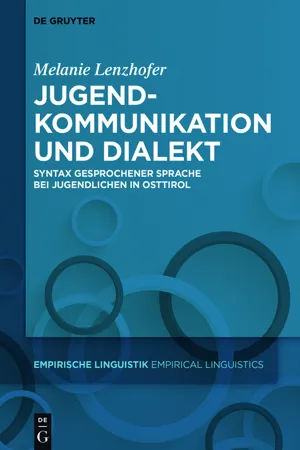1Einleitung
Das Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist durch differente Kommunikationsbedingungen, Domänen und Funktionen geprägt. Während erstere interaktiv und von einer wechselseitigen Beeinflussung gekennzeichnet ist, wird Schriftlichkeit durch die raum-zeitliche Distribution, die dauerhafte Tradierung von Wissen in Form von Texten und eine raumzeitliche Distanz, die eine Dekontextualisierung mit sich bringt, charakterisiert. Gesprochene Sprache ist dagegen stark situations- und kontextbezogen und in der Regel mit der raumzeitlichen Nähe der Gesprächspartner verbunden. Daraus folgen: Spontaneität und weitgehend freie Themenentwicklung auf der einen, geplante Formulierung und wiederholte Revisionsmöglichkeiten auf der anderen Seite. Der hervorstechendste Unterschied liegt aber in der weitgehend einheitlichen Verwendung der geschriebenen Sprache durch eine starke Orientierung an einer wie auch immer gearteten Norm seit Beginn der Frühen Neuzeit, der ein großes Varianzspektrum je nach Individuum, Gruppe, Situation oder Ort der Verwendung gesprochener Sprache gegenübersteht: Varianz als Grundcharakteristikum gesprochener Sprache (vgl. Fiehler et al. 2004: 130). Doch wie können sprachliche Besonderheiten mündlicher Kommunikation trotz dieser Vielfalt beschrieben und systematisch erfasst werden? Besonders anschaulich wird diese Problematik in Arbeiten zu syntaktischen Phänomenen gesprochener Sprache: Während in einem geschriebenen Text der Satz zu den grundlegenden grammatischen Einheiten gezählt werden kann, sind mündliche Äußerungen häufig nicht satzförmig – sie sind durch eine starke Situations- und Kontextgebundenheit gekennzeichnet, was z.B. Ein-Wort-Äußerungen oder empraktische Redezüge möglich und kommunikativ verstehbar macht. Die Ko-Präsenz der Sprecher/-innen und die zeitlich synchrone Produktion und Rezeption der Äußerungen kann auch zu ko-konstruierten Strukturen, zu Abbrüchen, Reparaturen und Expansionen führen. Mündliche Kommunikation kann zunächst nur in Gesprächsbeiträge mehrerer Sprecher/-innen eingeteilt werden – inwiefern diese überhaupt als satzförmig bezeichnet werden können bzw. welche Rolle die schriftbasierte Kategorie Satz in der Grammatik-schreibung gesprochener Sprache überhaupt einnehmen kann, ist dabei fraglich.
Diese Problematik der gegenstandsadäquaten Beschreibung gesprochener Sprache und ihrer grammatiktheoretischen Fundierung findet in der Jugendsprachforschung dagegen wenig Beachtung, was u.a. daran liegt, dass syntaktische Phänomenbereiche generell selten in den Fokus von Jugendsprachforscher/-innen geraten. Einerseits sind z.B. lexikalische oder phraseologische Besonderheiten, spezifische kommunikative Routinen (z.B. Frotzeln, Dissen) auffälliger und der linguistischen Beschreibung zugänglicher, andererseits stellt auch die schwierige Abgrenzung potentiell alterspräferentieller syntaktischer Besonderheiten in mündlicher Kommunikation gegenüber allgemeinen strukturellen Merkmalen informeller gesprochener Sprache eine gewisse methodische Hürde dar.1 Der in der öffentlichen Meinung häufig dargelegten Befürchtung der „sprachlichen Verarmung“ und der „mangelnden Grammatik“ im Sprachgebrauch Jugendlicher steht also die linguistische Auseinandersetzung mit der Frage gegenüber, ob denn überhaupt grammatische Besonderheiten in Jugendkommunikation festgehalten werden können – dies auch unter dem Aspekt, dass der Sprachgebrauch Jugendlicher von verschiedenen Einflussfaktoren sprachlicher Variation geprägt sein kann. Die Teilhabe an (multi-) ethnischen Gruppen von Sprecher/-innen mit Migrationshintergrund, Medienkonsum, präferierte Freizeitaktivitäten oder auch die regionale Herkunft können etwa zu diesen den Sprachgebrauch beeinflussenden Faktoren gezählt werden. Letzteres, die regionale Herkunft, ist in Bezug auf die hier vorliegenden diskursiven Daten besonders hervorzuheben. Untersucht werden nämlich Freizeitgespräche unter befreundeten Personen aus Osttirol, das dem südbairischen Dialektraum angehört. Die Gespräche in direkter Face-to-Face-Kommunikation wurden im Zeitraum zwischen April 2009 und April 2010 aufgezeichnet. Die Aufnahmen fanden dabei in einem informellen Setting in einer für die Sprechergruppe üblichen Konstellation und an einem vertrauten Ort statt.2 Die aufgezeichneten Gespräche sind geprägt durch freie Themenentwicklung, keinerlei von außen gesteuerte Rederechtsvergabe, Spontaneität und Interaktion. Aufgrund der Situationsparameter Vertrautheit der Gesprächspartner/-innen, Vertrautheit der Gesprächssituation und freie Themenwahl können die in Osttirol erhobenen Gespräche nach Lenz (2003) auch als „Freundesgespräche“ bezeichnet werden.
Ein kurzer Gesprächsausschnitt3 soll einen ersten Einblick in den Bereich mündlicher Kommunikation geben, der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist:
Beispiel 1: JD 18, Z. 384-394: „Verhütungsmittel“
384 | Con: | oba mei mama is do voll die FUrie. |
385 | | (---) is a WAHNsinn. |
386 | Kat: | [((lacht kurz))] |
| Kri: | [((lacht kurz))] |
387 | Con: | de hot sich hetz neulich so AUFgreg über des thema- |
388 | Joh: | [(1.0) w wieSO,] |
389 | Con: | [(1.0) weil mei] brUAder gfrog hot (.) ob i eben scho die PILle nehmen deafat; |
390 | | i mein keine Ahnung warum der des <<lachend> FROG>- |
391 | | [((lacht))] |
| Kat: | [((lacht))] |
| Kri: | [((lacht))] |
| Joh: | [((lacht))] |
392 | Con: | davon mol (-) ähm gonz OBgesehen, |
393 | | oba- |
394 | Kat: | des deaf man Erscht wenn man AUSgwochsen is und so. |
'Con: Aber meine Mama ist da voll die Furie. Ist ein Wahnsinn. Die hat sich jetzt neulich so aufgeregt über das Thema. Joh: Wieso? Con: Weil mein Bruder gefragt hat, ob ich eben schon die Pille nehmen dürfte. Ich mein keine Ahnung, warum der das fragt. Davon mal ganz abgesehen, aber- Kat: Das darf man erst, wenn man ausgewachsen ist und so.'
Neben lautlichen Besonderheiten des Bairischen (z.B. Bruader für 'Bruder' in Z. 389; vgl. Kapitel 3.1.3.) kennzeichnen diesen Ausschnitt eines Freizeitgesprächs von vier Freundin-nen aus Lienz typische Charakteristika mündlicher Face-to-Face-Kommunikation, z.B. Überlappungen von Redebeiträgen (vgl. Z. 388f.), (mehr oder weniger lang anhaltende) Pausen (vgl. Z. 385 und 388f.) und gefüllte Pausen (z.B. ähm, vgl. Z. 392) oder äußerungs-initiale bzw. -finale Diskursmarker (vgl. Z. 390: ich mein keine Ahnung, warum…). Auf syntaktischer Ebene stechen verschiedene Phänomene hervor, die in der Gesprochene-Sprache-Forschung bekannt sind: elliptische Strukturen (vgl. Z. 385: Ist ein Wahnsinn.; Z. 392: davon mal ganz abgesehen), Ausklammerungen (vgl. Z. 387: Die hat sich neulich so aufgeregt über das Thema.) oder auch – u.a. durch Unterbrechung des Redebeitrags entstehende – Anakoluthe (vgl. Z. 393). Darüber hinaus findet sich hier ein Beleg für eine syntaktische Konstruktion, die in der Fachliteratur der Jugendsprachforschung (vgl. z.B. Androutsopoulos 1998: 352) als typisch für den Sprachgebrauch Jugendlicher angesehen wird, nämlich die externe Intensivierung der Nominalphrase (vgl. Z. 384: Aber meine Mama ist da voll die Furie).4 Und auch dialektspezifische syntaktische Besonderheiten sind in Beispiel (1) enthalten, etwa die Konjunktiv-II-Bildung mittels eines Infixes -at- (vgl. Z. 389: deafat für 'dürfte').5 Insgesamt spannt sich anhand dieses kurzen Gesprächsausschnitts ein weiter Bereich sprachlicher Variation zwischen allgemeinen Charakteristika gesprochener Sprache, spezifischen Besonderheiten des (Süd-)Bairischen und möglicherweise bestehen-den alterspräferentiellen Markern auf. Bei den Osttiroler Proband/-innen handelt es sich um ortsgebürtige Sprecher/-innen ohne Migrationshintergrund, ihr Sprachverhalten ist als dialektgeprägt einzustufen.6 Welche Rolle dialektale Besonderheiten im Sprachgebrauch der jugendlichen Osttiroler/-innen spielen, inwiefern dialektsyntaktische Merkmale von regionen- und sprechergruppenübergreifenden Merkmalen gesprochener Sprache abgegrenzt werden können, und in welchen Bereichen syntaktischer Variation ein präferentieller Gebrauch unter den Jugendlichen festzustellen ist, bilden zentrale Fragestellungen der vorliegenden Arbeit.
Im Vordergrund steht dabei die Tatsache, dass das Korpus aus Freundesgesprächen und damit aus gesprochener Sprache besteht und sich primär schon aus dem Spannungsfeld Mündlichkeit – Schriftlichkeit oder besser: situationsgebundener mündlicher Interaktion und situationsentbundener schriftlicher Kommunikation Unterschiede in der Wahl der sprachlichen Mittel ergeben. Nur jene Phänomene, die sich nicht aus den spezifischen Kommunikationsbedingungen informeller Alltagsgespräche erklären lassen, können in weiterer Folge ausdifferenziert und sozio- bzw. dialektal interpretiert werden. Daraus ergibt sich auch der Untertitel der Monographie „Syntax gesprochener Sprache bei Jugendlichen in Osttirol“, der diese offene Herangehensweise an den Forschungsgegenstand widerspiegeln soll. Grundlage der folgenden Ausführungen ist zunächst gesprochene Sprache, die von jugendlichen (und erwachsenen) Proband/-innen aus Osttirol geäußert wurde. Durchgeführt wird eine korpusbasierte Analyse gesprochener Sprache im Spannungsfeld von oraler, arealer und altersbedingter Variation. Inwiefern der Faktor Alter in Bezug auf in den erhobenen diskursiven Daten vorkommende syntaktische Auffälligkeiten als einflussgebend gelten kann, muss eingehend beleuchtet werden. Die Basis dafür bildet ein Überblick über Forschungsbereiche, die Anknüpfungspunkte zur Thematik bieten (vgl. Kapitel 1.1.). Darauf folgt eine Zusammenfassung der forschungs-leitenden Fragen und zentraler Vorannahmen, die durch eine Darlegung des Aufbaus der Arbeit ergänzt wird (vgl. Kapitel 1.2.).
1.1Forschungsstand: Dialektal geprägte Jugendsprachen und ihre syntaktischen Merkmale
Als Ausgangspunkt für die Analyse syntaktisch variabler Phänomenbereiche in mündlicher Kommunikation Jugendlicher aus Osttirol soll in den folgenden Unterkapiteln in geraffter Form der Forschungsstand zur Thematik dargelegt werden. Da in Bezug auf syntaktische Besonderheiten im Sprachgebrauch jugendlicher Dialektsprecher/-innen bzw. generell Jugendlicher in Österreich keine einschlägige Forschungsliteratur als Grundlage herangezogen werden kann, ist der Forschungsstand auf die drei Teilbereiche Syntax der gesprochenen Sprache (Kapitel 1.1.1), Dialektsyntax des Bairischen (Kapitel 1.1.2.) und Syntax von Jugendsprachen (Kapitel 1.1.3.) aufzuteilen.
1.1.1Syntax der gesprochenen Sprache
Die linguistische Auseinandersetzung mit gesprochener Sprache findet ihren Anfang Mitte der 1960er-Jahre.7 Während anfänglich sprechsprachli...