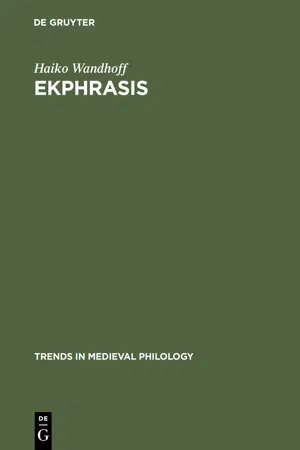
Ekphrasis
Kunstbeschreibungen und virtuelle Räume in der Literatur des Mittelalters
- 388 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Der Leser einer Kunstbeschreibung (Ekphrasis) ist bei der Lektüre einem ständigen Oszillieren zwischen Text und Bild ausgesetzt. Die vorliegende Untersuchung geht anhand verschiedener Beispiele den Einsichten nach, die die mittelalterliche Literatur ihren Lesern eröffnet, indem sie immer wieder Bild- und Architekturbeschreibungen in den linearen Fluss narrativer Texte einschaltet. Die Arbeit versucht, eine Geschichte der Ekphrasis zu rekonstruieren, die sich vom antiken Epos bis zum nachklassischen höfischen Roman im ausgehenden 13. Jahrhundert erstreckt.
Vor allem drei Konzepte leiten die Argumentation: die Analyse literarischer Kunstbeschreibungen als Memorialbilder, als Spiegelungen des Visuellen im Verbalen bzw. der Makro- in der Mikroerzählung sowie als virtueller Schauraum.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Ekphrasis und visuelle Imagination im Mittelalter
- I. Ekphrasis – Positionen der Forschung
- Intermedialität: Ekphrasis als Schnittstelle auditiver und visueller Medialität
- Narratologie: Ekphrasis als spiegelnde Erzählung in der Erzählung
- Ekphrasis als Repräsentationstheorie
- II. gebildet und gebuochstabet – Kunstbeschreibungen im Mittelalter
- Besonderheiten der mittelalterlichen Kunstbeschreibung
- evidentia und imaginatio: Der rhetorische Ekphrasis-Begriff und die mittelalterliche Vorstellung vom ,inneren Sehen‘
- Memorialbilder, Spiegelungen und virtuelle Räume: Zu Konzeption und Aufbau der Arbeit
- Erstes Kapitel. Der Bild-Schirm des Schildes: Die antike Ekphrasis und ihre Überschreibungen im 12. Jahrhundert
- I. Der Schild des Achilles als Urszene der antiken Ekphrasis
- Kosmos-Schilde im Mittelalter
- II. Die para-narrativen Ekphrasen des Hellenismus und die Kunstbeschreibungen Vergils
- Die Ekphrasen der „Aeneis“
- Bewegungsbilder: Das ,kinematographische‘ Moment antiker Kunstbeschreibungen
- III. Vom flachen Bild-Schirm zum materiellen Artefakt: Die Schildbeschreibungen der Eneasromane
- Die Rüstungsschilderung im „Roman d’Eneas“
- Schild und Rüstung als dreidimensionales Gehäuse bei Heinrich von Veldeke
- ,Vergilische‘ Schildbeschreibungen in der lateinischen Epik des 12. Jahrhunderts
- Zweites Kapitel. Schauräume des Todes: Die Besichtigung der antiken Welt in den Grabmalbeschreibungen der Eneasromane
- I. Ekphrasis als architektonische Inszenierung des Todes: Der „Roman d’Eneas“
- Poetik der Einkapselung: Die Entstehung des höfischen Romans als Epitaphium auf die unerlöste Welt der Antike
- Monumentale Warnungen vor dem Sturz des Hohen: Grabbeschreibungen in der lateinischen Epik des 12. Jahrhunderts
- II. Vertikalität und Transzendenz: Der Umbau der Grabarchitektur bei Heinrich von Veldeke
- Der fromme Euander und die proto-christliche Erdbestattung des Pallas
- Pallas – ein Ritter-Märtyrer?
- Das Grabmal der Camilla als selbstgebaute Himmelsstadt
- Der Raum zwischen Himmel und Erde: Die Öffnung der Grabmäler auf die Transzendenz des Heilsgeschehens
- III. Architektur – Schrift – Gedächtnis: Mentale Bauwerke in Bibel, Gedächtniskunst und Literatur
- Drittes Kapitel. Der gespiegelte Kosmos im Text: Ekphrasis als nach Maß und Zahl geordnetes Welt-Bild des frühen Artusromans
- I. Die vier Insignien des Königs und die kosmische Tektonik von Chretiens de Troyes „Erec et Enide“
- Die Kunstbeschreibungen der Krönungszeremonie
- Die Vierzahl als Operator des Bildaufbaus und die Schemabilder des Kosmos-Menschen
- Mundus triplex und Septem artes liberales
- Krone und Kreuz, Thron und Altar: Ein virtueller Gang vom Palast in Nantes zum Münster in Carnant
- Zwei weitere königliche Schauräume: Die Hochzeit in Cardigan und die Wundheilung in Pointurie
- Die pictura der Krönungsszene als Eingangsportal zum geometrischen Schauraum des Textes
- Der neue Romanheld als neuer König und neuer Mensch oder die Spiegelung der Heilsgeschichte im Artusroman
- Der Weltenmantel, die conjointure und Chrétiens ekphrastische Antwort auf den Antikenroman
- II. Die ganze Welt auf einem Pferd: Der Umbau der kosmologischen Ekphrasis im „Erec“ Hartmanns von Aue
- Enites neues Pferd und das ikonographische Motiv des Weltallbildes
- 3 – 4 – 12: Die Zahlenverhältnisse der Ekphrasis
- Der handlungsferne Schauraum der Ekphrasis und der Dichter als Bild-Künstler
- Die Umarbeitung des Weltenmantels zur Pferdedecke und der neue Kosmos des höfischen Rittertums
- Hartmanns pictura des Wunderpferdes als inverse Spiegelung der Romanhandlung
- Viertes Kapitel. Vorzeitschau in virtuellen Räumen: Das Troja-Bilddenkmal in der Literatur der Mittelalters
- I. Einblicke in das kulturelle Gedächtnis des Laienadels: Der trojanische Krieg als Gründungsereignis des Rittertums
- Trojanische Tele-Visionen
- Vergil und die Folgen: Aeneas vor den Troja-Tempelbildern in Karthago
- Der trojanische Krieg als Ursprung des Rittertums
- Trojanische Bildräume als historisch-kulturelles Fundament der Artusgesellschaft
- Von den virtuellen Memorialräumen der Literatur zur höfischen Wandmalerei
- II. Gegen-Bilder von Liebesfuror und Ehebruch: Der trojanische Krieg im Kosmos der lateinischen Literatur des 12. Jahrhunderts
- Baudri von Bourgueil und der trojanische Krieg im Schlafgemach der Adele von Blois
- Literarische Raum-Führungen: Zu den „Eikones“ des Philostratos und zur Beschreibung von Kircheninnenräumen
- Alanus ab Insulis und die antiken Exempelfiguren im Palast der Natura
- Johannes von Hauvilla und das Troja-Bilddenkmal im Palast der Ehrgeizigen
- Vom Mißverstehen der Bilder: Enites Pferd auf dem Mons Ambitionis
- Ausblick: Virtuelle Troja-Räume im Spätmittelalter
- Fünftes Kapitel. Bild-Eingänge: Ekphrasis als Portal des Textes
- I. Bild-Eingänge in Antike und Mittelalter
- Alanus ab Insulis und das kosmologische Eingangsbild in „De planctu Naturae“
- II. Trojanische Bild-Eingänge in volkssprachigen Erzählungen des 13. Jahrhunderts
- Pleiers „Meleranz“: Der locus amoenus als Gedächtnisort und Landkarte des Textes
- Der Troja-Pokal als Eingangsbild in Konrad Flecks „Flore und Blanscheflur“
- Helmbrechts Haube – eine ,Landkarte des Hirns‘? Ein bildkritischer Bild-Eingang bei Wernher dem Gartenaere
- Die Ehrgeizigen mißverstehen die Kunst: Wernhers „Helmbrecht“ und das Vor-Bild des „Architrenius“
- III. Der Gralstempel im „Jüngeren Titurel“ als heilsgeschichtliches Eingangsportal des Gralsromans
- ergraben und ergozzen: Die Vorschau auf die Taten der Gralsritter an den Außenwänden des Tempels
- Sechstes Kapitel. Selbst-Bilder: Die Spiegelung des Romanhelden im Kunstwerk und die medialen Funktionen von Bildnis und Inschrift
- I. Die Gawein-Darstellung auf der Schüssel des Laniure und das trojanische Eingangsbild in der „Crône“ Heinrichs von dem Türlin
- Die Überwindung der trojanischen Minne-Konzeption im Artusreich
- II. Im Gefängnis der Imagination: Lancelots selbstgemalte Wandbilder und das Vor-Bild des Aeneas profugus
- Die Vita als Bildkunstwerk und die visuelle Kunst als Therapeutikum
- Ekphrastische Spiegeltechnik und mise en abyme im „Prosa-Lancelot“
- Zur Funktion der Inschriften in den mittelalterlichen Selbst-Bildern
- III. Flore vor dem Scheingrab Blanscheflurs: Zu den medialen Funktionen von Schrift und Bild in der epischen Totenmemoria
- Blanscheflurs Scheingrab
- Troja-Pokal und Scheingrab als zweiteiliger Bild-Eingang
- Der unversehrte Leib des Toten als Auferstehungsversprechen: Zur Funktion des Grabbildes in der Totenmemoria
- Animierende Bildmagie und tötende Schrift des Gesetzes
- Ein inschriftliches Eingangsbild: Die Tafel des Gregorius
- Die Inschrift und das Ende des Erzählens: Der „Prosa-Lancelot“ als Epitaphium auf den Artusroman
- Schluß: Bewegte Bilder und virtuelle Räume zwischen Erinnerungs- und Projektionstechnik
- Literatur als Pré-Cinema
- Das Wandern durch die Topographien von Sprache und Literatur
- Virtualität und Interaktivität im Cyberspace und in der mittelalterlichen Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Textausgaben
- Forschungsliteratur
- Namenregister