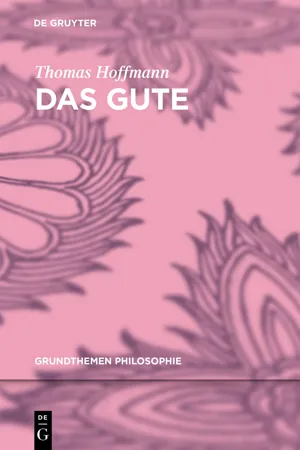![]()
1 Einleitung
1. Im Laufe der Moderne sind sowohl in der Philosophie als auch im Alltagsverständnis vier Grundgedanken immer dominanter geworden, die unsere Vorstellungen der praktischen Vernunft, der Ethik und der Moral geprägt haben. Diese vier Grundgedanken wurden im 20. Jahrhundert, einzeln oder miteinander kombiniert, in teils sehr unterschiedlichen philosophischen Ansätzen mal mehr und mal weniger aus- und nachdrücklich vertreten. Wollten wir diesen Grundgedanken Namen geben, so könnten wir sie mit folgenden Ismen versehen: „metaethischer Nonkognitivismus“, „rationaler Instrumentalismus“, „ethischer Subjektivismus“ und „moralischer Intersubjektivismus“.
Diese vier Grundgedanken erzeugen jeder für sich, aber insbesondere alle zusammen, ein bestimmtes Bild von der Rolle, die Vernunft, Ethik und Moral in unserem Leben spielen. Dieses Bild gibt uns philosophische Rätsel auf, die scheinbar nach wie vor ihrer Lösung harren und daher den modernen Moralphilosophen auch beständig Stoff für neue Diskussionen liefern. Denn es scheint nach wie vor strittig, wie sich im Allgemeinen bestimmen lässt, was gut und richtig ist und warum man überhaupt Gutes beabsichtigen und richtig handeln sollte. Wollten wir uns an den etwas sperrigen Titel von Friedrich Schillers Jenaer Antrittsvorlesung anlehnen, könnten wir sagen, dass die moderne Moralphilosophie nach wie vor eine Antwort auf die Frage sucht: Was heißt es und aus welchem Grunde sollte man danach streben, gut zu sein?
Im Folgenden will ich keineswegs den insolenten Versuch wagen, diese Frage erschöpfend zu beantworten. Stattdessen möchte ich vielmehr einen Vorschlag machen, der einige Rätsel der modernen Moralphilosophie nicht löst, sondern nach Möglichkeit auflöst.1 Letzteres soll dadurch erreicht werden, dass die Skizze eines anderen Bilds an eben jene Stelle gesetzt wird, die noch immer von dem etablierten Bild der modernen Moralphilosophie in Beschlag genommen wird. Die Skizze des neuen Bilds soll allerdings nicht dazu dienen, bessere Darstellungen dessen zu liefern, was ohnehin schon auf dem alten Bild zu sehen ist. Anders als in jenem etablierten Bild der modernen Moralphilosophie, das uns nach wie vor gefangen hält, sollen Ethik und Moral nicht länger nonkognitivistisch, instrumentalistisch, subjektivistisch und intersubjektivistisch schimmern. Vielmehr sollen sie in einem anderen Licht erscheinen: in einem anti-anti-realistischen Licht, das sie in natürlicher Objektivität erstrahlen lässt.
Die mit diesem Unterfangen verbundene Hoffnung besteht darin, dass wir davor bewahrt werden, philosophische Rätsel dort zu sehen, wo es keine gibt. Sehen wir nämlich keine Rätsel, so drängt uns auch nichts zu ihrer Lösung. Und das kann in der Philosophie von Vorteil sein. Denn nur allzu oft führt uns die philosophische Krankheit, erklären zu wollen, zu philosophischen Lösungen, die ihre Rätsel erst hervorbringen.2
2. Fügt man die vier genannten Grundgedanken der modernen Moralphilosophie, die heutzutage nahezu selbstverständlich erscheinen, zusammen, so ergibt sich ein Bild von Ethik und Moral, das mindestens ebenso selbstverständlich und fraglos zu gelten scheint, wie seine einzelnen Komponenten. Obgleich seine Geltung scheinbar kaum hinterfragt werden kann, ist es jedoch zugleich eigentümlich nebulös und schwer zu fassen. Das liegt daran, dass es ein dominantes Bild ist und keine einzelne Theorie. Es ist das, was viele und en detail womöglich auch recht unterschiedliche Theorien verbindet. Nicht jede einzelne Theorie, die im Zuge der modernen Moralphilosophie präsentiert wurde, enthält daher notwendig alle vier genannten Grundgedanken als explizite Komponenten – auch dann nicht, wenn sie zweifelsohne dazu beiträgt, das dominante Bild zu erzeugen. Die einzelnen Theorien, die sich zu einem Bild fügen, stehen vielmehr im Verhältnis der „Familienähnlichkeit“ zueinander, wie man mit Ludwig Wittgenstein sagen könnte.3
Ein philosophisches Bild ist daher diffuser als die meisten philosophischen Theorien. Der Zusammenhang seiner Bestandteile ist unbestimmter, und seine Angriffspunkte sind oft weniger klar auszumachen. Dies macht es ungleich schwerer, ein Bild zu verabschieden, als eine Theorie anzugreifen. Dennoch lohnt der Versuch, ein lieb gewordenes Bild, das uns nur schlimm und arg verwirrt, ins Meer der Geschichte hinab zu senken und darauf zu hoffen, dass der Sarg auch groß genug sein mag, um die alten, bösen Rätsel zu begraben. Denn letzten Endes sind es immer bestimmte Bilder, nicht einzelne Theorien, die uns in der Philosophie zu den großen und schweren Rätseln führen und verführen.
Theorien können wir als solche nämlich relativ klar ausmachen. Wir können mehr oder minder genau sagen, wo sie beginnen, wo sie aufhören und worin ihr Inhalt besteht. Wir können sie ziemlich schnell als einen thematischen Gegenstand vor uns bringen. Und sofern wir sie für falsch, inkohärent, kontraintuitiv oder für über Gebühr reduktionistisch halten, können wir uns ihrer auch mit Argumenten entledigen, so wie wir uns kleiner oder mittelgroßer Dinge entledigen können, indem wir sie aus unserer Umgebung entfernen oder wir uns aus ihrer. Denn Theorien sind be- und abgrenzbar. Wir können ihre Grenzen ausmachen, was es uns ermöglicht, sie als einzelne Gegenstände zu betrachten. Philosophische Bilder sind verwirrender und gefährlicher als Theorien, gerade weil sie diffuser und oftmals unthematisiert sind.
Hält uns ein Bild gefangen, so können wir uns zumeist nicht einfach dadurch von ihm befreien, dass wir es, wie eine Theorie, aufgrund dieser und jener systematischen Unzulänglichkeit zurückweisen. Denn oft merken wir gar nicht, dass uns ein Bild gefangen hält, da wir weder seine Grenzen kennen noch das, was hinter ihnen liegt. Sind wir Gefangene des Bildes, ohne es zu merken, so erscheint uns das Bild (anders als eine Theorie) als selbstverständlich und fraglos gültig. Anstatt das Bild kritisch zu betrachten, halten wir es von vornherein für die unhinterfragbare Wirklichkeit, innerhalb derer kritische Betrachtungen überhaupt nur angestellt werden können. Dann wird das Problematische des Bildes durch unsere kritischen Betrachtungen oftmals aber gerade nicht aufgedeckt, sondern geradezu verschleiert. Wir diskutieren dann kritisch einzelne Theorien, die immer schon im Bilde sind.
Ich versuche mich nachfolgend eher mit philosophischen Bildern zu beschäftigen, als mit einzelnen Theorien. Gehe ich gelegentlich etwas detaillierter auf die Position dieses oder jenes Philosophen ein, so nur deshalb, weil sie mir paradigmatisch für ein bestimmtes Bild erscheint. Denn wird unser Denken letztlich nicht so sehr von einzelnen philosophischen Theorien gefangen gehalten als vielmehr von bestimmten philosophischen Bildern, so sollten wir auch weniger einzelne Theorien und ihre Details diskutieren, sondern uns wieder stärker auf die grundlegenderen Probleme konzentrieren, die uns philosophische Bilder bereiten.
In der Gegenwartsphilosophie, mit ihren Myriaden von unverbunden nebeneinander stehenden Sub-Diskursen der Spezialisten, ist der Drang zum theoretischen Detail freilich ungebrochen. Aber es wäre meines Erachtens schon eine sehr merkwürdige Auffassung von Philosophie, betrachtete man es als Selbstzweck, etwa dafür zu argumentieren, dass David Chalmers’ Bestimmung des Type-E-Dualism unzulänglich ist, weil sie Frank Jacksons Ansichten zum ontologischen Status von Qualia nicht angemessen wiedergibt.4 Statt philosophische Landkarten zu zeichnen, auf denen man fein säuberlich die Positionen von Chalmers, Jackson und allen anderen an der Qualia-Diskussion beteiligten Philosophen einträgt, sollte man sich hier besser fragen, ob die philosophische Erfindung des Quale, die vielen Philosophen so attraktiv erscheint, überhaupt kohärent vorgestellt werden kann. Denn erst Fragen solcher Art – wie sie etwa Wittgenstein oder John McDowell stellen5 – haben das Zeug, unser Denken von den Rätseln dominanter Bilder zu erlösen.
3. Um uns aus der Gefangenschaft eines philosophischen Bildes befreien zu können, müssen wir zuallererst versuchen, das schwer zu fassende Bild als solches zu erkennen, indem wir damit beginnen, die Familienähnlichkeiten derjenigen Theorien ausfindig zu machen, die das Bild und seine Rätsel erzeugen. Daher versuche ich im zweiten Kapitel, Moderne Moralphilosophie, die Probleme und Rätsel in den Blick zu bekommen, die der metaethische Nonkognitivismus, der rationale Instrumentalismus, der ethische Subjektivismus und der moralische Intersubjektivismus hervorbringen.
dp n="12" folio="4" ? Im dritten Kapitel, Moralische Wahrheiten, werde ich die nonkognitivistische These fehlender Wahrheitsfähigkeit moralischer Urteile näher betrachten. Denn meines Erachtens ist die Ansicht, dass moralische Urteile nicht wahrheitsfähig sein können, zwar nicht der Grund allen Übels, aber zumindest die Grundierung desjenigen Bildes, das uns zu falschen Vorstellungen über die Rolle der Moral in unserem Leben treibt. Ich werde argumentieren, dass es zwar auf der Ebene einer formalen Wahrheitssemantik für die Sätze einer bestimmten Sprache keine größeren Probleme gibt, die Wahrheitsbedingungen von Sätzen anzugeben, mit denen wir moralische Urteile artikulieren können. Aber ganz abgesehen von der Frage, ob eine formale Wahrheitssemantik für natürliche Sprachen überhaupt ein erhellendes bedeutungstheoretisches Projekt der Sprachphilosophie sein kann, werde ich deutlich zu machen suchen, dass man auch als moralphilosophischer Kognitivist schlecht beraten wäre, glaubte man, sich dadurch von einem robusten Nonkognitivismus befreien zu können, dass man auf die Möglichkeiten einer formalen Wahrheitssemantik verweist. Denn ein robuster Nonkognitivismus muss die Möglichkeit einer formalen Wahrheitssemantik für Sätze, durch deren Äußerung man moralische Urteile fällen kann, gar nicht bestreiten. Was durch einen robusten Nonkognitivismus vielmehr bestritten wird, ist die Möglichkeit des objektiven Bestehens moralischer Tatsachen und Eigenschaften in der natürlichen Welt.
Einerlei, was man von korrespondenztheoretischen Versuchen der Wahrheitsdefinition halten mag – und ich halte davon nicht sehr viel –, muss man das nonkognitivistische Verneinen der Möglichkeit des objektiven Bestehens moralischer Tatsachen und Eigenschaften in der natürlichen Welt ernst nehmen, will man angemessen auf den Nonkognitivismus reagieren. Und das heißt, so die Quintessenz des dritten Kapitels, dass man sich nicht mit wahrheitssemantischen oder wahrheitstheoretischen, sondern vor allem mit ontologischen (und auch erkenntnistheoretischen) Fragen auseinandersetzen muss, die die Möglichkeit des Bestehens moralischer Tatsachen in der natürlichen Welt betreffen.
Im vierten Kapitel, Szientistische Seltsamkeit, setze ich mich daher mit der Ansicht auseinander, die Vorstellung des objektiven Bestehens moralischer Eigenschaften und somit moralischer Tatsachen in der natürlichen Welt sei ontologisch (und epistemisch) „queer“, also höchst seltsam. Ich versuche zu zeigen, dass diese Ansicht nur die ethische Schattenseite einer erkenntnistheoretischen und ontologischen Medaille ist, auf deren Vorderseite empiristisch-szientistische Auffassungen zum verlässlichen Wissen und zur natürlichen Welt glänzen. Diese Auffassungen haben ihren etwas verblassten Ursprung im klassischen britischen Empirismus (insbesondere David Humes), während ihr Glanz im letzten und leider auch noch in diesem Jahrhundert vom logischen Positivismus Wiener Provenienz (vor allem Rudolf Carnaps) herrührt. Ich argumentiere dafür, dass beide Seiten der Medaille – deren Vorderseite in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem von Willard Van Orman Quine und seinen Nachfolgern kräftig poliert wurde – unplausibel sind, wobei die schattige Unplausibilität einer nonkognitivistischen Ethik sich nur aus der glänzenden Unplausibilität einer szientistischen Ontologie ergibt, die ich „szientistischen Naturalismus“ nenne.
Obgleich es mir hier zuvorderst um die Möglichkeit des Bestehens objektiver moralischer Tatsachen als solcher in der natürlichen Welt geht, kann man das, was im dritten und im darauf folgenden fünften Kapitel gesagt werden wird, auch als den allgemeineren Versuch auffassen, den Begriff der Tatsache insgesamt aus seinem allzu engen empiristischen Korsett zu befreien. Dazu muss man nicht bestreiten, dass wir es mit höchst unterschiedlichen Sachverhalten zu tun haben, wenn es entweder darum geht, dass gerade ein Kaninchen an einem Gebüsch vorbeihoppelt, oder darum, dass Diebstahl schlecht ist. Und man muss freilich ebenso wenig bestreiten, dass die Art und Weise, wie wir die entsprechenden Urteile oder Aussagen rechtfertigen würden, höchst unterschiedlich ist. Denn es wäre nicht nur eine sehr beschränkte Sicht auf die Welt, sondern geradezu absurd, glaubte man ernsthaft, es gäbe so etwas wie eine einheitliche Methode, mit der man sowohl Urteile über das Vorbeihoppeln von Kaninchen als auch über die Schlechtigkeit von Diebstahl verifizieren könnte. Aber daraus folgt keineswegs eo ipso, dass es nicht ebenso eine objektiv bestehende Tatsache in der natürlichen Welt sein kann, dass Diebstahl schlecht ist, wie es eine objektiv bestehende Tatsache in der natürlichen Welt sein kann, dass gerade ein Kaninchen an einem Gebüsch vorbeihoppelt.
Mir scheint, dass man nur dann geneigt ist, den Begriff der Tatsache mehr oder minder exklusiv für Fälle letzterer Art zu reservieren, wenn man bereits –unter der Hand oder ausdrücklich – den Tatsachenbegriff bestimmten empiristischen Dogmen unterworfen hat. Das sind zum einen Dogmen, die ganz bestimmte Verfahren und Methoden der Rechtfertigung von Urteilen bzw. Aussagen vor vielen anderen Arten der Rechtfertigung und Begründung auszeichnen, die wir tagtäglich in unserer gewöhnlichen Praxis vollziehen. Und es sind zum anderen Dogmen, die schon ganz bestimmte ontologische Festlegungen beinhalten, was als Teil der natürlichen Welt und als natürliche Welt zu gelten habe – Festlegungen, die von einer naturwissenschaftlich dominierten Sicht der Welt und des in ihr Seienden herrühren.
Eine solche Sicht, die sich dem szientistischen Naturalismus fügt, ist zwar heutzutage populär, aber sie ist deshalb nicht auch schon selbstverständlich. Und daher ist man meines Erachtens auch nicht ohne weiteres dazu gezwungen, den Begriff der Tatsache von vornherein als einen empiristischen Begriff auszubuchstabieren –und damit unter anderem das Bestehen objektiver moralischer Tatsachen als solcher in der natürlichen Welt von vornherein unmöglich zu machen. Stattdessen kann man auch so frei sein, den heutzutage wohl leider eher waghalsigen Versuch zu unternehmen, ein Bild der Welt zu skizzieren, in dem diese als vollständig natürlich dargestellt wird, ohne dabei vollständig naturwissenschaftlich dargestellt zu werden.
Das fünfte Kapitel, Geistreiche Welt, ist einem solchen Versuch gewidmet. Denn in diesem Kapitel bemühe ich mich, eine Alternative zum gegenwärtig nahezu uneingeschränkt anerkannten szientistischen Naturalismus zu skizzieren, die ich „hermeneutischer Naturalismus“ nenne. Das ontologische Bild, das ich dabei zu zeichnen suche, lehnt sich an Hans-Georg Gadamers, Martin Heideggers und Wittgensteins Begriff der Sprache an. Es stützt sich auf Heideggers „Erschlossenheit“, Gadamers „Welt“, Aristoteles’ „ousia“ und Georg Wilhelm Friedrich Hegels Begriff des Begriffs. Und es macht auch, gewissermaßen „zur Hälfte“, Gebrauch von McDowells Begriff der second nature. Ausgiebig Gebrauch wird nämlich von derjenigen Hälfte gemacht, die von der Natur handelt, während jene, die Ordinalia...