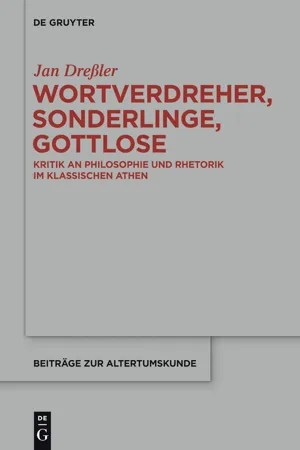1.1 Forschungsstand und Thema der Arbeit
Athen in klassischer Zeit galt schon den Zeitgenossen als „Schule Griechenlands“ (τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν)1 und „Hauptsitz der Weisheit“ (τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας).2 Isokrates meinte über seine Heimatstadt: „Unsere Polis hat nun auf dem Gebiet intellektueller und rhetorischer Fähigkeiten alle anderen Menschen soweit zurückgelassen, daß die Schüler Athens Lehrer der anderen geworden sind“.3 Der Stolz auf die kulturelle Leistung und Ausstrahlung der Stadt kommt in mehreren Texten der Zeit zum Ausdruck.4 Doch wie repräsentativ sind diese Stimmen? Dass nicht alle Isokrates’ Meinung teilten, merkt er selbst in seiner Antidosis-Rede nicht ohne Verärgerung an: „Darauf aber müßten alle Bürger stolz sein und Männer sehr schätzen, die unserer Polis diesen Ruhm eingebracht haben.“ Stattdessen besäßen manche „die Unverschämtheit […], Verleumdungen über diese Menschen in Umlauf zu setzen“.5 Isokrates geht es dabei vor allem um die rhetorische Bildung, um die er selbst sich ein Leben lang bemühte. Doch auch die Philosophen mussten sich nicht selten als Schwätzer, Scharlatane, wunderliche Außenseiter oder gar Gottlose bezeichnen lassen. In der Politeia fasst Platon die Kritik dahingehend zusammen, dass „die meisten, die sich mit [der Philosophie] abgeben, […] ganz schlecht und nur die Ausgezeichnetsten bloß unnütz“ werden würden.6
Es stellt sich daher grundsätzlich die Frage: Was dachten ihre Zeitgenossen über Leute wie Anaxagoras, Protagoras, Isokrates und Platon und die Studien, mit denen sie und ihre Schüler sich beschäftigten? Welches Bild hatte man von den Philosophen und Rhetoriklehrern in der Stadt, deren Ruhm die gesamte Antike hindurch und bis heute in so großem Maße von ihren intellektuellen Leistungen profitiert hat? Die Etablierung eines geistigen Bildungswesens, die sich in Athen seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vollzog, bedeutete einen grundlegenden kulturellen Wandel, der die Stadt wesentlich geprägt hat.7 Die Bedeutung dieser Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf das kulturelle und soziale Leben wurde bereits von den Zeitgenossen wahrgenommen.
Entgegen der heutigen Sicht, dass hier die Grundlagen abendländischer Bildung gelegt wurden, standen im Fokus der zeitgenössischen Diskussion häufig die negativen Aspekte des neuen Denkens. Das Weltbild der Philosophen stand erkennbar im Kontrast zu den Vorstellungen, die sich die meisten Menschen über die Welt, die Götter, die menschliche Gesellschaft und ganz allgemein den Sinn des Lebens machten. Die Gottlosigkeit, die den Philosophen immer wieder unterstellt wurde, war dabei nur ein Thema in der Diskussion. Der Sinn so mancher Theorie schien fragwürdig und ebenso der Nutzen, den solche Studien für das menschliche Leben haben sollten. Andererseits befürchtete man, dass die argumentativen Fähigkeiten, die Rhetoriklehrer und Philosophen vermittelten, sowohl in den politischen Institutionen als auch im sozialen Leben zu unlauteren Zwecken ge- und missbraucht werden könnten.8 Die Häufigkeit solcher und ähnlicher Vorbehalte in den Quellen zeigt, dass die Kritik an Philosophie und geistiger Bildung ein aktuelles und wichtiges Thema im zeitgenössischen Diskurs des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. gewesen ist. Eben um diese Diskussion geht es in der vorliegenden Arbeit. Ihr Ziel ist es, die gängigen Wahrnehmungsmuster und Topoi, die diese Diskussion ausmachten, umfassend zu rekonstruieren und zu analysieren.
Einflüsse des philosophischen Denkens finden sich in vielen zeitgenössischen Texten.9 Wie eingehend und vielfältig sich etwa Euripides in seinen Stücken damit auseinandergesetzt hat, ist zuletzt von Franziska Egli in einer ausführlichen Untersuchung gezeigt worden.10 In der vorliegenden Arbeit geht es jedoch nicht um die Rezeption philosophischer Ideen an sich, sondern um deren Wahrnehmung und (kritische) Bewertung durch die Zeitgenossen. Eine explizite Wertung und Kritik der aufgegriffenen Ideen findet sich allerdings in der Tragödie nur selten. Da die Handlung in einen zeitlich und örtlich entrückten mythischen Raum verlagert ist, spielen die Figur des philosophischen Lehrers und das, was er seinen Schülern beibringt, in ihr zumeist keine wichtige Rolle. Anders ist dies in der Komödie. Sie lehnt sich sehr viel enger an das aktuelle Zeitgeschehen in Athen an als die Tragödie, und so finden wir in ihr nicht nur die Philosophen selbst als Figuren, sondern vor allem die Art von expliziter und kritischer Auseinandersetzung mit ihrem Denken und Wirken, die das Thema dieser Arbeit ist.
Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die Philosophen in der Komödie zumeist als Typus auftreten.11 Dieser Typus hat verschiedene Facetten, deren wichtigste seine Darstellung als weltfremder und komischer Außenseiter ist. Dieses Bild, das vor allem auf die (angebliche) Sinn- und Nutzlosigkeit der Philosophie abzielt, repräsentiert tatsächlich einen wichtigen Aspekt der zeitgenössischen Diskussion. Doch auch potenzielle Gefahren geistiger Bildung werden auf der Bühne – besonders in Bezug auf Naturphilosophie, Rhetorik und eine sophistisch-inspirierte Moral – thematisiert. Davon ausgehend verfolgt die vorliegende Arbeit ein doppeltes Ziel: Zum einen soll die Darstellung der Komödie auf das tatsächliche Denken und Wirken der Philosophen bezogen werden. Zum anderen stellt sich die Frage nach der Repräsentativität und Relevanz der in ihr zu greifenden Kritik. Um diese Frage zu beantworten, werden ihre Äußerungen im Zusammenhang mit anderen zeitgenössischen Texten wie auch der Reaktion der Philosophen auf die Kritik diskutiert. Dabei zeigt sich, dass die komische Philosophiekritik zwar den Konventionen des Genres entsprechend verfremdet und überspitzt ist, aber gleichwohl auf Meinungen verweist, die auch außerhalb des Theaters geäußert wurden und durchaus ernst zu nehmen sind.
Dies gilt etwa für die Sicht, die Theorien der Naturphilosophen wie auch die Gedanken, die sich die Sophisten zur Religion machten, seien eine Gefahr für den gängigen Glauben an die Götter. Der Asebie-Vorwurf war besonders im späten 5. Jahrhundert einer der wesentlichen Punkte in der zeitgenössischen Auseinandersetzung um die Philosophie. In der Forschung haben zumeist die Asebie-Verfahren gegen Philosophen im 5. und 4. Jahrhundert im Vordergrund gestanden.12 Die vorliegende Arbeit interessiert sich dagegen nicht für diese Prozesse an sich, sondern vor allem für den zeitgenössischen philosophiekritischen Diskurs, der sie ermöglichte und zugleich in ihnen zum Ausdruck kam. Dafür sollen die im Kontext der Verfahren aufgeworfenen Kritikpunkte detailliert untersucht und in den Zusammenhang weiterer Äußerungen zur ‚Gottlosigkeit’ der Philosophen in den zeitgenössischen Quellen gestellt werden. Wird als ideengeschichtlicher Hintergrund oft nur Aristophanes’ bekannte Philosophenkomödie Die Wolken herangezogen, sollen in dieser Untersuchung eine Vielzahl von unterschiedlichen Texten in den Blick genommen werden, die sich mit der Asebie-Problematik auseinandersetzen.
Ein ebenso wichtiges, wenn auch gänzlich verschiedenes Streitthema war die Rhetorik. Dass und wie die zentrale Rolle, die der Rede in den Entscheidungsprozessen der athenischen Demokratie zukam, im zeitgenössischen Diskurs, insbesondere in der Auseinandersetzung zwischen den Rednern, thematisiert und problematisiert wurde, ist besonders von Josiah Ober, Harvey Yunis und Jon Hesk bereits eingehend untersucht worden.13 Vor diesem Hintergrund sollen in der vorliegenden Arbeit vor allem drei Aspekte noch eingehender beleuchtet werden: Erstens soll gefragt werden, wie die Tatsache reflektiert und bewertet wurde, dass es sich bei der Rhetorik um ein Bildungsgut handelte, das man sich seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts mit Hilfe entsprechender professioneller Lehrer aneignen konnte. Zweitens schließt sich daran die Frage an, wie sich die gängigen Vorbehalte gegenüber der Macht der Rhetorik auf die Wahrnehmung der Lehrer dieser Kunst auswirkten. Und drittens soll der Fokus erweitert werden: Liegt er in den meisten Arbeiten auf der Rolle und Bewertung der Rhetorik im politischen Bereich, soll in dieser Untersuchung auch die parallel geführte Diskussion betrachtet werden, in der die Wirkungen von Sprachbeherrschung und Argumentationskönnen im gesellschaftlichen Leben allgemein thematisert wurden. Denn schließlich machten nicht nur die Redner in der Volksversammlung, sondern auch die Philosophen in ihren Diskussionen von solchen Fähigkeiten Gebrauch. Die Umwertung gängiger Wahrheiten und Werte, die man ihnen zuweilen zuschrieb, schien erst dadurch überhaupt möglich.
Der bisher festgestellte Gegensatz zwischen den Philosophen und ihren Zeitgenossen ist auch in den Texten der Philosophen selbst zu greifen. Hanns-Dieter Voigtländer hat untersucht, welche Funktion diesem Gegensatz im philosophischen Denken zukam.14 Er kann zeigen, dass die schematische Abgrenzung gegenüber einer stilisierten unphilosophischen Menge (οἱ πολλοί) eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, das Wesen der Philosophie und des ‚wahren‘ Philosophen zu bestimmen und – oft mit protreptischer Absicht – nach außen hin darzustellen. Voigtländer sieht zwar, dass dieser literarisch stilisierte Gegensatz auf durchaus reale und wechselseitige Vorbehalte und Verständnisprobleme zwischen den Philosophen und ihren Zeitgenossen verweist.15 Doch ist der außerphilosophische Diskurs, auf den sich die philosophischen Texte in dieser Frage beziehen, nicht Gegenstand seiner Untersuchung. Auch bleiben – da es um den Blick der Philosophen auf die ‚Menge‘ und nicht die Außensicht auf die Philosophen geht – viele Themen der zeitgenössischen Philosophiekritik wie etwa die Asebie-Problematik unberücksichtigt.
Einen Überblick zur Stellung der Philosophen in der athenischen Gesellschaft und den gängigen Elementen der zeitgenössischen Philosophiekritik bietet Peter Scholz in seiner Monographie Der Philosoph und die Politik.16 Das Hauptaugenmerk seiner Arbeit gilt jedoch nicht der Außensicht auf die Philosophen, sondern der Frage, in welchem Verhältnis diese im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. zum politischen Leben standen. Dass viele Philosophen an einem aktiven Engagement in der Politik kein Interesse hatten und sich vornehmlich ihren Studien widmeten, charakterisiert er als wesentlichen Aspekt der Ausbildung einer spezifisch philosophischen Lebensform in jener Zeit.17 Die Philosophie galt ihnen als Wert an sich und das Leben des Philosophen als anzustrebende Lebensform, gegenüber der die vita activa der meisten Zeitgenossen zurückstand. Scholz zeigt dabei auch, dass durchaus ein Zusammenhang besteht zwischen der Entscheidung der Philosophen für eine vita contemplativa und dem Außenseitertum, das ihnen von außen immer wieder zugeschrieben wurde. Doch betrachtet er das Thema aus dem Blickwinkel des philosophischen Diskurses. Die vorliegende Arbeit widmet sich dagegen der anderen Seite des von Voigtländer und Scholz aufgezeigten Gegensatzes: der Außenwahrnehmung geistiger Bildung.
In ihrer 2003 erschienenen Habilitationsschrift hat sich Helga Scholten mit Blick auf die politischen wie geistesgeschichtlichen Entwicklungen des ausgehenden 5. Jahrhunderts die Frage gestellt: „Bedeuteten die neuen sophistischen Lehren eine Bedrohung für die Religion und Politik der Polis, und wie wurden sie von ihren Zeitgenossen wahrgenommen?“18 Dabei kommt sie zu dem eindeutigen Ergebnis: „Die Aussagen der Sophisten stellten nachweislich eine Bedrohung für die Religion und Politik der Polis dar.“19 In ihrer Untersuchung beschränkt sie sich allerdings vornehmlich auf die Analyse der sophistischen Schriften. Zu den „von den Sophisten ausgehenden Gefahren in der Wahrnehmung ihrer Zeitgenossen“ bietet sie einen kurzen Überblick, der drei Komödien des Aristophanes behandelt – verbunden mit der Feststellung, dass die „umfassende Thematik […] eine eigene Untersuchung“ rechtfertige, die „an dieser Stelle nicht geleistet werden“ könne.20
Wie auch in der vorliegenden Arbeit an mehreren Stellen zu zeigen sein wird, findet sich im Gedankengut der Sophisten sicher Einiges, was geeignet war, gängige religiöse u...