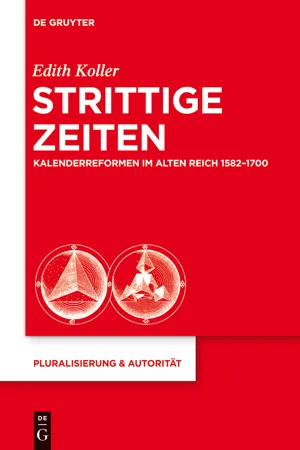![]()
1. Einleitung
Was auch in gemeinen bürgerlichen vnd politischen hendln / oder im weltlichen Regiment vnd haußstande für vngelegenheit / irrung vnnd schaden von dieser newen correction herrühret / ist nicht verborgen oder heimlich. Und es bekennen die Scribenten / das so offt von der zeitenderung disputieret vnd gezancket/vnd die Jahrordnungen turbieret wurden bey den Griechen so wol als bey den Römern vnd Deutschen / allezeit trawrige verenderungen / grosser schaden/vnd ein sonderlich vnglück in der welt erfolget sey.
So urteilt der Danziger Arzt, Mathematiker und Astrologe David Herlitz im Jahr 1605 über die Folgen der Gregorianischen Kalenderreform, die im Oktober 1582 die christliche Welt der Frühen Neuzeit in zwei Zeitzonen aufgespalten hatte. Papst Gregor XIII. hatte im Februar des Jahres „mandirt“, von Donnerstag dem 4. Oktober unverzüglich auf Freitag den 15. Oktober überzugehen. Während die katholischen Länder diese Reform im Laufe der nächsten beiden Jahre übernahmen, lehnten die Protestanten Europas sie überwiegend ab. Vom Disput, dem Zank und den „turbationes“, die diese umwälzende „zeitenderung“ im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation verursachte, nimmt die vorliegende Arbeit ihren Ausgang. Dabei werden insbesondere die Ebene der Wahrnehmung der Reform, wie sie uns etwa in Herlitz’ Worten entgegentritt, sowie der Aspekt der Überwindung der Zeitspaltung im Heiligen Römischen Reich eine wichtige Rolle spielen.
Weshalb kam es überhaupt zu einer Kalenderreform? Kurz zur Ausgangslage: Der christliche Kalender stellt eine Kombination aus solarem und lunarem Kalender dar und vereint zwei Funktionen. Erstens dient er der Datumszählung, d. h. der Zeitrechnung auf astronomischer Grundlage, zweitens–und dies war lange Zeit der bedeutendere Aspekt–der religiösen Festrechnung. Für die christliche Chronologie und Computistik war zur korrekten Berechnung der an Mond- und Sonnenlauf gebundenen kirchlichen Feiertage ein astronomisch möglichst genauer Kalender entscheidend. Basis des christlichen Solarkalenders ist der von Julius Cäsar im Jahr 46 v. Chr. reformierte römische Kalender. Da jedoch die tropische Jahreslänge in diesem „Julianischen“ Kalender um 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang angesetzt worden war, verlor sich im Laufe der Jahrhunderte die Synchronität zwischen kalendarischem und astronomischem Jahr, sie drifteten etwa alle 128 Jahr um einen Tag auseinander.
Trotz mancher Zweifel, wird die Festlegung der noch heute verbindlichen Regel zur Berechnung des Osterfestes gemeinhin auf das Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr. zurückgeführt. Die Regel besagt, die Auferstehung Christi solle am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn (d. h. nach Eintreffen des Frühlings-Äquinoktiums) gefeiert werden. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war der Julianische Kalender dem Sonnenjahr allerdings um zehn Tage enteilt. Die mittelalterliche Osterregel war vom 21. März als dem Datum der Frühlings-Tag-und Nachtgleiche ausgegangen, diese war jedoch im Jahr 1582 etwa am 11. März zu beobachten. Zudem war auch der der Osterberechnung zugrunde gelegte Mondzyklus nicht fehlerlos, so dass die exakte Berechnung und regelgemäße Feier des Osterfestes unmöglich geworden war. Man war sich des Problems zumindest seit dem 13. Jahrhundert bewusst. Mehrere Anläufe, den Kalender, und so die Berechnung der beweglichen Feiertage, wieder zurechtzurücken, waren jedoch gescheitert. Das Konzil von Trient erklärte daher eine Reform des Festkalenders zur drängenden Aufgabe, woraufhin seit den 1570er Jahren eine Kommission von Mathematikern, Astronomen und Theologen in Rom an einem exakten und praktikablen Kalender arbeitete.
Es ging also darum, sowohl den Sonnenkalender als auch den Mondkalender wieder ins Lot zu bringen und vor allem ein erneutes Anwachsen der Differenz künftig zu verhindern. Zur Korrektur des Sonnenkalenders rückte man zunächst das Frühlingsäquinoktium an den kalendarischen Ort, an dem es etwa zu Zeiten des Konzils von Nicäa beobachtet worden war: den 21. März. Um dies zu erreichen, wurden zehn Kalendertage gestrichen–die bekannteste Maßnahme der Gregorianischen Kalenderreform. Zur Fixierung dieses Kalenderstandes modifizierte man die julianische Schaltjahresregelung. Da durch die julianische Regelung auf lange Sicht zu viele Tage eingeschaltet worden waren, sollten künftig im Zeitraum von 400 Jahren drei Schaltjahre ausgelassen werden. Dies bedeutet, dass seither nicht mehr jedes vierte Jahr automatisch als Schaltjahr gilt: in den Hunderterjahren wird nur dann ein zusätzlicher Tag eingeschaltet, wenn diese durch 400 teilbar sind. Das Jahr 1600 war folglich ein Schaltjahr in beiden Kalenderstilen, wohingegen das Jahr 1700 zwar im Julianischen Kalender, nicht aber im Gregorianischen Kalender ein Schaltjahr war. Julianischer und Gregorianischer Kalender bewegen sich also weiterhin auseinander, inzwischen beträgt die Differenz 13 Tage. Zur Vorausberechnung des Ostertermins hatte sich schließlich der von Dionysius Exiguus im 6. Jahrhundert für seine Ostertafel angewandte alexandrinische 532jährige Zyklus, der sog. Große Osterzyklus, durchgesetzt, der den 28jährigen Sonnen- mit dem 19-jährigen Mondzyklus (dem Metonischen Zyklus) verband. Letzterer beruhte auf der Beobachtung, dass 19 Sonnenjahre etwa 235 synodischen Monaten entsprechen – alle 19 Jahre treffen die Mondphasen wiederum auf das gleiche Datum, das Mondalter kann somit tabellarisch, ohne Himmelsbeobachtung, bestimmt werden. Allerdings fußte der Zyklus auf einem etwas zu langen Mondjahr. Trotz der in den Tabellen regelmäßig eingeschobenen Schaltungen, die die gleichbleibende Position der Monate innerhalb der Sonnenjahre sichern sollte, summierte sich der Fehler im Mondzyklus etwa alle 310 Jahre zu einem überschüssigen Tag. Mit der Gregorianischen Kalenderreform wurde daher auch der Mondkalender um drei Tage angepasst. Zur anhaltenden Korrektur des Mondzyklus und zu dessen dauerhafter Synchronisation mit dem korrigierten Solarkalender wurde zudem eine neue Art der Epakten-Rechnung, d. h. Mondalter-Rechnung, eingeführt. Diese löste die in den Kalendarien das Mondalter anzeigende, im Mittelalter etablierte „Goldene Zahl“ ab. Der Kalender blieb damit weiterhin zyklisch organisiert – ein Aspekt der in der Diskussion um die Kalenderreform bis ins 18. Jahrhundert hinein eine große Rolle spielte. Diese, hier nur in ihren Umrissen sehr knapp skizzierte Kalenderreform war, auf Basis eines Vorschlages von Aloysius Lilius, von der erwähnten Kommission über mehrere Jahre hinweg ausgearbeitet worden. Am 24. Februar 1582 wurde die für Oktober 1582 geplante Kalenderverbesserung schließlich von Papst Gregor XIII. mit der Bulle Inter Gravissimas verkündet, eine ausführliche Darstellung der Reform wurde dabei nicht gegeben.
Die konfessionellen Spannungen verhinderten die europaweite Akzeptanz der Reform. Ab Oktober 1582 war das christliche Europa, ab 1583 auch das Alte Reich, folglich in zwei konfessionelle Zeitzonen aufgeteilt. Erst mit dem 1699 gefällten Entschluss der protestantischen Stände, im darauf folgenden Jahr ebenfalls eine Kalenderverbesserung vorzunehmen, wurde die bürgerliche Datumszählung im Heiligen Römischen Reich wieder vereint. Die Methode der Osterfestberechnung blieb weiterhin konfessionell verschieden, doch hatte dies nur zweimal, anlässlich der konfessionell getrennten Osterfeiern der Jahre 1724 und 1744, spürbare Konsequenzen. Ab dem Jahr 1776 schließlich wurde der Gregorianische Kalender im Reich allgemein beachtet – allerdings zunächst unter dem Namen Allgemeiner Reichskalender.
Bei historischen Recherchen begegnet die Kalenderspaltung in der Regel in Form der häufigen Doppeldatierung von Dokumenten der Jahre 1583 bis 1700 oder aber von Schwierigkeiten frühneuzeitliche Quellen zu datieren. Gerade etwa bei der Rekonstruktion der Kalenderreformverhandlungen auf Reichsebene zeigte sich dies auch anlässlich dieser Arbeit. Manchmal erfreut man sich dann an kleinen zufälligen Nebengeschichten: So wandte sich Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg im Jahr 1603 an Christian II. von Sachsen und bat um Auskunft, wie dieser sich in der am Reichstag aufgeworfenen Frage einer Kalendervereinigung zu verhalten gedenke. Philipp-Ludwig schrieb diesen Brief in Neuburg an der Donau am 20. Mai 1603. Den höflichen Gepflogenheiten der schriftlichen Kommunikation entsprechend, übersandte er zur Information zusätzlich eine Kopie des kaiserlichen Schreibens, mit dem dieser von Prag aus –ebenfalls am 20. Mai 1603– die Stände zur Kalendervereinigung angehalten hatte. Nur dass mit diesem ‘kaiserlichen 20. Mai’ ein Tag, zehn kalendarische Tage vor dem Neuburger Datum bezeichnet worden war –das kaiserliche Schreiben hatte bis zum ‘Neuburger 20. Mai’ bereits den Postweg von Prag nach Neuburg hinter sich gebracht, war vom Pfalzgraf und seinen Räten gelesen und vom Schreiber kopiert worden.
Den Zeitgenossen bereitete die Reform größere Schwierigkeiten, zumindest in der Phase der Durchsetzung und Implementation der Reform. Dabei kam es neben den bekannten großen Auseinandersetzungen um die Einführung bzw. Einhaltung des Gregorianischen Kalenders, wie etwa dem Augsburger Kalenderstreit, zu zahlreichen Unsicherheiten und Verwirrungen im Zuge der Kalenderumstellung. In Riga hatte man angeblich nicht beachtet, dass trotz des Überspringens von zehn Tagen die Wochentagszählung unverändert weiterlief und so feierte man dort, dies berichten Martin Chemnitz und David Herlitz, den ersten Sonntag des Gregorianischen Kalenders an einem Mittwoch. Im Jahr der Kalenderanpassung war es zudem umständlicher als gewohnt, die Dauer von Arbeitsverhältnissen oder den korrekten Lohn zu bestimmen. In der Diskussion um die Einführung des Gregorianischen Kalenders im Hochstift Eichstätt willigte das Domkapitel erst in die Reform ein, als man beschlossen hatte, auch den Verdienst für die „in dem neuen Calendario überhupften“ Tage zu gewähren. In Bozen überlegte man lange, ob der traditionelle Egidi-Markt auf ein neues Datum verlegt werden sollte. Es handelte sich hier um einen Herbstmarkt, auf dem Obst gehandelt wurde, dessen Reife gewährleistet sein musste und auch der erste Wein (Frühmost) bereits fertig zum Verkauf stehen sollte. Auch die Termine weiterer Märkte, wie des St. Andrä-Markt Ende November, standen zur Disposition. Man behielt beide Daten bei, verlegte also die Märkte faktisch um zehn Tage im Jahreslauf, allerdings verlängerte man den Egidi-Markt um einige Tage.
Doch auch bei der zweiten Kalenderreform im Reich, dem Wechsel der protestantischen Gebiete vom Julianischen zum Verbesserten Kalender im Jahr 1700, konnten Schwierigkeiten auftreten: Die Frankfurter Buchmesse sah sich nach der Kalenderumstellung dem Problem gegenüber, dass am neuen Termin nach dem Verbesserten Kalender die Hochwassergefahr des Mains um ein Vielfaches gestiegen war. Man verschob also die Messe um drei Wochen, woraufhin sie mit der Leipziger Buchmesse kollidierte–was wesentlich dazu beitrug, dass die Frankfurter Messe an Bedeutung verlor. Niederländische Matrosen weigerten sich Ende des 16. Jahrhunderts, einen Navigationsatlas zu benutzen, der die Positionsbestimmungen auf der Basis neuen Kalenders vornahm, und in einem Dorf in der Lausitz wechselte man in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angeblich jährlich den Kalenderstil, da die Kirche halb auf katholischem, halb auf protestantischem Grund und Boden lag. 118 Jahre lang war die öffentliche Zeitordnung im Heiligen Römischen Reich in zwei Zeitzonen aufgeteilt und die Bandbreite an Reaktionsmöglichkeiten auf diese zeitliche Pluralisierung war offensichtlich sehr groß.
Weder in der Erinnerungskultur noch der historischen Forschung ist die Kalenderreform allerdings besonders präsent. Des 400-jährigen Jubiläums der Gregorianischen Kalenderreform gedachte man zwar mit einer Sonderbriefmarke der Deutschen Post, einer Sonderausstellung der Badener Landesbibliothek und einem Festkolloquium des Vatikan. Sowohl Ausstellung als auch Kolloquium brachten teils wertvolle Forschungsbeiträge hervor, doch für lange Zeit blieb dies die einzig nennenswerte Beschäftigung mit dem Thema. Erst um das Jahr 2000 erwachte das Interesse an den Grundlagen der abendländischen Chronologie erneut. Die Zeit, Zeitordnungen, der Kalender– im täglichen Leben sind sie selbstverständliche und wenig hinterfragte, vermeintlich naturgegebene Konstanten. Nur zu besonderen Anlässen– den systemimmanenten ‘Stolperstellen’, wie der jedes halbe Jahr erfolgenden Zeitumstellung, einem Schaltjahr oder besonderen Jubiläen– wird das Menschengemachte der Ordnungen bewusst und reflektiert. Man erinnert sich des Systems also anlässlich seiner eigenen Wegmarken; das die Jahrtausendwende erst zur solchen erklärende kalendarische System und seine letzte große Veränderung, die Gregorianische Kalenderreform, erlangte damit zeitweilig verstärkte Aufmerksamkeit. Trotz dieses auch in der historischen Forschung kurzfristig aufgekeimten Interesses an den frühneuzeitlichen Kalenderreformen, und obwohl Forschungen zum Thema Zeit in all ihren Schattierungen, etwa zu Zeitempfinden, Zeitbewusstsein, Zeitkonzepten oder Zeitnutzung, insbesondere seit der kulturalistischen Wende Konjunktur haben und die einschlägigen Beiträge kaum noch zu überblicken sind, gibt es nach wie vor vergleichsweise wenige Studien zu den europäischen Kalenderreformen der Frühen Neuzeit und Neuzeit. Eine ausführliche Studie zur Gregorianischen Kalenderreform und ihrer Rezeption im Heiligen Römischen Reich fehlte bislang völlig. „Calendar Reform is an unlikely subject of research“. Diesem Befund Robert Pooles, des Spezialisten für die Kalenderreform in England, ist nach wie vor zuzustimmen.
In den Handbüchern und Überblicksdarstellungen zum 16. und 17. Jahrhundert wird die Kalenderreform zwar in der Regel erwähnt, doch es fehlt eine tiefergehende Diskussion oder Analyse der durch sie hervorgerufenen Debatten und Konfliktlinien, im besten Fall wird die problematische Rezeption der Reform immerhin kurz thematisiert. Aus der knappen Darstellung resultieren in diesen Werken oft Ungenauigkeiten und dem Thema nicht angemessene, pauschalisierende Wertungen. Vor allem jedoch blieb die zweite Kalenderreform, der von den evangelischen Ständen des Reichs im Jahr 1700 vollzogene Kalenderwechsel zum sogena...