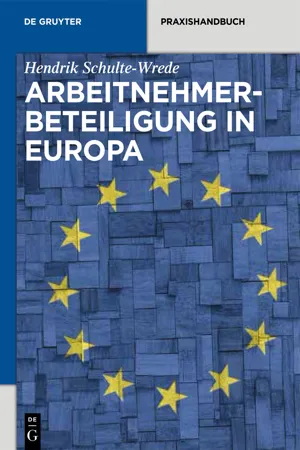
- 632 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Arbeitnehmerbeteiligung in Europa
Über dieses Buch
Die Materie der Arbeitnehmerbeteiligung, die sich von den arbeitsrechtlichen Aspekten der betrieblichen Mitbestimmung bis hin zu den wirtschafts- und gesellschaftsrechtlichen Gesichtspunkten der unternehmerischen Mitbestimmung in Kapitalgesellschaften erstreckt, ist innerhalb Europas ausgesprochen heterogen geregelt.
Hierzu bietet das Handbuch den ersten umfassenden vergleichenden Überblick am Markt. Nicht zuletzt durch seine starke praktische Ausrichtung stellt es daher vor allem für Unternehmen, die sich grenzüberschreitend betätigen, eine wertvolle Hilfe dar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Arbeitnehmerbeteiligung in Europa von Hendrik Schulte-Wrede im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Zivilrecht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil 1 – Einleitung
Das Buch bietet einen vergleichenden Überblick über die im privaten Sektor bestehende Rechtslage zur Arbeitnehmerbeteiligung in Europa, fokussiert auf die Beteiligung auf betrieblicher Ebene sowie auf die unternehmerische Mitbestimmung.
Die Ausführungen sind nach Ländern geordnet. Die einzelnen Länderberichte enthalten zunächst einige Hintergrundinformationen zu den jeweiligen industriellen Beziehungen und eine knappe Erläuterung der kapitalgesellschaftsrechtlichen Kernfaktoren. Danach werden die Beteiligungsstrukturen beschrieben.
Dargestellt werden die grundlegenden Strukturen anhand der jeweiligen normativen Vorgaben sowie deren unmittelbare Wirkungen. Dies dient dem ersten Einstieg in die jeweilige Rechtsordnung und soll die Voraussetzung für weitere eigene Recherchen schaffen, ohne den Text gleichzeitig allzu sehr ausufern zu lassen. Hierzu finden sich neben verschiedenen Literaturhinweisen vor allem Internetlinks, die einen schnellen eigenen Zugriff auf die aktuellen Informationen ermöglichen.
Querschnittserläuterungen zu den insoweit relevantesten jüngeren Richtlinien und den supranationalen Kapitalgesellschaften SE und SPE sowie einige zusammenfassende Tabellen runden die Beschreibungen ab.
Teil 2 – Begrifflichkeiten
A. Arbeitnehmerbeteiligung – Ausprägungen
I. Grundsätzlich
Unter dem Begriff „Arbeitnehmerbeteiligung“ versteht man allgemein die kollektive Interessenwahrnehmung der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber.
Dahinter steht der Ansatz, dass wegen der „strukturellen Unterlegenheit“ des einzelnen Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber zu dessen wirksamer Interessenvertretung ein kollektiver Mechanismus notwendig ist.1
Die Arbeitnehmerbeteiligung kann grundsätzlich vor allem auf zwei Ebenen stattfinden.
Erste Ebene ist der Betrieb als Stätte zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke (Produktion, Vertrieb, Verwaltung, Dienstleistungen). Zweite Ebene ist das Unternehmen als rechtsfähige organisatorische Einheit zur Verfolgung wirtschaftlicher oder ideeller Ziele (Planung, Leitung, Strategie). Diese Aufteilung wird auch auf europäischer Ebene anerkannt2 und ist u.a. im Rahmen der SE-RL übernommen worden.3
Bisweilen wird zudem auch noch von einer „Dritten Ebene des Zusammenwirkens von Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ gesprochen. Gemeint ist damit die Tarifautonomie. Diese beschreibt das Recht der Sozialpartner, unabhängig von einer staatlichen Beeinflussung die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen über Tarifverträge zu regeln. Tarifverträge gelten grundsätzlich nur zwischen den jeweiligen Vertragsparteien und behandeln grundsätzlich solche Fragen, die das Arbeitsverhältnis und die Organisation der Arbeit im jeweiligen Betrieb betreffen. Sie geben also gewisse Rahmendaten vor und beeinflussen die unternehmerische Entscheidung lediglich mittelbar. Betriebliche Beteiligung und Unternehmensmitbestimmung hingegen wirken unmittelbar und allgemein für alle Arbeitnehmer, d.h. vor allem auch ohne Rücksicht auf eine etwaige Gewerkschaftszugehörigkeit.4 Diese Mitwirkungsform bleibt im Rahmen dieser Darstellung grundsätzlich ebenso außer Betracht wie finanzielle Beteiligungsformen der Arbeitnehmer und der Bereich des Arbeitsschutzes.
II. Betriebliche Beteiligung
Die Beteiligung auf betrieblicher Ebene zielt auf die Teilhabe der Arbeitnehmer an den personellen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, die ihrerseits erst aus konkreten unternehmerischen Leitungs- und Organisationsentscheidungen folgen. Es geht grundsätzlich also um die Arbeitsbedingungen. Hierzu bestehen vor allem Unterrichtungs- und Anhörungsrechte, bisweilen bestehen daneben auch Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte.
„Unterrichtung“ bedeutet, dass die Unternehmensleitung die Arbeitnehmer bzw. deren Vertretungen vor der Durchführung bestimmter Maßnahmen informiert. Dies muss nach Zeitpunkt, Form und Inhalt so geschehen, dass der Arbeitnehmerseite die eingehende Prüfung der möglichen Auswirkungen der beabsichtigten Maßnahme und gegebenenfalls die Vorbereitung von Anhörungen mit der Unternehmensleitung möglich bleibt.5 Die Unterrichtung ist meist die Vorstufe für weiter reichende Beteiligungsrechte.
Die „Anhörung“ bezieht sich auf die Errichtung eines mehr oder minder ständigen Dialogs und Meinungsaustauschs zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite, der es den Arbeitnehmervertretern auf der Grundlage der erhaltenen Informationen ermöglicht, eine eigene Stellungnahme zu den geplanten Maßnahmen abzugeben, die dann im Rahmen des Entscheidungsprozesses durch die Arbeitgeberseite berücksichtigt werden kann.6
Im Rahmen der „Mitwirkung“ geht es um Beratung und Mitsprache bei der Entscheidung des Arbeitgebers im Sinne einer gemeinsamen Erörterung. Hängt die Entscheidung in ihrer Wirksamkeit von einer Zustimmung der Arbeitnehmerseite ab, wird allgemein von „Mitbestimmung“ gesprochen. Die Mitbestimmungsrechte sind in ihrer Intensität abgestuft, je nachdem, ob sie ein Initiativ- und Zustimmungs-recht, nur ein Zustimmungsrecht oder ein Zustimmungsverweigerungsrecht im Sinne eines „Vetos“ gewähren. Die genauen Übergänge sind oft fließend.7
Inhaltlich geht es bei der Beteiligung auf betrieblicher Ebene vor allen Dingen um solche Aspekte, die die Arbeitnehmer an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz unmittelbar betreffen. Die Vertretungsgremien gleichen dabei auch die unterschiedlichen Interessen unter den jeweiligen Arbeitnehmern, bzw. unter den verschiedenen Betriebsteilen, aus und sichern ggf. ein regelkonformes Verhalten (compliance).8
III. Unternehmerische Mitbestimmung
Die Mitbestimmung auf Unternehmensebene betrifft die unmittelbare Einflussnahme der Arbeitnehmerseite auf alle zentralen Planungs-, Leitungs- und Organisationsentscheidungen der Gesellschaft. Sie beruht auf dem Recht, einen Teil der Mitglieder des gesellschaftlichen Aufsichts- oder Verwaltungsorgans zu wählen oder zu bestellen, bzw. eine entsprechende Wahl oder Bestellung zu empfehlen oder abzulehnen.9
Es geht hier also um Einwirkung auf solche Entscheidungen, die die unternehmerische Substanz betreffen, kurz um die Unternehmenspolitik. Hier sollen die Interessen der Arbeitnehmer insgesamt berücksichtigt und soziale Belange möglichst frühzeitig einbezogen werden. Das gilt also insbesondere auch losgelöst von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Interessengruppe wie z.B. einer Gewerkschaft.
Umgesetzt wird die Mitbestimmung letztlich durch ein Stimmrecht im Gesell-schaftsorgan, durch Zustimmungsvorbehalte bei bestimmten Angelegenheiten oder Initiativrechte als erzwingbare Regelungen durch Dritte. Grundsätzlich bedeutet sie, dass bestimmte unternehmerische Maßnahmen nur dann durchgeführt werden können, wenn die Arbeitnehmerseite tatsächlich zustimmt. In diesem Sinne bildet die Mitbestimmung einen Teilaspekt der industriellen Beziehungen und damit auch der Corporate Governance als dem „Verhältnis zwischen der Führung eines Unter-nehmens, seinem Verwaltungsrat, Aktionären und anderen Interessengruppen“.10
Während betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung rein rechtlich selbständig nebeneinander stehen, ergänzen sie sich funktional. Praktisch sind sie oft auf verschiedene Weise miteinander verwoben. Nicht selten besteht eine personelle Identität zwischen den Arbeitnehmervertretern auf betrieblicher und auf unternehmerischer Ebene. Zudem müssen die Arbeitnehmervertreter im Bereich der Mitbestimmung meist die Vertretungen auf betrieblicher Ebene über ihre Arbeit informieren. Bisweilen können sie daneben auch von diesen Gremien bestellt und begründungslos wieder abberufen werden, etc.11
IV. Arbeitnehmerbegriff
Für diese beiden Beteiligungsformen bestehen also mittlerweile unionsweit autonome Begriffsbestimmungen. Das gilt allerdings (zumindest derzeit noch) nicht für eine entsprechende Definition des „Arbeitnehmers“ selbst, sofern das für die Beteiligungsrechte relevant wird.
In vielen Bestimmungen des primären und sekundären Unionsrechts wird der Begriff in unterschiedlichem Sinne verwendet.12 Um gleichwohl einen einheitlichen Geltungsbereich des Unionsrechts zu gewährleisten, kann aber nicht auf die Begriffsbildung in den Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden, da diese sonst darin frei wären, über entsprechende nationale Definitionen auch den entsprechenden unionsrechtlichen Schutz auszudehnen oder zu beschneiden. Für den primärrechtlichen Arbeitnehmerbegriff ist daher eine unionsrechtlich autonome Begriffsauslegung geboten, die in den unterschiedlichen Rechtsakten auch verschiedene Bedeutung entfalten kann.13
Auf sekundärrechtlicher Ebene, insbesondere in den verschiedenen Richtlinien, wird hingegen durchaus auf die Definition des nationalen Rechts zurück verwiesen.14 Die Union bestimmt den Begriff in diesem Zusammenhang also nicht selbst, sondern setzt ihn voraus. Vor allem, soweit es die rein nationalen Gestaltungen angeht, ist die Konkretisierung den Mitgliedstaaten überlassen.
Die Mitgliedstaaten entscheiden somit z.B. auch über die Einbeziehung von Auszubildenden oder Teilzeitbeschäftigten in „ihren“ jeweiligen beteiligungsrelevanten Arbeitnehmerbegriff. Die unterschiedlich weit reichende Einbeziehung kann dann wiederum auf die Berechnung von Schwellen-werten und letztlich auf die Etablierung bestimmter Arbeitnehmervertretungsgremien durchschlagen.
B. Organisationsverfassung der Kapitalgesellschaften
Die konkrete Umsetzung und Wirkung jeder Arbeitnehmerbeteiligung hängt davon ab, wie das betroffene Unternehmen institutionell ausgestaltet wird, da sich je nachdem auch für die Mitbestimmung unterschiedliche Ansatzpunkte, und letztlich auch unterschiedliche Wirkungsreichweiten, ergeben können. In den Mitgliedstaaten bestehen für die Organisation der Leitungsstruktur von Kapitalgesellschaften, vereinfacht,15 zwei Möglichkeiten, das monistische und das dualistische Modell.
Beim monistischen Modell (one-tier-system) ist die Geschäftsleitung institutionell nicht von der Überwachung der Geschäfte getrennt. Beide Funktionen werden von einem einzigen Organ wahrgenommen, dem Verwaltungsrat (board of directors). Namentlich in größeren Gesellschaften, wo die Verwaltungsräte personell stärker besetzt sind, wird er noch aufgeteilt in operativ geschäftsführende Mitglie-der (executive directors) und eher beratende bzw. überwachende nicht-geschäftsführende Mitglieder (non-executive directors).16 Für die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder ist auch die Bezeichnung Chief Officer gebräuchlich, teilweise unter Hinzufügung ihrer jeweiligen Funktionsbezeichnung.
Im dualistischen Modell (two-tier-system) werden Geschäftsführung und Kont-rolle von separaten Organen ausgeübt. Das Kontrollorgan bestellt die Mitglieder des Leitungsorgans und beruft sie auch ab. Zudem überwacht es die Führung der Geschäfte durch das Leitungsorgan. Es ist aber seinerseits nicht berechtigt, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen.
Traditionell herrscht in den Mitgliedstaaten jeweils eine dieser Varianten vor. Im angelsächsischen Rechtskreis ist das monistische Modell besonders verbreitet, während sich in Zentraleuropa vornehmlich das dualistische Modell findet. Im nordischen Rechtskreis existieren Mischformen, die in der Literatur gelegentlich als one-and-a-half-tier-System bezeichnet werden.17
Mit Einführung der SE begann die ursprünglich scharfe Trennung zu verwischen, da die SE wahlweise18 über „entweder ein Aufsichtsorgan und ein Leitungsorgan (dualistisches System) oder ein Verwaltungsorgan, das die Aufgaben von Unter-nehmensleitung und -kontrolle in sich vereint (monistisches System)“ verfügt.
Die hier vorgesehene Wahlfreiheit bedeutete unter den Gesichtspunkten des effet utile und des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts, dass nunmehr alle Mitgliedstaaten unabhängig von ihren jeweiligen Traditionen zumindest für die SE beide Strukturvarianten zu Verfügung stellen mussten. Manche Mitgliedstaaten haben diesen Anstoß aufgenommen und auch für einige oder alle ihrer nationalen Kapitalgesellschaften entsprechende Wahlmöglichkeiten eröffnet. Konsequent spricht sich nun auch die Reflexionsgruppe zur Zukunft des EU-Gesellschaftsrechts dafür aus, die Wahlmöglichkeit durchgängig in allen Mitgliedstaaten zu etablieren.19
Demgegenüber erkennt die Kommission die Koexistenz beider Strukturvarianten an und will diese weder in Frage stellen, no...
Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Impressum
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Teil 1 – Einleitung
- Teil 2 – Begrifflichkeiten
- Teil 3 – Allgemeine Übersicht
- Teil 4 – Länderdarstellungen nach Rechtskreisen
- Teil 5 – Arbeitnehmerbeteiligung in ausgesuchten