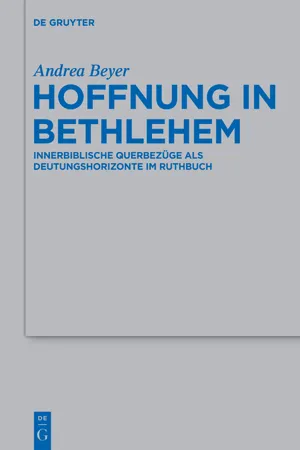1.2.1 Julia Kristevas Konzept der „Intertextualität“
Den Begriff „Intertextualität“ prägte Julia Kristeva 1967 in ihrem Aufsatz „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“. Ihr Aufsatz ist, quasi als „Genotext“, Referenzpunkt der seitdem erfolgten Weiterentwicklungen. Sie greift Gedanken des russischen Literaturwissenschaftlers Michail Bachtin auf, dem es aus ihrer Sicht darum geht, dass die literarische Struktur eines Textes „nicht ist, sondern sich erst aus der Beziehung zu einer anderen Struktur herstellt.“ Ein Text ist damit nie für sich allein; diese „Dynamisierung des Strukturalismus“ setzt voraus und macht deutlich, dass Texte grundsätzlich dialogisch sind. In Kristevas Worten, dass „das ‚literarische Wort‘ nicht ein Punkt (nicht ein feststehender Sinn) ist, sondern eine Überlagerung von Text-Ebenen, ein Dialog verschiedener Schreibweisen: der des Schriftstellers, der des Adressaten […], der des gegenwärtigen oder vorangegangenen Kontextes.“
Wichtig ist dabei, dass Kristeva unter Berufung auf Bachtin einen weiten Textbegriff formuliert: Auch „die Geschichte und die Gesellschaft“ sind Texte, „die der Schriftsteller liest, in die er sich einfügt, wenn er schreibt.“ Diese Gleichsetzung ist insofern plausibel, als die Bedeutung eines Wortes oder Textes von ihnen allen abhängt: Der Text steht im „Schnittpunkt von Sprache“ (verstanden als „real[e] Praxis des Denkens“) und den zwei Achsen des „Raum[es]“, die Autor/ Subjekt und Adressat einerseits und Text und Kontext andererseits bilden, und die im Text zusammenfallen. So ist „das Wort (der Text) […] Überschneidung von Wörtern (von Texten), in der sich zumindest ein anderes Wort (ein anderer Text) lesen läßt.“ Diese Dialogizität der Texte, die schon der Sprache an sich inhärent ist, da sie letztlich immer mit schon gebrauchten Worten arbeitet und so schon weitere Bedeutungsgehalte in sich trägt, bezeichnet Kristeva als „Intertextualität“: „[J]eder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf, jeder Text ist Absorption und Transformation eines anderen Textes. An die Stelle des Begriffs der Intersubjektivität tritt der Begriff der Intertextualität, und die poetische Sprache läßt sich zumindest als eine doppelte lesen.“ Die Betonung der Verbundenheit der Texte untereinander löst sie zugleich von ihrer historischen Situierung und reduziert die Rolle, die der Autor spielen könnte: Die Barthes’sche Rede vom „Tod des Autors“ ist in Julia Kristevas Aufsatz schon angelegt.
Wohl mit Bedacht schreibt Kristeva schon hier nur von der „poetischen Sprache“. Obwohl eigentlich eine grundlegende Eigenschaft von Sprache, Wort und Text, „veräußerlicht sich dieser Dialog, diese Inbesitznahme des Zeichens als eines Doppelten, diese Ambivalenz der Schreibweise erst durch bestimmte Strukturen der Erzählung in der Organisation des (poetischen) Diskurses, auf der Ebene der Erscheinung des (literarischen) Textes.“ Diese Strukturen liegen im „dialogischen Diskurs: 1) des Karnevals, 2) der Menippea, 3) des polyphonen Romans“ vor. Dessen Gegensatz bildet der „monologische Diskurs, der sich zusammensetzt aus: 1) dem darstellenden Modus der Beschreibung und der (epischen) Erzählung; 2) dem historischen Diskurs; 3) dem wissenschaftlichen Diskurs“. Bei diesen Diskursen wird der grundsätzlich „jeglichem Diskurs immanente Dialog durch ein Verbot erstickt, durch eine Zensur“ – zum Beispiel „durch den absoluten Standpunkt des Erzählers“.
Bereits diese Sortierung von Gattungen macht es höchst unwahrscheinlich, dass Kristevas Modell auf biblische Texte im Allgemeinen und das Buch Ruth im Besonderen übertragbar ist. Sie selbst benennt als Ausgangspunkt dialogischer Diskurse den Sokratischen Dialog und die Menippea als älteste satirische Gattung. Ruth als Erzählung und Novelle dürfte aus ihrer Perspektive zu den monologischen Texten gehören. Schon daraus ergibt sich die Frage, ob für Ruth von Intertextualität im Sinne Kristevas die Rede sein kann.
Des Weiteren „macht Kristeva zunächst eher eine sprachphilosophische oder psychologische Grundaussage, als dass sie ein literaturwissenschaftliches Instrument zur Verfügung stellt.“ Ihre Überlegungen geschehen dabei in einem poststrukturalistischen Rahmen und aus der Perspektive einer Psychoanalytikerin. Diese Weltsicht lässt sich ebenso wenig einfach von ihrem sonstigen Modell subtrahieren wie der damit zusammenhängende weite Textbegriff, den sie voraussetzt. Beide sind grundlegende Bestandteile ihres Konzeptes. Ein Text- und Intertextualitätsbegriff, der jedoch nur annähernd die Weite dessen von Julia Kristeva hat, ist methodisch weder handhabbar noch im Sinne der Nachvollziehbarkeit kontrollierbar – der Mangel an ihrerseits bereitgestelltem literaturwissenschaftlichem Instrumentarium mag schon darin begründet sein. Die Bedeutungsverschiebungen (nicht nur in der anwendungsorientierten Rezeption) sind daher kaum Zufall.
Da Worte tatsächlich ein Eigenleben haben, wurde „Intertextualität“ schnell zu einem Modewort unterschiedlichster inhaltlicher Füllungen – was allenthalben konstatiert und oft beklagt wird. Dabei spielt der philosophische Referenzrahmen Kristevas in der Rezeption für gewöhnlich keine Rolle. Kristeva selbst benannte ihr Konzept schon sieben Jahre später in „Transposition“ um und kritisierte in diesem Zusammenhang die Verwendung des Begriffs in der Literaturwissenschaft und ihr benachbarten Disziplinen, wie sie sich bis heute findet: „Der Terminus Intertextualiät bezeichnet eine […] Transposition eines Zeichensystems (oder mehrerer) in ein anderes; doch wurde der Terminus häufig in dem banalen Sinne von ‚Quellenkritik‘ verstanden, weswegen wir ihm den der Transposition vorziehen; er hat den Vorteil, daß er die Dringlichkeit einer Neuartikulation des Thetischen beim Übergang von einem Zeichensystem zu einem anderen unterstreicht.“
Die frühesten literaturwissenschaftlichen Entwürfe zur Anwendung des Kristevaschen Konzeptes dürften ...