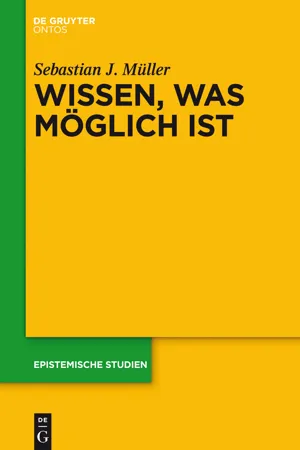![]()
1 Einleitung
Das Reden über Möglichkeiten und Notwendigkeiten ist in unserem Alltag ebenso wie im wissenschaftlichen Diskurs weit verbreitet. Wir alle sagen häufig Dinge wie „Du hättest auch früher kommen können“, „Das musste er tun“, „Niemand kann 100 Meter in unter 8 Sekunden laufen“, „Es ist nicht möglich, schneller zu sein als das Licht“ usw. Das Treffen solcher Aussagen ist fester Bestandteil unseres sprachlichen Handelns, und in aller Regel tun wir dies, ohne uns großartige Gedanken darüber zu machen, was Ausdrücke wie „hätte“, „musste“, „kann“ oder „möglich“ genau heißen – wir verstehen solche Aussagen normalerweise problemlos, ohne dass wir dies im Detail bestimmt hätten. Wir verfügen auch über keine detaillierte Theorie darüber, was solche Aussagen wahr oder falsch macht und woher wir eigentlich wissen, ob sie wahr oder falsch sind.
Was die vier Aussagen gemeinsam haben ist, dass sie allesamt nicht nur Behauptungen darüber sind, wie die Welt ist, sondern auch darüber, wie sie hätte sein können, und wo die Grenzen dieser potenziellen Andersartigkeit liegen. Ihre Semantik, Metaphysik und Erkenntnistheorie werfen im Alltag normalerweise keine besonderen Schwierigkeiten auf. Wenn wir sie jedoch näher betrachten, wird schnell klar, dass sich hinsichtlich all dieser Aspekte schwierige philosophische Fragen stellen. Was macht solche Aussagen wahr? Die tatsächliche Beschaffenheit der Welt scheint, zumindest auf den ersten Blick, nicht festzulegen, auf welche andere Art sie hätte sein können. Woher wissen wir, ob solche Aussagen wahr oder falsch sind? Wir können beispielsweise, zumindest bisher, nicht beobachten, ob es für einen Menschen möglich ist, 100 Meter in weniger als 8 Sekunden zu laufen. Noch hat es niemand geschafft, so schnell zu sein, aber über die Frage, ob sich dies je ändern wird, sind sich selbst die Experten uneins.
Ich werde mich in der vorliegenden Arbeit auf dieses Thema konzentrieren. Ich gehe der Frage nach, wie wir Wissen darüber erwerben können, was möglich und notwendig ist. Meine Arbeit behandelt also die Erkenntnistheorie des Modalen. Dabei werde ich mich jedoch auf Wissen über eine bestimmte Art von Modalität konzentrieren.
1.1 Arten von Modalität
Wenn wir die vier Beispiele vom Anfang nochmals betrachten, fällt auf, dass in ihnen Aussagen über ganz verschiedene Arten von Möglichkeit und Notwendigkeit gemacht werden. Nehmen wir nur die letzten beiden, „Niemand kann 100 Meter in unter 8 Sekunden laufen“ und „Es ist nicht möglich, schneller zu sein als das Licht“. Letztere Aussage sagt etwas über nomologische Modalität aus, also darüber, was angesichts der geltenden Naturgesetze möglich ist. Erstere Aussage baut hingegen viel mehr Einschränkungen ein. Sie ist eine Aussage, die wir im Kontext eines 100-Meter-Laufs hören könnten, und sie ist normalerweise so gemeint, dass sie nur für Menschen gelten soll, und auch so, dass sie nur auf der Erde als wahr beansprucht wird, nicht aber an beliebigen Orten mit verschieden hoher Schwerkraft. Es geht hierbei also um eine sehr viel spezifischere Modalität. Andere Aussagen sind noch spezifischer: „Es war für die Griechen unmöglich, die Mauern Trojas zu Fall zu bringen“. Diese Aussage bezieht sich auf eine spezifische, historische Situation. Die Stärke der griechischen Armee, die Schwäche ihrer Geschütze, die damals noch kaum entwickelte Belagerungstechnik etc. sind allesamt Faktoren, die festgehalten werden müssen. Natürlich hätten die Griechen Trojas Mauern zu Fall bringen können, wenn sie über eine moderne Artillerie verfügt hätten. Im Kontext eines historischen Werkes über den trojanischen Krieg ist uns jedoch klar, dass historische Tatsachen nicht ignoriert werden sollen. Dies funktioniert auch andersherum. Wenn ein Historiker schreibt „Es wäre für die Osmanen 1529 möglich gewesen, Wien zu erobern“, dann meint er damit natürlich, dass es unter weitgehend gleichen äußeren Bedingungen, bei Zuhilfenahme einer besseren Strategie, oder mit Glück im richtigen Moment, möglich gewesen wäre, und nicht, dass die Osmanen unter Zuhilfenahme von Kampfflugzeugen möglicherweise erfolgreich gewesen wären. Modale Aussagen sind also meist beschränkt. Wir halten eine Vielzahl von Elementen stabil, und fragen uns, ob unter diesen Bedingungen eine Veränderung möglich gewesen wäre.
1.2 Modalität schlechthin
All diese Arten von Modalität sind nicht grundlegend. Sie betreffen das, was unter bestimmten Bedingungen möglich gewesen wäre. Die Art von Modalität, um dies es mir in dieser Untersuchung gehen wird, ist deutlich verschieden hiervon. Sie ist die grundlegende Art von Modalität- die Art und Weise, wie die Dinge hätten sein können, wenn alles sich ändern könnte, was sich eben ändern kann (vgl. Burgess 2009, 46). Man könnte sie, neutral, als „unbedingte Modalität„ bezeichnen. Aus Gründen, die im Verlauf dieser Arbeit klar werden, wird diese grundlegende Art und Weise, wie die Welt hätte sein können, in der gegenwärtigen Debatte jedoch meist als „metaphysische Modalität„ bezeichnet.
Es gibt mehrere große Debatten um metaphysische Modalität. Wie genau ist sie beschaffen? Was ist metaphysisch möglich, und was ist metaphysisch notwendig? Was ist die Logik, die charakteristisch für metaphysische Modalität ist? Was ist die Quelle metaphysischer Modalität? Wie hängen modale Eigenschaften und mögliche Welten miteinander zusammen? Diese Fragen betreffen die Logik und die Ontologie metaphysischer Modalität. Das zentrale Thema dieser Arbeit wird ein anderes sein, nämlich die Frage danach, woher wir eigentlich wissen können, was metaphysisch möglich und notwendig ist. Allerdings wird dies auch die Motivation dazu liefern, am Ende der Arbeit einige Schlüsse für die Ontologie metaphysischer Modalität zu ziehen.
1.3 Wissen über Modalität schlechthin
Die Frage danach, wie wir eigentlich Wissen über metaphysische Modalität erwerben können, hat sich, nachdem sie anfänglich, bis in die Mitte der neunziger Jahre, eher wenig beachtet wurde, eine ausufernde Diskussion ausgelöst. Zunächst haben sich Kripke (1980), Yablo (1993) und andere darauf konzentriert, wie wir damit umgehen können, dass es notwendige Wahrheiten gibt, die nicht a priori wissbar sind. Doch dann wurde deutlich, dass es ein noch basaleres Problem gibt, nämlich die Frage, wie wir die Verbindung zwischen dem Bereich des Tatsächlichen oder Begrifflichen und dem Bereich des metaphysisch Modalen grundlegend erschließen können. Woher wissen wir, ob etwas, was wir empirisch beobachtet haben, metaphysisch notwendig ist? Wie können wir auf der anderen Seite wissen oder ausschließen, dass etwas, von dem wir nicht wissen, ob es der Fall ist, oder von dem wir sogar wissen, dass es nicht der Fall ist, unmöglich ist? Das klassische Mittel, Möglichkeit und Notwendigkeit an begrifflicher Konsistenz und Inkonsistenz festzumachen, versagt in den Fällen, die Philosophen für die interessantesten halten und die in der philosophischen Diskussion die größte Rolle gespielt haben. Welches Mittel steht uns dann zur Verfügung?
Der Großteil meiner Arbeit wird sich Versuchen widmen, zu zeigen, wie wir Wissen über metaphysische Modalität haben können. Dabei werde ich mich nur mit explizit modalem Wissen befassen. Es genügt hierfür nicht, dass ein Subjekt S weiß, dass p, und es notwendig ist, dass p, sondern S muss auch wissen, dass es notwendig ist, dass p.
Hier ist der Eindeutigkeit halber ein weiterer Kommentar angebracht. Die Ausdrücke „modales Wissen“, „Modalepistemologie“ usw. werden von manchen Philosophen anders genutzt, als ich es hier tue (vgl. Freitag 2013). So gibt es modale Theorien des Wissens im Allgemeinen. Wenn ich diese Ausdrücke benutze, dann beziehe ich mich damit immer auf Wissen über das Modale oder die Epistemologie des Modalen.
1.4 Was ich tun werde
Die Arbeit wird aus einem großen kritischen Teil und einem kürzeren Teil bestehen, der zur Verteidigung eines bestimmten Ansatzes dient, der sich an Chalmers’ Epistemischen Zweidimensionalismus anlehnt. Daneben werde ich mich mit dem Verhältnis von Modalität und Materialismus befassen, da dieses häufig erhellend für modalepistemologische Fragen sein kann.
1.4.1 Der kritische Teil
Nach einem einleitenden Kapitel, in dem ich die philosophische Debattenlage zu metaphysischer Modalität, dem Zusammenhang von Aktualität und Modalität und dem von Semantik und Modalität knapp darstelle, werde ich mich in drei großen Kapiteln mit den zentralen modalepistemologischen Ansätzen befassen, und zwar mit Modalem Rationalismus (Kapitel 2), Modalem Empirismus (Kapitel 3) und Begrifflichem Rationalismus (Kapitel 4).
Modale Rationalisten versuchen zu zeigen, wie wir a priori, aber nicht mithilfe von Begriffsanalysen, modales Wissen erhalten. Die meisten von ihnen setzen hierbei auf Vorstellbarkeit (Kapitel 2, Teil 1). Andere glauben, dass wir in der Lage sind, Einsicht in die Essenzen oder die wesentlichen Eigenschaften von Dingen zu erhalten (Kapitel 2, Teil 2).
Modale Empiristen setzen auf empirische Methoden, wie sie auch in den Wissenschaften vorkommen, zum Beispiel auf abduktive Schlüsse (Kapitel 3, Teil 1), auf Wissen über kontrafaktische Konditionale (Kapitel 3, Teil 2) oder auf eine Analogie zwischen Vorstellen und Wahrnehmen (Kapitel 3, Teil 3). Sie versuchen zu zeigen, dass diese Methoden uns auch den Erwerb von metaphysisch modalem Wissen ermöglichen.
Begriffliche Rationalisten schließlich machen unser Verstehen von Ausdrücken zur Grundlage von Wissen darüber, was metaphysisch möglich und notwendig ist, wobei sie behaupten, dass begriffliche Kompetenz uns in die Lage versetzt, synthetische Wahrheiten zu kennen (Kapitel 4, Teil 2-4). Vor der Auseinandersetzung mit diesem Ansatz werde ich die zum Verständnis nötigen sprachphilosophischen Grundlagen liefern (Kapitel 4, Teil 1).
Ich werde zeigen, dass diese Ansätze allesamt nicht haltbar sind sind, da sie entweder nicht zeigen können, dass wir ein verlässliches Vermögen haben, um Wissen über metaphysisch modale Wahrheiten zu erwerben – dies trifft primär auf die Modalen Rationalisten, wie Kripke, Yablo, Lowe und Vaidya, zu – oder weil sie bereits ebenso schwieriges Wissen voraussetzen, ohne zu zeigen, wie wir dieses erwerben können. Dieser Kritikpunkt betrifft die beiden wichtigsten Vertreter des Begrifflichen Rationalismus, Bealer und Peacocke, sowie den Modalen Empiristen Williamson.
Nach einem Zwischenfazit werde ich in Kapitel 5 einerseits die zweidimensionalistische Theorie metaphysisch modalen Wissens verteidigen, die von David Chalmers entwickelt wurde. Diese beruht auf einer Neubestimmung davon, wie die grundlegende Art von Modalität beschaffen ist, und ermöglicht so einerseits den epistemischen Zugang, löst aber auch ontologische Probleme. Andererseits werde ich jedoch deutlich machen, dass zwar die Metaphysik und die Erkenntnistheorie des Modalen im zweidimensionalistischen Bild akzeptabel sind, dass aber die Konsequenzen für den Zusammenhang von Tatsachenontologie und Modalität bisher weder von den Vertretern des Zweidimensionalismus noch von seinen Gegner radikal genug durchdacht wurden. Die Akzeptanz dieses Bildes – die ich empfehlen werde – führt teilweise wieder zurück zum Vorkripkeanischen Bild von Modalität, sowohl hinsichtlich deren Beschaffenheit – logisch-begriffliche Modalität wird zu der grundlegenden Art von Modalität – als auch hinsichtlich des Verhältnisses von Tatsachen und Modalität. D...