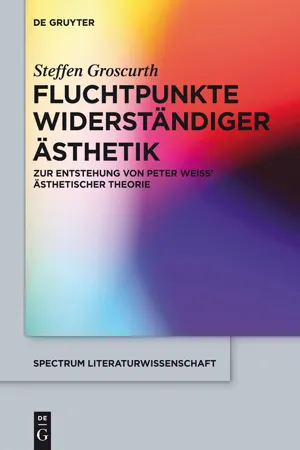1.1 Gefährdete Subjektivität: die Motivik der Bedrohung
eine Totalität zog sich um uns zusammen,
der militärische Apparat, nicht überblickbar,
doch jeden unsrer Schritte bestimmend –
Peter Weiss, Notizbücher 1971-1980
Die Ästhetik des Widerstands, von Weiss selbst als „meine Hauptarbeit“ eingeschätzt, steht als die reifste Form einer sich selbst bespiegelnden Poetik wider das Vergessen und wider die Unterdrückung in der Entwicklung des Künstlers Peter Weiss als Kulminationspunkt im Rahmen des Projekts einer Ästhetik, die sich zwischen den Polen des Engagements einer- und künstlerischer Autonomie andererseits auf eine der zentralen Fragestellungen der literarischen Moderne bezieht. Die von Alfons Söllner nachgewiesene Entwicklung von Weiss’ Ästhetik in Richtung einer politisierten Kunstform, die sich gegen die vorherrschende Verdrängungshaltung im Nachkriegsdeutschland wendet, mündet im Widerstandsroman in eine Konzeption, der die Vermittlung von ästhetischem Modernismus und politischer Aktion zum zentralen Anliegen wird: Die Ästhetik des Widerstands
kann das von der Historisierung der Modernitätsproblematik Intendierte umso deutlicher machen, als es die historische Erfahrung selber radikalisiert, zu einem Darstellungstypus steigert, der Kunst und Politik in eine weit intensivere Vermittlung zwingt als es die ästhetische Theorie bisher vermocht hat. In der Tat geht es der von Peter Weiss gewählten Darstellungsform zentral darum, die in der ästhetischen Theoriebildung häufig abstrakt bleibende Formulierung, daß die Moderne um das Verhältnis von Kunst und Politik in ‚ihrer Identität und Differenz‘ kreise, historisch zu konkretisieren.
In diesem Sinne ist der Widerstandsroman zu sehen als Versuch der erzählerischen Umsetzung der von Weiss angestrebten Zusammenführung von sozialistischer Parteinahme und ästhetischer Produktion unter der Leitperspektive einer kritischen Auseinandersetzung mit dem historischen Material. Im Bewusstsein der gegenseitigen Bezugnahme literarischen Schaffens und politischer Handlungsanweisung – „ästhetische Fragen sind immer politische Fragen“ , notiert Weiss 1975 dahingehend – wird der Roman zum Versuch, die Grundlinien einer Poetik des Widerstands in der Anlage eines epischen Großprojekts zu realisieren: „Hier ist die Rede von einer Ästhetik, die nicht nur künstlerische Kategorien umfassen will, sondern versucht, die geistigen Erkenntnisprozesse mit sozialen u pol. Einsichten zu verbinden – “. Als „kämpfende Ästhetik“ legt Weiss seinen Widerstandsroman als Entwurf an, von dem aus vor dem Hintergrund des antifaschistischen Kampfes gegen die nationalsozialistische Diktatur Kunst und Engagement als Erkenntnis- und Handlungseinheit den Ausgangspunkt zu einer widerständigen Haltung entgegen den unterdrückenden drückenden Kraftzentren des historischen Geschehens bilden. Diese Konzeption ist darauf verwiesen, die Entwicklungsprozesse der literarischen Figuren als zunehmenden Erwerb ästhetischer wie politischer Aufnahme- und Verstehenskompetenzen in Konfliktlage zu den lebensbedrohlichen Mechanismen der herrschenden Diktatur des Faschismus zu entfalten. Erst die Einbettung des literarischen Personals der Ästhetik des Widerstands in eine Lage allgegenwärtiger Gefährdung macht die von den Figuren geführten Debatten um Kunst und Politik als schrittweisen Erwerb einer widerständigen Haltung unter der utopischen Perspektive einer fortlebenden Hoffnung auf wahrhafte Befreiung möglich. Die vom Ich-Erzähler zum Romanende formulierte Reflexion auf den heraufziehenden Systemkonflikt nach dem Ende des Faschismus markiert die historische Konstanz bedrohter Subjektivität als Ausgangspunkt einer Notwendigkeit des Utopischen:
Über die Erfahrungen, die durchsetzt waren von Tod, würde sich die grell kolorierte, längst wieder von Folter, Brandschatzung und Mord gefüllte Zukunft legen. Immer würde es sein, als sollten alle früheren Hoffnungen zunichte gemacht werden von den später verlorengegangnen Vorsätzen. Und wenn es auch nicht so werden würde, wie wir es erhofft hatten, so änderte dies doch an den Hoffnungen nichts. Die Hoffnungen würden bleiben. Die Utopie würde notwendig sein.
Diese Notwendigkeit des Utopischen, die die Ästhetik des Widerstands einerseits über das inhaltliche Moment einer fortdauernden Hoffnung auf Befreiung, andererseits über das Moment einer der drohenden Undarstellbarkeit trotzenden Formensprache betont, weist die konstitutive Grundbefindlichkeit der Figuren als gefährdet aus. Karl-Josef Müllers Feststellung, der Roman umschreibe den „problematischen Versuch der Annäherung an eine als zutiefst bedrohlich empfundene Wirklichkeit mit Hilfe der Kunst“, erfasst präzise die Pole, zwischen denen sich die Konzeption der widerständigen Ästhetik entwickelt: Die anhand der erzählerischen Modellierung gefährdeter Subjektivität nachvollziehbare Notwendigkeit zur Auflehnung gegen die Schrecknisse von Unterdrückung, Krieg und Vernichtung generiert das Projekt einer im Ästhetischen fundierten Existenzsicherung, von der aus die Bewältigung des Bedrohlichen als an der Rezeption von Kunstwerken geschulte Befähigung möglich wird. In diesem Sinne ist das Anliegen einer sich episch entfaltenden und autoreflexiv kommentierenden ästhetischen Konzeption erzähllogisch an die vorauslaufende wie konstante Darstellung des Bedrohlichen verwiesen. Weiss entwirft in seinem Widerstandsroman aus der Perspektivik einer dauerhaften und existentiellen Gefährdungslage heraus das literarische Panorama von der „realen Bedrohung der Menschheit, deren psychische und physische Vernichtung längst imgange ist“, indem er seine Figuren „angesichts übermächtiger Bedrohungen“ als nahezu ohnmächtige Subjekte den Sogkräften kaum zu erfassender Gefährdungen aussetzt.
1.1.1 Bedrohlichkeit und Berichtmodus
Die Begegnungen mit den Gefahren faschistischer Gewalt vollziehen sich in der Ästhetik des Widerstands nicht über die direkte Schilderung von Konfrontationsepisoden der Figuren mit ihren Gegnern, sondern über die vermittelnde Darstellungsform des Gesprächs. Die spezifische Charakteristik des erzählenden Ich als referierender Instanz des Geschehens lässt die tatsächlichen Ereignisse des antifaschistischen Kampfes gegen die nationalsozialistische Diktatur als vermittelte Wiedergabe nahezu ausschließlich in Form des Berichts in Erscheinung treten. In diesem Sinne ist die Analyse der Präsentationsweise einer allgegenwärtigen Bedrohlichkeit – „wir waren schrecklich bedroht“, vermerkt Weiss in einer Arbeitsnotiz – zunächst verwiesen auf die Analyse der erzähltheoretischen Grundlagen des Romans: Erst die Erfassung der spezifischen Erzählweise der Ästhetik des Widerstands ermöglicht die Erkenntnis der Grundlagen eines Darstellungsverfahrens, von dem aus die Omnipräsenz einer erdrückenden Bedrohungslage in die Form einer widerständigen ästhetischen Konzeption mündet. Ausgehend von der umfangreichen Studie Stephan Meyers, der zwar nicht die narratologischen Voraussetzungen für den konkreten Sachverhalt der literarästhetischen Modellierung historischer Bedrohungen, wohl aber die Beziehungsverhältnisse von Erzählakt und kunsttheoretischer Selbstreferentialität des Romans erfasst, lässt sich die Ausdifferenzierung von „‚reflektierendem‘ und ‚erlebendem‘ Ich“ als Grundlage für den Darstellungsmodus des Bedrohlichen erweisen. Genia Schulz’ These von dem die Ästhetik des Widerstands prägenden „Modus des Indirekten“ trägt diesem Sachverhalt Rechnung, wenn die den Roman konstituierende indirekte Präsentationsform als poetisches Darstellungsprinzip erfasst wird, das als amalgamierende Zusammenführung einer Vielzahl von Erfahrungen, Erkenntnissen und Positionen unterschiedlicher Figuren im Bewusstsein des erzählenden Ich eine Distanzschaffung vom eigentlichen Geschehen bewirke. Diese Distanzierung wiederum ermögliche, so Schulz, die vom Bericht-Ich selbstreflexiv kommentierte Befähigung zum Schreiben als Akt einer polyvalenten Präsentation des Geschehens, die sich entgegen ideologischen Deutungs- und Verstehensvorgaben als kritisches Bewusstsein zur Gestalt widerständigen Schreibens formiere:
In indirekter Rede werden geschichtliche Ereignisse und politische Positionen, ästhetische Theorie und Erfahrungen im Umgang mit Kunstwerken referiert, so daß alle Aussagen gleichsam hintertrieben werden, wodurch die konjunktivische Daseinsweise der politisch-historischen Realität selbst eine „Aussage“ der Ästhetik des Widerstands wird.
Selbstreflexiv kommentiert das erzählende Ich im zweiten Band der Ästhetik des Widerstands genau dieses Verfahren als Grundlage seines eigenen schriftstellerischen Schaffens. Der Kontakt zu Bertolt Brecht, „der mein Freund nicht, doch mein Lehrer gewesen war“, im schwedischen Exil und die Mitarbeit an dessen Engelbrekt-Stück ermöglicht dem Ich die Teilhabe an einem ästhetischen Produktionsverfahren, das sich als Sammlung, Konzentration und Verarbeitung einer Vielzahl an zugetragenen Stoffen und Themen erweist. „Das kollektive Wissen, das er [Brecht] in sich einsog, verlieh allem, was er niederschrieb, eine allgemeingültige, politische Bedeutung“, referiert das Ich Brechts Arbeitsverfahren, um in Anschluss daran seine eigene Entwicklung zum Schriftsteller als an Brecht geschulte Zusammenführung von politischem Engagement und ästhetischer Autonomie zu reflektieren:
Wie aber, fragte ich mich, ließ sich diese politische Fähigkeit in solchen Maß auf das Medium der Dichtung übertragen, daß dieses die Eigenschaft erhielt, ganz in der gegenwärtigen Zeit zu stehn, und zugleich eine völlige Autonomie zur Geltung zu bringen.
Der Ich-Erzähler entwickelt ein Bewusstsein für die Grundlagen des eigenen Schaffens in Anlehnung an die Arbeitspraxis Brechts, der die zunächst unüberschaubare Menge historischen Materials mit „Leichtigkeit“ in Stofffragmente zukünftiger literarischer Produktion rubriziert, sie im analytischen Zugriff zergliedert, um sie dann, ausgewertet und in kausale Zusammenhänge gebracht, „in einer Art Montage“ zu einer die historischen Zusammenhänge, künstlerische Einbildungskraft und politische Wirkabsicht vereinenden literarischen Produktion zusammenzuführen. Dieses eigene Schaffen des Ich soll hier in der Begrifflichkeit von Registratur, Abstraktion und Komposition als an Brechts Produktionsmethode orientiertes Verfahren verstanden werden, das in der Zusammenführung wissenschaftlicher Deduktion und künstlerischer Imagination den eingangs erwähnten Modus des Indirekten zum leitenden ästhetischen Gestaltungsprinzip macht. „Ich begann meine neue Tätigkeit als ein Chronist, der gemeinsames Denken wiedergab“.
Die narrative Gestaltung der Lage der Figuren als gefährliche Konfrontation mit den bedrohlichen Kräften faschistischer und kapitalistischer Unterdrückung ist durch diesen den Roman dominierenden Berichts- und Referatsmodus vor dem Hintergrund der adornoschen Bestimmung der Erzählverfahren im modernen Roman zu begreifen als ästhetische Formung der unmöglich gewordenen Einheit von Erfahrung. Das erzählende Ich der Ästhetik des Widerstands ist als Instanz der Stimmgebung für die Vielzahl der antifaschistischen Figuren Ausdruck einer Zersplitterung in Erfahrungsfragmente, deren erzählerische Reorganisation sich nur noch im Bewusstsein um die bleibende Sichtbarmachung der Bruchstellen vollziehen kann: „Zerfallen ist die Identität der Erfahrung, das in sich kontinuierliche und artikulierte Leben, das die Haltung des Erzählers einzig gestattet“. Dabei dokumentiert sich das Wissen um die Schwierigkeit eines Erzählverfahrens, das die Heterogenität der vielfältigen figurenzentrierten Erfahrungsinhalte in die vermeintliche Objektivität einer überlegenen Erzählperspektive zwingen will, bereits frühzeitig während Weiss’ Arbeit an dem Roman. Im Gegensat...