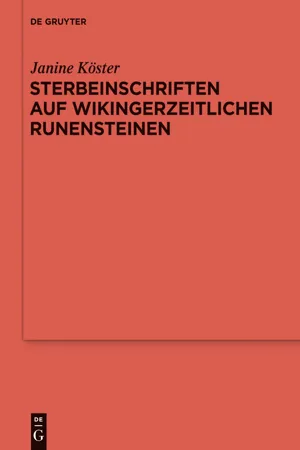In diesem Abschnitt der Arbeit werden die Ergebnisse der untersuchten Kategorien, die zuvor aufgelistet wurden, detailliert vorgestellt; dies beginnend mit dem Kapitel zur Sterbeterminologie, worin grundlegende Informationen für die darauf folgenden Kapitel enthalten sind.
1 Die Sterbeterminologie
Die auf Runensteinen verwendeten Begriffe für den Themenkomplex ‚Tod und Sterben‘ zeigen sich vielfältig und spiegeln differenziert die Sterbearten wider. Insgesamt lassen sich die Sterbetermini in mehrere Bereiche einteilen: Es gibt Begriffe, die den Tod benennen und die genaueren Umstände des Sterbens nicht weiter umreißen, z. B. durch verða dauðr (gestorben). Der Leser erfährt auf kurze, prägnante Weise und in wertneutraler Form, dass die Person gestorben ist (Gruppe 1: Neutrale Formulierung).
Daneben gibt es eine Reihe von Wörtern, die der Information über das Sterben einer Person noch eine weitere Ebene verleihen. Der Leser erfährt nicht nur die Tatsache des Todes, sondern durch die Wahl des Vokabulars auch etwas über die Art der Vorgänge. Diese Umstände sind evident extrinsischer Natur (Gruppe 2: Benennung der Umstände) und lassen sich in zwei Bereiche einteilen, die einerseits eine aktive Handlung durch eine oder mehrere andere Personen voraussetzen, z.B. drepa (erschlagen), andererseits eine unnatürliche Todesart aufgrund äußerer Umstände mitteilen, die zwar auch auf menschlichen Handlungen basieren können, dies jedoch nicht ausdrücklich beinhalten müssen, z.B. drukna (ertrunken).
Ein weiterer Bereich enthält Umschreibungen, die das Sterben oder den Tod nicht explizit, sondern auf eher euphemistische Weise zum Ausdruck bringen, eventuell über die Formulierung eines Begräbnisses, z.B. hér liggr Sigreifr (aus der Inschrift Husby-Lyhundra kyrka (U 541): „hier liegt Sigreifr“). Dieser Gruppe wohnt eine Tendenz zur Anonymisierung inne. Hier sind auch die äußerst wenigen Anzeichen von deutlichem Trauerverhalten der Hinterbliebenen enthalten, welche auf einen Tod von Angehörigen schließen lassen (Gruppe 3: Konnotative Mitteilung).
Grundsätzlich sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die für diese Untersuchung vorgenommene Gruppierung keine weiteren Deutungen zuließe (dies insbesondere aus dem Kontext der jeweiligen Inschrift). Beispielsweise kann ein Toter, der als begraben genannt wird, durchaus auch erschlagen worden sein. Gleichzeitig ist auch damit zu rechnen, dass Trauer nicht nur dann empfunden wurde, wenn dies auf der Inschrift explizit zum Ausdruck kommt.
Deutlichere und informativere Hinweise diesbezüglich mögen aus wirtschaftlichen Gründen–oder ganz pragmatisch aus Platzmangel–nicht erfolgt sein. Manches Mal wurde vielleicht eine Formulierung einer anderen aufgrund von sprachlich passenderen oder metrischen Merkmalen vorgezogen. Diese Aspekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass der Großteil des Inschriftenkorpus sicherlich nicht auf Zufälligkeit basiert, sondern die endgültige Form der Inschrift (sowohl äußerlich als auch inhaltlich) vom Errichter des Runensteins genau oder annähernd so gewollt war. Dies auch, wenn sich beispielsweise hinter einer verða dauðr-Inschrift in der Realität eine ermordete Person verbergen mag, so wurde dies–aus welchen Gründen auch immer–nicht mitgeteilt und eine andere Informationsbasis gewählt.
Die in dieser Arbeit vorgenommene Einteilung in Gruppen kann daher höchstens als Versuch gesehen werden, die Verhaltensweisen der Hinterbliebenen im Umgang mit dem Tod zu generalisieren, um auf diese Weise weitere Merkmale der Runensteinsitte erkennen zu können.
Im Folgenden wird in Kürze auf die sprachlichen Vorkommen der einzelnen Termini eingegangen. Des Weiteren werden die unterschiedlichen Anwendungsformen sowie eventuell bestehende Probleme in der Deutung angesprochen.
Es werden diese Abkürzungen verwendet:
WB = Walter Baetke: Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur, 5. Aufl., Berlin
1993.
LP = Lena Peterson: Svenskt Runordsregister (= Runrön 2), 3. Aufl., Uppsala 2006.
Die runischen Belege für die hier relevanten Inschriften stützen sich auf das Register von Lena Peterson (LP) und wurden für diese Arbeit erweitert um die Bereiche Dänemark, Norwegen und Gotland sowie um die chronologisch in den Grenzbereich zum Mittelalter zu datierenden Inschriften.
Gruppe 1: Neutrale Formulierung
Der Tod wird konkret als solcher genannt, aber durch eine neutrale Formulierung ausgedrückt.
enda
Übersetzung nach WB: andask sterben, andaðr gestorben.
Runische Belege: 23.
endaðis (pret.sg.3): G 207, Ög 81 (2x), Sö 9, Sö 33, Sö 65, Sö 85, U 136, U 140, U 358, U 518, Ög 155, Sm 27, Sm 29, Sm 46, Sö 216.
endaðus (pret.plur.3): U 153, Sö 34.
endaðr (pret.ptcp.sg.m.nom): Sö 40, Sö 148, Sö 345, Sö Fv1954;22, Vs 1.
verða dauðr
Übersetzung nach WB: dauðr tot, dauðan Leiche.
Runische Belege: 77.
dauðr (m.sg.ack.): Sm 83
dauðr/døðr (Adj.sg.m.nom.): Sö 16, Sö 46, Sö 49, Sö 53, Sö 55, Sö 62, Sö 82, Sö 121, Sö 160, Sö 254, Sö 287, Sö 319, Sö Fv1954;20, Ög 30, Ög 68, Ög 81, Ög 94, Ög 184, Ög Fv1970;310, Ög Fv1950;341, Sm 28, Sm 52, Sm 77, G 92, G 135, Gs 13, Vs 9, Vs 22, Vs 27, Nä 15, N 62, N 184, Vg 40, Vg 61, Vg 178, Vg 197, U 29, U 170, U 364, U 366, U 375, U 431, U 539, U 540, U 661, U 687, U 699, U 785, U 812, U 896, U 925, U 1036, U 1087, U Fv1922;157, DR 1, DR3, DR 66, DR 108, DR 117, DR 216, DR 220, DR 259, DR 266, DR 334.
dauðs (gen.): Öl 1
dauðan (ack.): Sö 122, DR 110, Sm 16, U 620.
dauð (f.nom.): Sö 15, U 29, G 270, DR 6, DR 114.
dauðir (pl.m.nom.): Sö Fv1948;289, Vg 184.
deyja/dó
Übersetzung nach WB: deyja (dó) sterben.
Runische Belege: 27.
dó (pret.sg.3): U 29, U 112, U 133, U 141, U 180, U 283, U 446, U 613, U 1048, U 1016, Ög 83, Ög 136, Sö 164, Sö 170, Vs 5, Vg 81, Vg 91, DR 37, DR 68, G 111, G 136, G 220.
dóu (pret.pl.3): U 73, U 154, U 243, Sö 173, Sö 179.
týna
Übersetzung nach WB: týnask ums Leben kommen, týna verlieren, einbüßen.
Übersetzung nach Judith Jesch: týna aldri das Leben verlieren.
Runische Belege: 2.
týynði (pret.sg.3): Sm 5, Vg 187.
fara/fór
Übersetzung nach WB: fara (fór) verlorengehen, schwinden; umkommen, sterben.
Runische Belege: 6.
fórs (pret.sg.3): Ög 145, Sö 335, U 201, U 349, U 363, U 1016.
láta fjǫr
Übersetzung nach WB: fjǫr Leben, láta: lassen, verlieren.
Übersetzung nach Judith Jesch: láta fjǫr sitt: sein Leben verlieren.
Runische Belege: 2.
let fiǫr(u) (n.sg.ack): Ög 136, Sö 174.
Die Formulierungen dauðr und deyja kommen beide auch in Verbindung mit der Information í hvitaváðum (in weißen Kleidern, Taufkleidern) vor, was mögliche Rückschlüsse auf eine wertfreie bzw. neutrale Ausdrucksweise zulässt. Die beiden Inschriften, welche das Sterben in der Heimat konkret nennen, gehören ebenfalls in diese Gruppe. Eine kriegerische Handlung oder das bewusste Eingreifen einer weiteren Person ist damit jedoch nicht ausgeschlossen, speziell unter Hinzuziehung des jeweiligen Inschriftenkontextes. Die Wahl dieser Formulierungen lässt lediglich Rückschlüsse auf die Hinterbliebenen und deren Umgang mit dem Tod zu.
Klaus Düwel merkt an, dass die unterschiedlichen Verwendungen der Sterbeformulierungen einen Hinweis darauf geben könnten, ob die jeweilige Inschrift mit einer Handelsfahrt in Verbindung zu bringen ist. „Vor allem ein nicht gewaltsamer, friedlicher Tod“ würde dafür sprechen.
Grundsätzlich ist dem zuzustimmen, was bedeutet, dass sich die Inschriften, die auf Handelsfahrten deuten, vorwiegend in Gruppe 1 (Neutrale Formulierung) der Sterbeterminologie befinden dürften. Eine klare Grenze kann jedoch nicht gezogen werden, da es sicherlich auch auf Handelsfahrten gelegentlich zu Auseinandersetzungen und Überfällen gekommen sein dürfte und daher in seltenen Fällen auch ein Sterbeterminus, der auf gewaltsame oder kämpferische Hintergründe hinweist, den Tod eines Händlers bezeichnet haben kann.
Dass die Grenzen zwischen kriegerischem und friedlichem Sterben (respektive der nachträglichen Interpretation durch den Leser) fließend sind, zeigt beispielsweise Arndt Ruprechts Deutung der Inschrift zu Sjusta (U 687), deren Übersetzung er folgendermaßen aufführt: „[…] nach Spjallbuði, ihrem Mann. Er fand den Tod in Holmgard in der Olafskirche […]“ Und im Weiteren schreibt er: „die näheren Umstände von Spjallbuðis Kampf liegen im Dunkel.“
Zusammengefasst bedeutet das, dass Arndt Ruprecht in der Formulierung „fand den Tod“ durchaus kriegerische Hintergründe sieht. Obgleich die Inschrift keinen weiteren Hinweis für eine kämpferische Aktion bietet, führt Arndt Ruprecht seine Lesart mittels einer entsprechenden Argumentation nicht weiter aus.
Nur eine (fragmentarische) der insgesamt neun Inschriften, die Personen namens Spjallbuði nennen, enthält einen (teilweise fehlenden) Satzteil, der „in Spjallbuðis [Mannschaft?]“ lauten könnte. Diese Inschrift von Vändle, Sörgården (Vs 5) bezieht sich in ihren Angaben über die Lokalitäten jedoch auf den Westen (England), nicht wie in der Inschrift von Sjusta (U 687) auf den Osten. Allein die Formulierung verða dauðr besagt nichts über den Kontext, in dem der Tod geschah, gibt also für sich gesehen weder einen Hinweis auf friedliches Handeln noch auf kriegerische Aktivitäten.
Über die norwegische Inschrift von Alstad (N 62), die für þóraldr errichtet wurde, der in Vitaholm starb (verwendet wird der Terminus verða dauðr), schreibt Klaus Düwel, dass bei diesem Unternehmen Handel nicht ausgeschlossen werden könne, da „[…] der mit der Formel varð dauðr angezeigte gewaltsame Tod nicht im Verlauf einer Kampfhandlung erfolgt sein muss.“ Auch die Inschrift von Ene (Sö 49, beinhaltet ebenfalls den Terminus verða dauðr) sieht er in diesem Licht eines „unnatürlichen, gewaltsamen“ Todes, während er in einer Fußnote zum vorgenannten Textabschnitt in der Nennung von Ausdrücken södermanländischer Inschriften für „sterben“ bzw. „umkommen“ den Begriff „(vera; verða) dauðr“ mit „den Tod finden“ übersetzt.
Ebenso übersetzt Klaus Düwel die Inschrift von Lövsta (U 1087), welche gleichfalls den Terminus verða dauðr enthält, neutral mit „fand den Tod“ und geht hier nicht primär von einem gewaltsamen Tod aus, sondern listet sie in der Reihe der Inschriften auf, welche „nur lapidar [den] T...