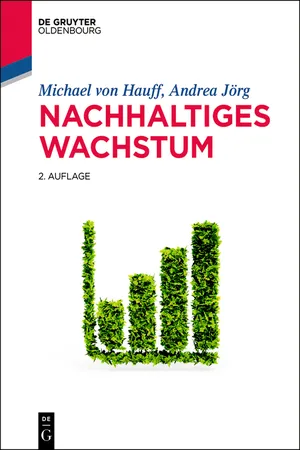
- 225 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Nachhaltiges Wachstum
Über dieses Buch
In dem Buch werden aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen zu nachhaltigem Wachstum, Anforderungen an ein nachhaltiges Wachstum definiert.
In der Neuauflage wurde die aktuelle Diskussion zu green growth (grünes Wachstum) neu aufgenommen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Nachhaltiges Wachstum von Michael von Hauff,Andrea Jörg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Volkswirtschaftslehre & Entwicklungsökonomie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Einführung in das Leitbild nachhaltiger Entwicklung
Die Weltgemeinschaft hat sich im Jahr 1992 auf der internationalen Konferenz der „United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)“ in Rio de Janeiro auf das Leitbild Nachhaltiger Entwicklung verständigt. Bei dieser Konferenz verpflichtete sich die Völkergemeinschaft darauf, das Leitbild im 21. Jahrhundert umzusetzen. Durch diese Konferenz erhielt das Leitbild international eine große Popularität und eine wachsende politische Gestaltungsorientierung (v. Hauff 2014, S. 11). Auf der Konferenz wurde die Agenda 21 als handlungsleitendes Programm vorgelegt. Dieses Aktionsprogramm hat die Zielsetzung die ökologische, ökonomische und soziale Dimension gleichrangig zusammenzuführen und umzusetzen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass wirtschaftliche und soziale Aktivitäten langfristig nur in den Grenzen der ökologischen Systeme möglich sind, da die Überlebensfähigkeit der Menschheit von der Funktionsweise der ökologischen Systeme abhängig ist. Das hat weitreichende Implikationen für die Messung und Begründung von Wirtschaftswachstum. Dadurch steht es nicht mehr uneingeschränkt im Mittelpunkt aller wirtschaftlichen Handlungen, sondern muss in die Dreidimensionalität eingebunden werden.
Auf der Rio Konferenz wurden weitere Beschlüsse gefasst, die exemplarisch genannt werden:
–die Rio-Deklaration zur Umwelt und Entwicklung,
–die Klimarahmenkonvention,
–die Konvention über biologische Vielfalt und
–die Waldkonvention,
die alle einen stark ökologischen Anspruch haben. Hierzu muss jedoch festgestellt werden, dass keines der Dokumente konkrete und überprüfbare Verpflichtungen enthält. Weiterhin ist darauf zu verweisen, dass es im Anschluss an die Rio Konferenz zu einer Reihe von Folgekonferenzen kam wie
–die Weltbevölkerungskonferenz 1994,
–der Weltsozialgipfel 1995 und
–die Klimakonferenz (Kyoto-Protokoll) 1997.
Im Jahr 2002 fand die in Rio de Janeiro beschlossene Folgekonferenz, d. h. der zweite Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg statt. Bei dieser Konferenz wurde besonders ein Plan zur Implementierung verabschiedet, in dem Ziele und Programme für Umweltschutz und Armutsbekämpfung aufgeführt sind. Bereits im Jahr 1997 hat sich die Völkergemeinschaft darauf verständigt, dass alle Länder bis 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln sollen. Das wurde auf der Johannesburg-Konferenz noch einmal eingefordert, da bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige Länder eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt hatten. Deutschland legte im Jahr 2002 seine erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie vor. Sowohl in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands als auch in dem aktuellen Folgebericht (2016) wird das Thema Wirtschaftswachstum in den Kontext nachhaltiger Entwicklung integriert. Im Jahr 2012 fand die Konferenz Rio+20 unter dem Leitthema „Greening the Economy“ statt. 2015 wurden die Sustainable Development Goals (SDG) für alle Länder weltweit verabschiedet, die bis 2030 (einige bis 2020) realisiert werden sollen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der Agenda 2030. In dem SDG 8 „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ wird das Wachstumsziel explizit aufgeführt. 2017 soll eine weltweite Bestandsaufnahme „25 Jahre nach Rio“ stattfinden.
Das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung mit seinen vielfältigen Anforderungen, die über den ökonomischen Mainstream weit hinausgehen, fand in den Wirtschaftswissenschaften bisher noch wenig Beachtung. Das gilt auch für die Wachstumstheorie und -politik. Obwohl Wirtschaftswachstum in der Nachhaltigkeitsdiskussion an Bedeutung gewonnen hat, lässt sich doch feststellen, dass in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur die Beziehung zwischen nachhaltiger Entwicklung und Wirtschaftswachstum bisher noch unzureichend analysiert wird. Es stellt sich die Frage, ob nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftswachstum grundsätzlich in Einklang zu bringen sind und wie sich ein nachhaltiges Wachstum begründen lässt. Die bisherige Diskussion hierzu konzentrierte sich hauptsächlich auf die Beziehung von Wirtschaftswachstum und ökologischer Nachhaltigkeit, obwohl sich auf internationaler Ebene in der wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskussion das Konzept der Dreidimensionalität (Ökologie, Ökonomie und Soziales) durchgesetzt hat. Die soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung, d. h. die soziale Nachhaltigkeit hat bisher nur eine relativ geringe wissenschaftliche Zuwendung erfahren.
Die Dominanz der ökologischen Dimension begründet sich daraus, dass die ökologischen Systeme teilweise bereits eine Übernutzung aufweisen, die zu irreparablen Schädigungen geführt haben wie beispielsweise der Klimawandel deutlich macht. Aus diesem Grund hängt die Lebenssituation zukünftiger Generationen ganz wesentlich davon ab, ob es gelingt, die wirtschaftliche Entwicklung und im Speziellen das Wirtschaftswachstum so zu gestalten, dass es gleichzeitig zu einer Entlastung ökologischer Systeme kommt (siehe dazu auch Kap. 6).
Ein weiteres konstitutives Merkmal nachhaltiger Entwicklung ist die intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit, wie sie bereits im Brundtland-Bericht gefordert wird. Hierbei handelt es sich um eine Querschnittsanforderung, die sich durch alle drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung zieht:
–Intragenerationelle Gerechtigkeit: Sie fordert einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen und Bedürfnissen der Menschen in Industrie- und Entwicklungsländern. Gleichzeitig wird in zunehmendem Maße gefordert, dass auch in Industrie- bzw. Entwicklungsländern ein höherer Grad intergenerationeller Gerechtigkeit notwendig ist.
–Intergenerationelle Gerechtigkeit: Sie lässt sich durch die Definition des Brundtland-Berichts verdeutlichen. „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987, S. 46)
In diesem Kontext stellt sich aus der Perspektive nachhaltiger Entwicklung die Frage, ob Wachstum gerecht verteilt wird. Hierzu wurde der Begriff „inclusive growth“ eingeführt.
1.1Das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung
Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung hat historisch gesehen Vorläufer, die für die Beziehung zwischen nachhaltiger Entwicklung und Wirtschaftswachstum relevant sind. Seinen Ursprung kann man der Wald- und Forstwirtschaft zuschreiben. In der Forstwirtschaft wurde schon früh erkannt, dass ein Gleichgewicht zwischen Abholzung und Aufforstung für den langfristigen Bestand der Ressource Holz für den Bergbau und die Verhüttung von existenzieller Bedeutung ist. Ein weiteres Beispiel für eine wachstumskritische Arbeit aus ökonomischer Sicht ist die Schrift von Thomas Malthus (1798): „An Essay on the Principle of Population“. Er ging davon aus, dass die Bevölkerung stark wachsen und die Nahrungsmittelproduktion dem nicht standhalten würde. Preissteigerungen wären die Folge. Um das Ungleichgewicht zu lösen, schlug Malthus Bildungsmaßnahmen und Heiratskontrollen vor. Die Prognosen traten jedoch nicht ein, da Malthus den technischen Forstschritt in der Landwirtschaft unterschätzt und das Bevölkerungswachstum überschätzt hat.
Seit Beginn der 1970er Jahre gibt es die Diskussion über nachhaltiges Wirtschaften. Wichtige Meilensteine waren die wachstumskritische Studie von Meadows u. a. „Die Grenzen des Wachstums“, die 1972 erschien. Die Grenzen des Wachstums wurden dabei an fünf Parametern festgemacht: das Bevölkerungswachstum, die Nahrungsmittelproduktion, die Industrialisierung, die Umweltverschmutzung und die Rohstoffe. Eine Reaktion darauf war das wirtschaftswissenschaftliche „Symposium on the Economics of Exhaustible Resources“, bei dem wichtige Erkenntnisse der Studie von Meadows in Frage gestellt wurden. Nachhaltige Entwicklung ist jedoch erst seit dem Erscheinen des Berichtes der Brundtland-Kommission „Our common Future“ die Grundlage für ein neues und umfassendes Leitbild der Weltgemeinschaft.
1.1.1Historische Vorläufer des Paradigmas nachhaltiger Entwicklung
Ein bedeutender Vorläufer des aktuellen Leitbildes nachhaltiger Entwicklung ist die Forstwirtschaft. Der Begriff Nachhaltig wurde bereits von dem Freiberger Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz geprägt, der ihn vor etwa 300 Jahren in seiner Abhandlung „Sylvicultura oeconomica“ in dem Jahr 1713 einführte. Seine Überlegungen gingen davon aus, dass der Bergbau und die Verhüttung einen hohen Holzbedarf verursachen. Es kam dazu, dass die Umgebung der Bergbaustätte häufig entwaldet war (Ott, Döring 2008, S. 22). Die Folge war, dass Holz von großer Entfernung, d. h. meistens über Flößer transportiert werden musste. Dadurch stiegen die Holzpreise und es kam zu der verbreiteten Befürchtung einer Holzknappheit. Die aufkommende Knappheit der Ressource Holz führte zu der Gefahr einer Beschränkung des wirtschaftlichen Wachstums.
Dieses Beispiel war im Prinzip ein Vorläufer der Diskussion über die „Grenzen des Wachstums“. Daraus leitete von Carlowitz ab, dass in der Forstwirtschaft ökonomisches Handeln mit den Erfordernissen der Natur in Einklang zu bringen ist. Seine Maxime war: Es soll pro Jahr nicht mehr Holz geschlagen werden als nachwächst um die Verfügbarkeit der Ressource Holz nicht zu gefährden. Es handelt sich hierbei also um das in der Literatur heute weithin bekannte ressourcenökonomische Prinzip. Dieses Prinzip hat in der deutschen Forstwirtschaft auch heute noch Bestand.
Die Gefahr der Grenzen des Wachstums wurde dann 1972 in dem ersten Bericht an den Club of Rome mit dem Titel „The Limits of Growth“ (deutsch „Die Grenzen des Wachstums“) von Dennis Meadows et al. analysiert und aufgezeigt. Zuvor waren es bereits andere Ökonomen, die sich jedoch mehr den Kosten ökonomischen Wachstums zuwandten. Besondere Beachtung fand das Buch von Mishan mit dem Titel „The Cost of Economic Growth“ das im Jahre 1963 veröffentlicht wurde. In diesem Zusammenhang sind auch noch Ökonomen wie Kenneth Boulding, John Galbraith und Georgescu-Roegen zu nennen, die auf die wachsenden Umweltprobleme aufmerksam machten.
Die wichtigste Botschaft des Berichtes „Die Grenzen des Wachstum“ der in 28 Sprachen übersetzt wurde war, dass eine Fortschreibung der bisher dominierenden auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsweise unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums bis Mitte bzw. Ende des 21. Jahrhunderts zu einer großen wirtschaftlichen Beeinträchtigung führen würde. Der Bericht zeigte jedoch nicht nur die Probleme bzw. Bedrohungen auf, sondern gab auch Hinweise auf Auswege. Es ist unbestritten, dass der Bericht konzeptionelle und methodische Unzulänglichkeiten aufweist. Dennoch führte er zu einer intensiven Kontroverse besonders über das exponentielle Wirtschaftswachstum und über nicht erneuerbare Ressourcen, die im Prinzip bis in die Gegenwart reicht.
Der Bericht führte zu einer sehr gegensätzlichen Resonanz. Befürworter des Berichtes „Grenzen des Wachstums“ wie Paul Ehrlich (1989) stellten besonders die Verknappung nicht erneuerbarer Ressourcen mit den im Bericht aufgezeigten Folgen heraus. Ein „Catching-up-Prozess“ (wirtschaftlicher Aufholprozess) von Entwicklungsländern würde dazu führen, dass sich das dominierende Wachstumsmodell des exponentiellen Wachstums nicht aufrechterhalten ließe. Neben der Rohstoffverknappung wird in dem Bericht auch die mit dem Wirtschaftswachstum einhergehende Zunahme der Schadstoffemissionen hervorgehoben. So kommt es neben der Rohstoffverknappung auch zu einer wachsenden Umweltverschmutzung. Die Kritiker halten dem Bericht vor, dass besonders der technische Fortschritt beziehungsweise der umwelttechnische Fortschritt aber auch die Umweltpolitik nicht ausreichend Berücksichtigung fanden.
2001 veröffentlichte Donella und Dennis Meadows eine Folgestudie mit dem Titel „Beyond the Limits“ (deutsch: „Die neuen Grenzen des Wachstums“). Eine zentrale Erkenntnis bzw. Botschaft dieses Berichtes ist, dass die Simulationen und die Neubewertung der Daten zeigen, dass die Nutzung zahlreicher Ressourcen und die Akkumulation von Umweltschäden bereits die Grenzen des langfristig Zuträglichen überschritten haben. Dies ist eingetroffen, obwohl der umwelttechnische Fortschritt positiv verlaufen ist, das Umweltbewusstsein der Bevölkerung aber auch der Politiker zugenommen hat und die Umweltgesetze weiterentwickelt bzw. verschärft wurden.
Ein weiterer wichtiger Schritt zu dem Paradigma nachhaltiger Entwicklung war die 1980 unter dem Dach der Vereinten Nationen gegründete „World Commission on Environment and Development“. Sie setzte 1983 die Brundtland-Kommission unter dem Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland ein, die 1987 den viel beachteten Brundtland-Bericht mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“ vorlegte.
Die Menschen sollen ihr Handeln so organisieren, dass sie nicht auf Kosten der Natur, nicht auf Kosten anderer Menschen, nicht auf Kosten anderer Regionen, nicht auf Kosten anderer Generationen leben.
Leitsatz der UNCED-Konferenz in Rio de Janeiro 1992
Nachhaltig ist eine Entwicklung nach dem Brundtland-Bericht, wenn gewährleistet wird, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden können, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu beeinträchtigen. Aus dieser Definition lassen sich vier konstitutive Elemente einer nachhaltigen Entwicklung ableiten:
–Konstitutiv ist zunächst das Prinzip der Verantwortung für kommende Generationen: Künftige Generationen sollen vergleichbare Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung vorfinden, wie sie der heutigen Generation zur Verfügung stehen (intergenerative Gerechtigkeit). In den im Anhang des Abschlussberichts der Brundtland-Kommission aufgeführten Rechtsprinzipien wird explizit die „Gleichheit zwischen den Generationen“ gefordert (Hauff 1987, S. 387).
–Die zweite damit eng verknüpfte Wertprämisse betrifft das Prinzip der intragenerativen Gerechtigkeit: Aus Sicht der Brundtland-Kommission bezieht die Verantwortung für soziale Gerechtigkeit zwischen den Generationen „logischerweise die Gerechtigkeit innerhalb jeder Generation“ mit ein. „Nachhaltige Entwicklung erfordert, die Grundbedürfnisse aller zu befriedigen und für alle die Möglichkeit zu schaffen, ihren Wunsch nach einem besseren Leben zu erfüllen“ (Hauff 1987, S. 47).
–Ein weiteres konstitutives Element ist die globale Orientierung: Es ging der Brundtland-Kommission darum, eine Entwicklungsperspektive für die Weltgesellschaft als Ganzes aufzuzeigen. Auf der Basis des in der Kommission erreichten Grundkonsenses über die Erfordernisse einer global nachhaltigen Entwicklung sollten dann die einzelnen Staaten spezifische Ziele und Strategien zur Umsetzung der allgemeinen Forderungen auf der nationalen Ebene erarbeiten, die ihren jeweiligen Ausgangsbedingungen angemessen wären.
–Konstitutiv ist schließlich der anthropozentrische Ansatz des Leitbildes: Es geht um die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen heute und in Zukunft. Daraus folgt, dass die Natur als Mittel menschlicher Zwecke betrachtet wird. Auch dort, wo ihr Eigenwert als Lebens- und Erfahrungsraum zugeschrieben wird, geschieht dies aus der Sicht und nach den Wertmaßstäben des Menschen (Acker-Widmaier 1999, S. 63 ff.).
Die Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung wurden im Brundtland-Bericht wie folgt dargeste...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Boxenverzeichnis
- 1 Einführung in das Leitbild nachhaltiger Entwicklung
- 2 Die Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt
- 3 Umwelt im Rahmen der Neoklassischen Theorie
- 4 Umwelt im Rahmen der endogenen Wachstumstheorie
- 5 Ökologische Ökonomie
- 6 Neuere Ansätze zu der Beziehung von Wachstum und Umwelt
- 7 Nachhaltigkeit und Wachstum – Unterschiedliche Begründungszusammenhänge
- 8 Wirtschaftswachstum und Innovationen
- Literaturverzeichnis
- Register