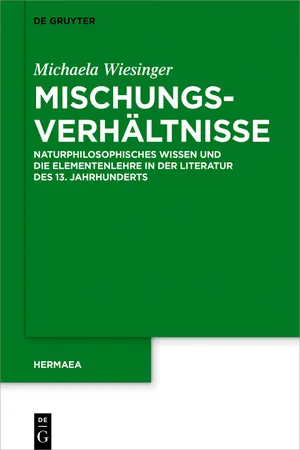a)Lexikalische Übersicht – zum Terminus
Als scientia naturalis, philosophia oder scientia physica wurde die Naturphilosophie als eine der drei theoretischen Wissenschaften (neben Theologie und Mathematik) in der Antike durch Aristoteles bekannt, deren Inhalt die Betrachtung der sinnlich wahrnehmbaren Substanzen war. Bereits bei den Vorsokratikern war jedoch die Erforschung der natürlichen Ursachen (die sich durch die Bezeichnung philosophia naturales von der auf Sokrates aufbauenden Philosophie abgrenzen) von großer Wichtigkeit: Schon die Stoa trennte Ethik, Logik und einen natürlichen Teil der Philosophie, zu dem auch die philosophische Theologie zu zählen ist. Diese Einteilung blieb auch bei Kirchenvater Augustinus noch bestehen und beeinflusste u. a. die Arbeiten Ciceros oder Isidors von Sevilla.3
Im Mittelalter zeichnete sich ab dem 9. Jahrhundert in der Naturphilosophie eine immer wichtiger werdende Tendenz zur strengeren naturwissenschaftlichen Methode ab. Hierbei standen entweder wie bei Wilhelm von Conches die Elemente als kleinste Teile der Natur oder auch wie bei Adelard von Bath die biologischen oder kosmologischen Fragen des Menschen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit den Übersetzungen von Averroes gelangte Anfang des 13. Jahrhunderts verstärkt aristotelisches Wissen nach Westeuropa und führte dazu, dass die Naturphilosophie zur eigenständigen Wissenschaft wurde. Trotz der Pariser Aristoteles-Verbote verknüpften Gelehrte wie Robert Grosseteste die Naturphilosophie nun stärker mit der Mathematik. Bei Albertus Magnus (und auch bei seinem Schüler Thomas von Aquin) bildeten gegen Ende des 13. Jahrhunderts Mathematik, Metaphysik und Naturphilosophie (oder Physik) die drei großen Bereiche der Hauptdisziplin Philosophie und zugleich den Schwerpunkt seiner gelehrten Beschäftigung, die sich für Albert auf natürliche, bewegliche Körper konzentrierte (z. B. Kosmologie und Physik4, aber auch die Medizin). Die folgenden Jahrhunderte liefern eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Naturphilosophie nach aristotelischem Vorbild, bereiten aber bereits im 15. Jahrhundert mit Nikolaus von Kues und seiner mathematischen Annäherung an die Welt bzw. seinen methodologischen Reflexionen den Weg für die exakte Naturwissenschaft der Neuzeit.
Dennoch muss bis um ca. 1700 der Versuch, die Naturphilosophie von der Naturwissenschaft zu trennen, unweigerlich scheitern, da eine Ausdifferenzierung dieser Begriffe erst im 18. Jahrhundert beginnt.5
All das führt mich zu einem ersten Definitionsversuch für den Betriff der Naturphilosophie: Der Terminus ›Naturphilosophie‹ bezeichnet die gelehrte Auseinandersetzung mit der Natur (hierzu zählt die gesamte Schöpfung in ihrem Makro- und Mikrokosmos) und deren Wirkungsmechanismen, die sich das Erkennen, die Beschreibung und Vermittlung der natürlichen Dinge zum Ziel setzt. Oft sind theologische Fragestellungen der Ausgangspunkt für die angestellten Überlegungen, die sich deshalb in weiterer Folge mit dem Untersuchungsgegenstand überlagern.
a)Zur Beschäftigung mit der Natur als Gegenstand des gelehrten Interesses im 13. Jahrhundert6
Das hochmittelalterliche Naturverständnis fußt weitgehend auf antikem Gedankengut und stellt eine Synthese von diesem mit der allgegenwärtigen christlichen Glaubensüberzeugung dar.7 Das antike Wissen war den Gelehrten jedoch nicht auf direktem Wege zugänglich, sondern begann sich erst mit dem 12. Jahrhundert aufgrund lateinischer Übersetzungen aus dem Arabischen zu verbreiten. Das Frühmittelalter beruft sich zwar auf platonisches Wissen (wie z. B. Isidor von Sevilla (ca. 560–636) in den Etymologiae oder auch in De natura rerum8, Beda Venerabilis (ca. 674–735) in De natura rerum9 oder auch Hrabanus Maurus (ca. 780–850) in seiner Schrift De rerum naturis10)11, kennt aber nur den Timaios, der noch im 12. Jahrhundert lediglich in zwei unvollständigen Übersetzungen von Cicero und Chalcidius zugänglich war. Das gilt auch für Kirchenvater Augustinus, dessen gelehrte Autorität jahrhundertelang ungebrochen blieb und der auch für Hugo von Trimberg in seinem Renner noch eine der wichtigsten Bezugsquellen war.12 Die christliche Glaubensüberzeugung stand dabei im Mittelpunkt der Beschäftigung mit der Natur.
Im Laufe des 12. Jahrhunderts beginnen jedoch – vor allem in den Städten Salerno, Bologna und später in Paris, Oxford und Cambridge13 – universitäre Bestrebungen, die das monastische Leben, Lernen und Lehren herausfordern. Das Verständnis für die Natur verändert sich, da die Gelehrten langsam die antiken Quellen als integralen Bestandteil ihrer eigenen Kultur betrachteten.
An die Stelle der symbolisch-spekulativen Interpretation der Natur, die in hermeneutischer Parallele zum Buch der Schrift ebenfalls als ›Buch‹ gelesen wurde mit Bezug auf Gott als den Autor beider Bücher, durch welche der Mensch gleichermaßen den Schöpfer zu erkennen vermag, tritt zunehmend ein originäres Interesse an der Struktur, Konstitution und Eigengesetzlichkeit der physisch-physikalischen Realität, welche die Vernunft ohne Rückgriff auf traditionelle, theologisch bestimmte Deutungsmuster als in sich sinnvolle Größe zu erfassen vermag.14
Die Schule von Chartres15, die im 12. Jahrhundert ihre Hochblüte erlebte, war und ist bekannt für ihren Fokus auf der empirischen Naturforschung, als deren Hauptautoritäten Platon und der auf ihn aufbauende Boethius galten. Eingebettet in die antike Tradition der septem artes liberales war in Chartres die Beschäftigung mit den antiken Dichtern (z. B. Cicero, Horaz, Lukrez etc.) und den Philosophen, aber auch mit den Naturphilosophen der klassischen Antike wie Galen, Pythagoras, Euklid oder Chalcidius Teil der Ausbildung. Das medizinisch-naturphilosophische Wissen wurde u. a. auch mit Hilfe lateinischer Übersetzungen arabischer Texte von z. B. Abu Maʼšar vertieft. Im Zuge dessen entstanden auch Arbeiten zur Schöpfungsgeschichte, die den naturphilosophischen Gehalt des Sechstagewerkes zu greifen versuchten. Kosmologische und naturphilosophische Erklärungsversuche stehen hierbei sowohl bei Thierrys von Chartres (1085–1155) De sex dierum operibus16 als auch bei Bernardus Silvestris (1085–1160) Cosmographia17 im Zentrum. Wilhelm von Conches (ca. 1089–1154) kommentierte nicht nur Platon und Boethius, sondern versuchte sich in seiner Philosophia mundi18 auch an einer systematischen Gesamtdarstellung des europäischen Wissens der Zeit.
Seit dem 12. Jahrhundert erreicht das ursprünglich lateinisch verfasste Buchwissen (und damit auch die gelehrte Naturkunde) ein größeres Publikum: Die weltliche Oberschicht beginnt, Interesse an gelehrtem Fachwissen zu entwickeln, das, von Frankreich ausgehend, sogar in den Volkssprachen, vornehmlich zur Laienbildung, zirkuliert. Auch der Schulbetrieb, der in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert einnimmt, ist ein wichtiger Konsument dieser volkssprachlichen Wissensliteratur. Dabei gilt nicht nur Fachprosa (z. B. Imago-mundi-Texte, Lehrdialoge, katechetische Texte, Evangelienharmonien, Etymologien oder Kräuterbücher), sondern auch Dichtung als Medium der Vermittlung.19
Das 13. Jahrhundert ist schließlich durch gesellschaftliche und wissenschaftliche Expansionen gekennzeichnet. Die Universitäten werden immer wichtiger und lösen sich langsam mehr und mehr von der Kirche ab; u. a. mussten die Artistenfakultäten des 13. Jahrhunderts per Eid schwören, sich nicht auf theologische Themen einzulassen. Die Schriften des Aristoteles, dessen Gesamtwerk um 1240 in lateinischer Sprache vorlag, wurden nunmehr an den Universitäten studiert. Dass der lateinische Aristoteles mit den arabischen Kommentaren übersetzt wurde, führte jedoch zu Unstimmigkeiten auf Seiten der Kleriker, da die Auslegungen der Philosophen Widersprüche in Glaubensfragen aufwarfen (einer der wichtigsten Streitpunkte war die von Aristoteles postulierte Ewigkeit der Welt, die einen Schöpfungsakt nicht beinhaltete). Das führte zu einem ersten Verbot der naturphilosophischen und metaphysischen Schriften des Aristoteles in Paris im Jahre 1210 – ein sicherer Beleg dafür, dass die Texte schon zu dieser Zeit gelesen, gelehrt und kommentiert wurden.
Nach dem ersten Verbot von 1210 wurden die französischen Universitäten von den Kirchenoberhäuptern in den Jahren 1231, 1245 und 1263 wiederholt abgemahnt, da offensichtlich weiterhin Aristoteles gelesen wurde. Darüber hinaus war den Studenten und Lehrenden auch das private Studium der Schriften untersagt. 1252 kam es zwischenzeitlich zur Legalisierung der Texte; ab 1255 galt das Studium des Aristoteles dann sogar an der Pariser Universität als verpflichtend. Die daraus resultierende intellektuelle Ablösung der Artisten von den Grundsätzen des christlichen Glaubens stellte jedoch weiterhin ein Problem dar und spitzte sich gegen Ende der 60er Jahre des 13. Jahrhunderts abermals zu. Das Ergebnis waren zwei weitere durch Bischof Étienne Tempier initiierte Verbote in den Jahren 1270 und 1277, wobei im Zuge des letzten Verbotes auch der Papst intervenierte und 219 Sätze und Aussagen verbieten ließ, die zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Aristoteles betrafen (u. a. waren auch Schriften des Thomas von Aquin unter den verbotenen Texten).20
Die Aneignung der aristotelischen Schriften erfolgte weitgehend über die Bearbeitungen arabischer Kommentatoren wie Avicenna (ca. 980–1037)21 und Averroes (ca. 1126–1192)22, die bis ins 16. Jahrhundert für die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens in Westeuropa von großer Wichtigkeit waren. Auch jüdische Gelehrte wie Moses Maimonides (ca. 1135–1204)23, der von der Erkennbarkeit Gottes in der Physik, die er über die Genesis legitimiert sah, überzeugt war, übten erheblichen Einfluss auf die christlichen Lehren aus. Der aufkeimende Aristotelismus im 13. Jahrhundert brachte eine entscheidende Veränderung der Welt des Wissens in Westeuropa mit sich, die eine Verlagerung der naturphilosophischen Erkenntnis weg von der Theologie hin zur Philosophie zur Folge hatte. Die Rezeption der Schriften des Aristoteles verstärkten das Interesse an der Natur und damit auch an Physik und Metaphysik, wobei in weiterer Folge der daraus hergeleitete Gottesbegriff stark mit der Kosmologie verbunden wurde (das lässt sich auch an den Genesiskommentaren der Zeit erkennen). Albertus Magnus (ca. 1200–1280) war durch sein Vorhaben, die aristotelischen Schriften für den latei...