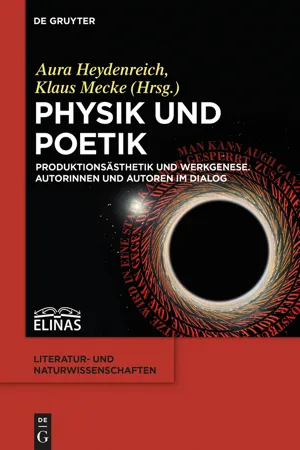
eBook - ePub
Physik und Poetik
Produktionsästhetik und Werkgenese. Autorinnen und Autoren im Dialog
- 320 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Physik und Poetik
Produktionsästhetik und Werkgenese. Autorinnen und Autoren im Dialog
Über dieses Buch
The series Literature and the Natural Sciences is published under the auspices of the Erlangen Research Center for Literature and Natural Science (ELINAS). Researchers from different academic disciplines pool their expertise and methodological know-how to examine how language is used in scientific research and how scientific forms of knowledge are negotiated in literature. The series is conceived as an interdisciplinary platform that reflects on the cultural significance of scientific and literary research, as well as on the rhetoric and ethics of research in the natural sciences more broadly.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Physik und Poetik von Aura Heydenreich, Klaus Mecke, Aura Heydenreich,Klaus Mecke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Deutsche Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Aura Heydenreich und Klaus Mecke
Librationen
Durs Grünbein im Dialog zu »Cyrano oder Die Rückkehr vom Mond« und »Vom Schnee oder Descartes in Deutschland«
HEYDENREICH: Sie gaben in einem früheren Interview mit Sabine Wilke und Anke Biendarra an, dass für Ihre poetologische Position die »naturwissenschaftliche Zeitgenossenschaft« von großer Bedeutung ist. Dass auch speziell die physikalische Forschung zu Ihrem Interessenfeld gehört, wird an zahlreichen poetischen und expositorischen Texten deutlich. Wie ist Ihr Interesse für die Physik begründet?
GRÜNBEIN: Heute würde ich als Erstes sagen, dass wir es uns in unserer Kultur, in unserem Zeitalter gar nicht aussuchen können. Die Physik ist da, sie hat sich in allen Bereichen durchgesetzt. Vor allem in der Praxis, da zwar oft unbemerkbar, aber doch in jedem Haushalt. Der Widerspruch, der mich oft beschäftigt hat, ist, dass wir von Geräten umgeben sind, deren Funktionsweise wir gar nicht mehr unmittelbar begreifen. Mein Lieblingsbeispiel war früher immer der Schallplattenspieler: Erklären Sie den Piezoeffekt! Das muss man aber nicht, wenn man zum Beispiel eine Schallplatte von den ›Doors‹ auflegt, denn dann hat man schon den gewünschten Effekt: Man hört die Musik und das reicht. Aber von diesen Geräten gibt es ja inzwischen immer feinere, sodass wir nun endgültig sagen können, dass wir auf das Funktionieren von technischen Geräten bzw. von physikalischen Effekten angewiesen sind. Wir merken das immer wieder, zum Beispiel beim Stromausfall, das ist die Ausgangslage. Ob ich mir das nun aussuche oder nicht, es ist so.
In meinem Fall war es so, dass ich aus einem Naturwissenschaftler-Haushalt komme. Mein Vater ist Physiker, Flugzeugbauer, Ingenieur und meine Mutter war in der Chemiebranche als Laborantin tätig. Dadurch herrschte zuhause ein naturwissenschaftlicher Diskurs, es gab eine sehr rationalistische Herangehensweise. Es wurde von mir sicherlich auch in gewisser Hinsicht das Gleiche erwartet. Mein Vater, der zuhause noch viel gebaut und gebastelt hat, hat mich zum Beispiel sehr früh in die Elektronik eingeführt. Sodass ich dann selbst ganz viel bauen und basteln musste. Ich bekam später einen Studienplatz, der ›Elektronische Bauelemente‹ hieß, den ich dann aber kurz vor Antritt des Studiums abgegeben habe. Ich hatte plötzlich unglaubliche Angst, dass das mein Leben sein sollte, weil ich in dieser Zeit und auch schon davor sehr intensiv für mich geschrieben hatte. Aber das stand auf einem völlig anderen Blatt und galt, wie es nun einmal so war, als Hobby, als interessante Beschäftigung. Es hieß: ›Interessant, der fällt so aus der Art, der schreibt ständig, aber davon will er hoffentlich kein Leben bestreiten.‹ Die erste große Lebensentscheidung kam mit den Fragen, die einen beschäftigen: Was willst du eigentlich die nächsten fünf Jahre studieren? Mit wem willst du zusammen sein? Was wird dich theoretisch beschäftigen? Ich wusste in diesem Moment: ›Elektronische Bauelemente‹ wollte ich nicht, und habe den Studienplatz abgegeben. Da setzte ein Bruch ein. In dem Moment habe ich mich entschlossen, Literatur- und Theatergeschichte zu studieren.
Verlassen hat mich das aber nie, es waren weiterhin im häuslichen Bereich viele Bücher zur Naturwissenschaft vorhanden. Ich weiß noch, dass ich mir die Lehrbücher meines Vaters, der Physik an der Technischen Universität in Dresden studiert hatte, immer wieder angeschaut habe. Mich hat auch eine Weile Flugzeugbau interessiert. Ich habe mir das immer gerne erklären lassen, wie Turbinen funktionieren. Irgendwann später, mit Mitte zwanzig, als ich viel in Bibliotheken unterwegs war, habe ich mir aus diesem Impuls heraus neben allen möglichen literarischen Werken – Kompendien, Anthologien, Zeitschriften etc. – naturwissenschaftliche Literatur ausgeliehen. Ich habe eine Zeit lang versucht, Richard Feynmans »Lectures on Physics« zu verstehen, aber da merkte ich schon, dass das Bereiche sind, in die man auch studienweise tiefer eindringen müsste. Ich schicke voraus, dass ich kein ausgebildeter Physiker oder Naturwissenschaftler bin. Ich habe Freunde, die das sind, die auch künstlerisch arbeiten. Filmemacher, die nebenbei eine Ausbildung in Quantenphysik haben. Das führt natürlich auch zu ganz anderen Ergebnissen, auch in dem jeweiligen Feld.
HEYDENREICH: Wie sehen Sie die Dreier-Relation Lyrik-Natur-Physik, in der die Letztere als Wissenschaft von der Natur fungiert? Lässt sich eine Verschiebung des Interesses feststellen – von der Beschäftigung mit der phänomenalen Natur zur Beschäftigung mit der Frage, welche Erkenntniszugänge es zu ihr gibt und welche Darstellungsmodelle es von ihr gibt? Sodass die Wissenschaften zunehmend in den Vordergrund rücken?
GRÜNBEIN: Man findet nach dem Zweiten Weltkrieg einzelne Manifeste der europäischen Neoavantgarden – zum Beispiel italienische –, an denen deutlich wird, dass in den Hauptwerken einzelner Vertreter eine solche Verschiebung stattgefunden hat. Zum Beispiel dringt die Linguistik sehr massiv in die Literatur ein. Aber eben auch die ›Neue Physik‹: Die einzelne Vertreter absolvierten ein Parallelstudium oder suchten diese Verbindung auf autodidaktische Weise. Dadurch veränderten sich schlagartig auch das Vokabular und die Konzepte der Literatur. Gerade an der Nachkriegslyrik, an der reinen Versdichtung, kann man das gut studieren. Da wird es auch noch deutlicher als in der Prosa, wenn zum Beispiel in den Texten jedes romantische, klassizistische Kalkül abgestreift wird und die naturwissenschaftlichen Begriffe auf einmal nackt da stehen oder Ausgangspunkt für Texte sind. Man sieht deutlich, dass das eine Entwicklung gewesen ist, die jetzt schon wieder verblasst. Das war wirklich ein Nachkriegspathos, auch um gegenüber allem Vorherigen einen Bruch zu setzen. Es standen ja damals Ideen im Raum, die sagten, dass die große politische Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts auch eine sprachliche gewesen sei: eine Katastrophe der verblassenden Mythologeme, des unklaren Denkens schlechthin, und je mehr die theoretische Naturwissenschaft auch in das künstlerische Denken Einzug halten würde, umso besser. Solche Momente findet man in der konkreten Poesie, aber eben auch in allen sonstigen literarischen Experimenten. Da fällt mir das Stichwort ›Neoavanguardia‹ ein und deren Vertreter Edoardo Sanguineti und Andrea Zanzotto. Es gab plötzlich Dichter, die eine enge Nähe zur Mathematik suchten. Die berühmte ›Bourbaki-Gruppe‹, bei der plötzlich auch Lyriker dabei waren – das sind wohl die extremsten Fälle.
MECKE: Und wer war das in Deutschland?
GRÜNBEIN: In der deutschen Sprache spielt das bei Gerhard Rühm wohl eine gewisse Rolle. Vielleicht auch in der ›Wiener Schule‹ bei Einzelnen, zum Beispiel bei Konrad Bayer. Ganz sicher auch bei solchen Vertretern wie Oswald Wiener.
HEYDENREICH: UndMaxBense?
GRÜNBEIN: Max Bense ist natürlich unbedingt zu nennen. Obwohl ich ihn immer eher als Essayisten und Theoretiker sehe. Ich weiß, er hat ganz eigene konkrete Experimente gemacht. Aber er ist als Theoretiker in dieser Hinsicht wichtig. Zunächst einmal ist mir eine Differenz aufgefallen, dass die Texte, die er über Gottfried Benn publiziert hat, anders sind, als die steilen konzeptuellen theoretischen Texte, in denen er selbst diktiert, wie die neue Poesie aussehen soll. Für viele war natürlich Gottfried Benn ein ›Nestor‹ dieses Denkens. Die Personalunion von Naturwissenschaftler und Autor geht im zwanzigsten Jahrhundert natürlich viel früher los: Wir haben interessanterweise vor allem viele Fälle von schreibenden Ärzten, wie zum Beispiel Alfred Döblin oder Gottfried Benn, das scheint mir kein Zufall, sondern eine richtige Konstante zu sein. Dieses Kalkül für die Erzählliteratur, das sieht man schon seit Flaubert. Da geht es darum, das literarische Material so exakt und kalt zu behandeln, ebenso studienmäßig, wie die Natur. Aus dem, was früher einmal ein Charakter war, eine Romanfigur, wird auf einmal eine richtige psychologische Studie nach allen Regeln der sich entwickelnden Psychologie und dann später auch der Psychoanalyse. Das gilt für den Erzählbereich.
In der Poesie sind es hingegen eher die Konzepte der Sprache, die sich ändern, beispielsweise die Übernahme naturwissenschaftlicher Terminologie, selbst wenn die gar nicht so große Berechtigung hat, aber sie wird zunächst einmal aufgenommen und als Material eingesetzt. Aber es geht auch bis hin zu einer Änderung im Konzept: Zum Beispiel setzt serielles Schreiben ein, analog zu Forschungsfeldern in den Naturwissenschaften. Es wird plötzlich auf Ausschnitte fokussiert, die zuvor für die Poesie nie allein wichtig waren. Nach dem Krieg ist zu beobachten, dass der Input aus vielen Bereichen kommt. Aus der Statistik ebenso wie aus der neuen Ethnologie, der Psycholinguistik, der Kybernetik – was dann Oswald Wiener interessiert hat –, aus der neuen Mathematik. Aber eben in einzelnen Fällen auch aus der Theoretischen Physik. Ich weiß auch von vielen heutigen zeitgenössischen Autoren, dass es bei vielen ein Grundinteresse dafür gibt. Die Frage ist, wie sich das auf den Text durchschlägt – ob es ein allgemeines Interesse ist oder ob es tatsächlich eine Rolle spielt und das Denken oder das Schreiben als solches ändert.
Physik im kulturellen Spannungsfeld
MECKE: Die Literatur bietet die Möglichkeit, Widersprüche der spezialisierten wissenschaftlichen Expertendiskurse aufzudecken und ihre Relevanz für den menschlichen Erlebnishorizont zu unterstreichen. In welchen kulturellen Spannungsfeldern, die für die Dichtung von Relevanz sind, verorten Sie die Physik?
GRÜNBEIN: Da muss ich eine Gegenfrage stellen: Verstehen sich denn die Naturwissenschaftler untereinander?
MECKE: Im Detail schon.
GRÜNBEIN: Verstehen sich Quantenphysiker und Genbiologen tatsächlich? Ich kann ein schönes Beispiel erzählen. Es war ein großes Privileg, aber auch die Belohnung für mich selbst, als ich in den Orden ›Pour le merite‹ aufgenommen wurde, der sich zweimal im Jahr trifft. Das ist ein interessantes Gremium, denn es besteht zu einem Drittel aus Naturwissenschaftlern, einem Drittel aus Geisteswissenschaftlern und einem Drittel aus Künstlern. Bei den Naturwissenschaftlern ist ein sehr hoher Anteil an Nobelpreisträgern vertreten. Man hat immer zwei, drei Tage lang in sehr ruhiger und lockerer Atmosphäre sehr interessante Koryphäen vor sich, und alle sind aneinander sehr interessiert. Es finden Vorträge, Führungen etc. statt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass auch bei den Naturwissenschaftlern die jeweiligen Konzepte der anderen erklärungsbedürftig sind. Es versteht sich nicht von selbst, dass der Quantenphysiker weiß, was die Entwicklungsbiologin gerade macht. Das muss sie ihm erklären, und umgekehrt lässt sie sich erklären, was gerade im Teilchenzoo los ist. Obwohl die Vorträge auf hohem Niveau sind, müssen die Vortragenden vermittelnd ansetzen, um alle Hörer mitzunehmen. Also habe ich festgestellt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass sich die Naturwissenschaftler untereinander gut verstehen, weil sie auf verschiedenen Feldern und mit regelrecht verschiedenen Sprachanwendungen arbeiten.
MECKE: Nun gut, es gibt immer noch die gemeinsame Verständigungsbasis. Methodisch ist man relativ schnell beieinander.
GRÜNBEIN: Mir ist aufgefallen, dass durchaus frecher argumentiert wird. Es kann schon vorkommen, dass Wissenschaftler X zu Wissenschaftler Y meint: ›Eure Experimentalanordnung leuchtet mir gar nicht ein.‹ Das fand ich großartig, weil es mir zeigte, wie bedingt die Wissensproduktion ist. Das ist natürlich immer von den Institutionen abhängig und kann sich in vier Jahren wieder ändern, dann würdeman keineForschungsgelder mehr in diejeweiligeSachepumpen. Das können aber Naturwissenschaftler untereinander sehr viel schneller bemerken, sie sind da offensiver und machen Vorschläge, worüber die anderen forschen sollten.
Wenn wir bei der Entwicklungsbiologie sind: Das ist ein Gegenstand, der allgemein Interesse erzeugt. Da wird richtig experimentiert, am Naturgegenstand werden richtige Versuchsreihen aufgebaut. Ich habe das Gefühl, dass in der Physik die Beobachtung dessen wichtig ist, was in der Materie schon da ist. Die Genforscher hingegen, die manipulieren kräftig mit, und das meine ich wertfrei. Das ist eine völlig andere Perspektive. Stellen Sie sich vor, der Physiker würde versuchen, an der Materie zu manipulieren – aber er kann es nicht, denn er weiß, dass es Konstanten gibt, er muss weiterhin den Bau begreifen.
MECKE: Viele theoretische Physiker arbeiten anwendungsfern. Sie haben eher ein Erkenntnisinteresse und nicht ein technisches Interesse.
GRÜNBEIN: Genau. In der ganz ruhigen Zone sind die Mathematiker. Wir haben im Orden ›Pour le merite‹ zwei Mathematiker. Yuri Manin zum Beispiel ist ein leidenschaftlicher Leser, Schreiber und Übersetzer von Poesie. Mit ihm sitzen wir manchmal da und reden verstohlen über eine angebliche Nähe der Mathematik zur Poesie. Einig sind wir uns darin, dass man am anwendungsfernsten von allen, am meisten an einem Glasperlenspiel beteiligt ist.
Die Frage wäre jetzt also: Welche Widersprüche gibt es innerhalb der spezialisierten wissenschaftlichen Expertendiskurse? Die Literatur könnte das meines Erachtens aufdecken. Die erzählende Literatur zeigt das natürlich besonders gerne an einzelnen Fällen, auch indem sie diese Widersprüche anprangert. Das hatten wir zum Beispiel in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, als es Klagediskurse gegen die Naturwissenschaften gab. Die Relevanz der Naturwissenschaften für den menschlichen Erlebnisund Erfahrungshorizont, die steht außer Frage, die Menschheit tut da ja insgesamt nichts Unvernünftiges. Nur oft sehr kühne Sachen, bei denen es den Beteiligten oft auch ziemlich unbehaglich wird, was da ausgelöst wird. Wie lange hatten wir einen Atomkraft-Diskurs, bis hin zu apokalyptischen Erwiderungen? Jetzt ist dieser interessanterweise aus der Phantasie der Schriftsteller wieder weitestgehend verschwunden. Auch Fukushima konnte das nicht wirklich neu beleben. Man sollte vielleicht den Faktor Gewöhnung nicht unterschätzen. Die Menschheit gewöhnt sich enorm auch an ihre Katastrophen.
Zum Experimentcharakter von Physik und Poesie
HEYDENREICH: Im Gegensatz zur Gewöhnung steht ja das Experiment. So zitieren Sie in Ihrem Essay »Der cartesische Taucher« Marcel Proust: »Für den Schriftsteller ist ein Eindruck, was für den Wissenschaftler ein Experiment – mit dem Unterschied, daß im Falle des Wissenschaftlers die Tätigkeit der Intelligenz dem Ereignis vorangeht, während sie im Falle des Schriftstellers nachfolgt« (Der cartesische Taucher, 93; im Folgenden: CT). Gibt es Gemeinsamkeiten im Experimentcharakter derPhysik und der Poesie?
GRÜNBEIN: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich war froh, dass ich dieses Zitat in der riesigen »Ä la recherche du temps perdu« eines Tages fand. Proust ist für mich deshalb so ein interessanter Gegenstand, weil er mit seinem größten Lebensprojekt, der »Recherche«, etwas zu beweisen scheint – nämlich, dass es möglich ist, zumindest psychisc...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Dialogisches Denken
- Auf der Suche nach Sprache
- Librationen
- Fiktionen, Simulationen, Dialoge. Erkenntnisstrategien in Wissenschaft, Erzählung und Philosophie
- Evolution im Comic
- Horizonte der Einsamkeit
- Die Zeit ist der Abgrund, in den wir fallen
- Sokratische Dialoge
- Romane schreiben wäre eine Lösung. Über die Vernetzung von Naturwissenschaft und Literatur
- Physik und Ethik
- Anhang
- Interviewer
- Index
- Fußnoten