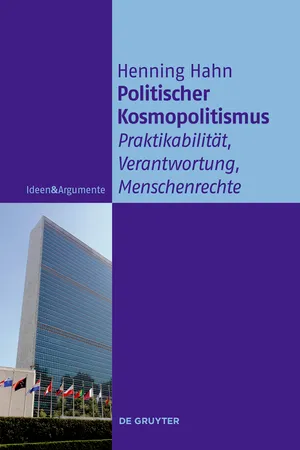1.1Politische Philosophie zwischen Versöhnung und Kritik
Einleitend habe ich behauptet, dass eine ‚gute‘ Theorie der Gerechtigkeit moralisch akzeptabel und politisch praktikabel sein muss. Sie braucht kein freistehendes Gerechtigkeitsideal begründen, sondern sollte eine transitorische Perspektive eröffnen, die am normativen Selbstverständnis der Betroffenen und ihrem persönlichen Verantwortungsbereich anknüpft. Ohnehin bin ich davon überzeugt, dass sich viele Differenzen zwischen partikularistischen und kosmopolitischen Ansätzen auf divergierende Zeitperspektiven zurückführen lassen.12 Es macht einen Unterschied, ob wir untersuchen, was hier und heute, mittelfristig oder unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit gerecht ist. Allgemein haben wir uns, denke ich, damit abzufinden, dass es unterschiedliche sinnvolle Antworten auf die Frage gibt, was wir von einer Theorie globaler Gerechtigkeit wollen.
Der prägnanteste Unterschied besteht meines Erachtens eher darin, ob eine Theorie eine kritische oder eine versöhnende Absicht verfolgt. Vereinfacht gesagt geht es versöhnungsphilosophischen Ansätzen darum, das Gerechtigkeitspotential einer gegebenen Wirklichkeit auf den Begriff zu bringen, während kritische Ansätze – nicht zu verwechseln mit der kritischen Theorie im engeren Sinne – eine Diskrepanz zwischen Gerechtigkeit und Wirklichkeit markieren. Kritische Ansätze beurteilen den Status Quo vom Standpunkt eines moralischen Gerechtigkeitsideals, versöhnungsphilosophische Ansätze hingegen anhand immanent gewonnener Standards. Statt die Welt an ein unabhängig gewonnenes Ideal anzupassen, geht es ihnen darum, unser begriffliches Verständnis davon, was Gerechtigkeit sein soll, mit der Welt in Einklang zu bringen. Zugespitzt formuliert ist dies der Unterschied zwischen einer kantischen und einer hegelianischen Sicht auf Gerechtigkeit.
Bevor ich mich diesen Traditionen im Einzelnen zuwende, möchte ich die entscheidende Differenz zwischen beiden noch einmal vertiefen. Dazu folge ich James Tully („Political Philosophy as a Critical Activity“, 2002), für den die Politische Philosophie ein unmittelbar politisches Anliegen hat. Sie verfolgt den praktischen Zweck, Machtverhältnisse zu kritisieren und politische Akteure zum Handeln zu aktivieren. Vergleichbar mit verwandten Praktiken – wie dem Halten einer politischen Rede – hat die Politische Philosophie das normative Selbstverständnis ihrer Adressaten und deren politische Möglichkeiten von Anfang an einzubeziehen. Die praktische Absicht versöhnungsphilosophischer Ansätze besteht auf der anderen Seite darin, die Art und Weise, wie wir uns begrifflich in der Welt zurechtfinden, an die Welt, wie sie ist, anzupassen. Im Grunde ist ihre Absicht therapeutisch. Sie versuchen nicht die Welt, sondern unseren Begriff von der Welt und damit die Art, wie wir sie erfahren, zu reformieren. Ihr Ziel besteht darin, eine als chaotisch, feindlich oder sinnlos erfahrene Wirklichkeit wieder als eine Welt verstehbar zu machen, in der wir sinnvoll – also im Einlang mit unseren Grundüberzeugungen – und selbstbestimmt tätig werden können.
Ich bezeichne diese Funktion als ‚therapeutisch‘, weil ihr praktischer Zweck darin besteht, ein pathologisch gewordenes Selbst- und Weltverständnis zu heilen.13 Solange wir der sozialen Welt, in der wir leben, keinen (begrifflichen) Sinn abgewinnen können, fühlen wir uns in ihr entfremdet, unfrei und deplatziert. Versöhnungsphilosophische Ansätze wollen uns dabei helfen, wieder in dieser Welt heimisch zu werden.14 Das Ohnmachtsgefühl, das sich angesichts der politisch unregulierten Globalisierung ausbreitet, ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit einer versöhnenden Perspektive. Es gibt ein verbreitetes Gefühl, dass die Globalisierung alternativlos und unregulierbar ist. Das schürt Frustration und Zynismus; schlimmstenfalls führt es zu Radikalisierung und krudem Nationalismus.
Ein Stück weit soll auch mein Ansatz unsere Sicht auf globale Gerechtigkeit verändern, indem er die bestehende Weltordnung als potentiell gerecht darstellt. Gleichwohl ist dieses Projekt nicht bloß konservativ. Die Darstellung der Wirklichkeit als Gerechtigkeit verfolgt zugleich eine kritische Absicht. Denn das Legitimationsversprechen des bestehenden Menschenrechtsregimes ist in weiten Teilen unabgegolten. Dadurch wird ein immanenter Standort für die Kritik an globalen Ungerechtigkeiten in Form verbreiteter Menschenrechtsmissachtungen eröffnet. Durchaus in Verwandtschaft zur kritischen Theorie besteht die praktische Absicht dieser Arbeit darin, die kritische und versöhnungsphilosophische Perspektive zusammenzuführen. Ohnehin handelt es sich dabei um eine idealtypische Unterscheidung zwischen zwei komplementären Anliegen. Eine Versöhnung mit der Wirklichkeit macht nur dann Sinn, wenn die Wirklichkeit nicht einfach abfotografiert, sondern auf eine Weise dargestellt wird, die Hoffnung auf mehr Gerechtigkeit macht.
Gegen den Versuch einer Aussöhnung mit dem politisch Möglichen werden eine Reihe ernstzunehmender Einwände erhoben. Der wichtigste betrifft die Frage, ob dadurch nicht die direction of fit zwischen Fakten und Normen verkehrt wird.15 Wir sollten die Welt an moralische Prinzipien und nicht diese Prinzipien an die Welt anpassen. Denn zumindest was unsere grundlegenden Prinzipien betrifft, dürfe das Kriterium politischer Praktikabilität den universellen Geltungsbereich und die zeitlose Autorität dieser Prinzipien nicht preisgeben. Darum seien Praktikabilitätsgründe erst dann angebracht, wenn es um die nachgeordnete Anwendung dieser Prinzipien geht. In jedem Falle dürften moralische Prinzipien nicht von zufälligen Realisierungsbedingungen abhängig gemacht werden. Denn das zöge die paradoxe Konsequenz nach sich, dass Gerechtigkeitsansprüche umso niederschwelliger würden, je ungerechter eine Gesellschaft ist. Faktisch unwillige oder bösartige Akteure würden gegenüber normenkonformen Akteuren gleichsam belohnt, wenn wir Gerechtigkeitsstandards an den tatsächlichen Realisierungschancen ausrichteten.
Glücklicherweise bin ich an dieser Stelle nicht gezwungen, ein längeres metaethisches Argument zu führen. Denn ich behaupte nicht, dass Fakten immer eine konstitutive Rolle bei der Konstruktion moralischer Grundprinzipien spielen (sollten). Was ich aber behaupte, ist, dass das Kriterium politischer Praktikabilität eine konstitutive Rolle spielt, wenn eine Gerechtigkeitstheorie eine explizit politische Absicht verfolgt. Unter dieser Voraussetzung ist es nicht nur konsistent, sondern sogar geboten, Fakten über die Einstellungen und Möglichkeiten der relevanten Akteure zu berücksichtigen. Wenn wir die Frage, was Gerechtigkeit ist, zunächst unabhängig von der Frage nach ihrer politischen Praktikabilität beantworten wollten, benötigten wir immer noch eine zusätzliche Theorie darüber, welche Konzessionen an die Praxis bei der Umsetzung zulässig sind; und das heißt im Grunde, dass die normative Kernarbeit dann von dieser zusätzlichen Theorie und nicht von der originären Gerechtigkeitstheorie geleistet wird. Um eine unüberbrückbare Kluft zwischen Theorie und Praxis zu vermeiden, gilt es, das Kriterium politischer Praktikabilität bereits im idealtheoretischen Teil, in dem wir klären, was Gerechtigkeit bedeutet, ernst zu nehmen.
In diesem Kapitel soll dieser Ansatz in der Auseinandersetzung mit drei klassischen Positionen weiter an Kontur gewinnen. Ich beginne mit Kants Philosophie des Weltbürgertums, an der das Grundproblem des moralischen Kosmopolitismus noch einmal klar vor Augen tritt (1.2). Kant entwickelt sein Ideal einer vollkommen gerechten Ordnung zunächst unabhängig von der Überlegung, wie es sich in realistischen (und akzeptablen) Zwischenschritten verwirklichen ließe. Damit erschafft er eine politisch unüberbrückbare Distanz zum politischen Status Quo. Dieses Problem wird auch dadurch nicht beseitigt, dass er in späteren Schriften auf die zweitbeste Theorie eines freiwilligen Völkerrechtsbundes einzuschwenken beginnt und diese in der Friedensschrift gezielt als transitorischen Zwischenschritt anlegt. Die Konzessionen an die Praxis, die Kant nun für angemessen hält, ließen sich im Rahmen seines moralischen Kosmopolitismus nur dadurch rechtfertigen, dass es sich um notwendige Schritte in Richtung einer vollkommenen weltbürgerlichen Vereinigung handelt. Allerdings, so mein Einwand, liegt dieses Ideal so weit entfernt, dass es sich nicht einmal als Fluchtpunkt für die transitorische Rechtfertigung praktikabler Zwischenschritte, ja, nicht einmal als regulative Idee eignet.
In der anschließenden Auseinandersetzung mit John Rawls und Axel Honneth stoßen wir dann auf die gesuchten Ansatzpunkte für eine immanente Kritik. Bei John Rawls ist dies die Idee einer realistischen Utopie, womit er Kants Vorschlag einer freiwilligen Völkerrechtsordnung auf eine neue Grundlage stellt (1.3.). Es ist nahe liegend, Rawls’ Entwurf als einen normativen Leitfaden für die Außenpolitik liberaler Staaten zu lesen. Entscheidend ist, dass der Gerechtigkeitssinn liberaler Völker nicht bei Fragen internationaler Stabilität endet, sondern dass er die Ächtung schwerer Menschenrechtsverletzungen und eine Hilfspflicht gegenüber schwerer Armut umfasst. In einem hypothetischen Vertrag würden liberale Völker globalen Verfassungsgrundsätzen zustimmen, die so minimal sind, dass sie auch von nicht-liberalen Staaten geteilt werden. Diese gemeinsame Völkerrechtsordnung präsentiert kein moralisches Ideal globaler Gerechtigkeit, sondern ein dem Kriterium politischer Praktikabilität folgendes Konstrukt, eben eine realistische Utopie, „which connects with the deep tendencies and inclinations of the social world“ (Rawls 1999, 128).
Trotzdem handelt sich Rawls in seiner Unterscheidung zwischen idealer und nichtidealer Theorie dasselbe Problem ein, das schon der moralische Kosmopolitismus nicht lösen konnte. In seiner Begriffssetzung formuliert der ideale Theorieteil einen vollkommen gerechten Endzustand, während der nichtideale Theorieteil zielführende Zwischenschritte festlegen soll. Es wird aber immer unklar bleiben, ob und wie sich einzelne Entscheidungen in Richtung des langfristigen Ideals auswirken – womit die Rechtfertigung für notwendige Konzessionen an die Praxis verloren geht.
Allerdings betrifft dieser Einwand allein Rawls’ internationale Theorie und hier auch nur eine bestimmte Lesart von dieser. In einem zweiten Schritt werde ich eine alternative Interpretation vorstellen, die diesen Einwand entkräftet. Diese Interpretation beruht auf einer versöhnungsphilosophischen Deutung von Rawls’ politischer Gerechtigkeitskonzeption. Demnach ginge es ihm nicht um die Rechtfertigung eines zukünftigen Gerechtigkeitsideals, sondern um die Versöhnung des liberalen Gerechtigkeitssinns mit der bestehenden Völkerrechtsordnung. Gesetzt, dass diese Deutung zutrifft, hätte Rawls seinerseits ein therapeutisches Anliegen verfolgt. Er zeigt, wie die bestehende Völkerrechtsordnung in Einklang mit dem Selbstverständnis liberaler Völker gebracht werden kann. Auf der anderen Seite eröffnet diese Lesart aber auch neue Ansatzpunkte für die Kritik an seiner antikosmopolitischen Haltung. Insgesamt meine ich, dass die versöhnungsphilosophische Interpretation Rawls’ Intention besser gerecht wird; fest steht aber auch, dass Rawls’ Völkerrechtstheorie unter ihren eigenen Voraussetzungen kosmopolitisch erweitert werden muss.
In der abschließenden Auseinandersetzung mit Axel Honneths Methode des normativen Rekonstruktivismus finde ich dann einen Weg, um die Balance zwischen Versöhnung und Kritik klarer auszudrücken (1.4.). In versöhnungsphilosophischer Absicht geht es Honneth darum, die Wirklichkeit als einen (ihrem Anspruch nach) gerechten Ort begreifbar zu machen. Auf der Rekonstruktion dieses immanenten Gerechtigkeitsanspruchs basiert dann wiederum seine immanente Gesellschaftskritik: Moderne Institutionen geben ein sie legitimierendes Versprechen von Freiheit und Gerechtigkeit, das immer wieder eingefordert und erkämpft werden muss. Während Honneths Rekonstruktion aber beim demokratischen Rechtsstaat stehen bleibt, schlage ich vor, seine Methode auf die Rechtfertigungsnarrative globaler Herrschaftsorgane zu übertragen. Meine These lautet, dass uns diese Rekonstruktion auf die realistische Utopie eines globalen Menschenrechtsregimes führt, eine Utopie, die genügend kritische Kraft in sich birgt, um globale Ungerechtigkeiten zu kritisieren, zugleich aber realistisch genug ist, um Gerechtigkeitsforderungen in politische Verantwortung und konkrete Handlungen umzumünzen.
1.2Die Aporie des moralischen Kosmopolitismus: Immanuel Kant
„Kaum ein Jurist, Philosoph oder Politikwissenschaftler formuliert heute eine Position zu Krieg und Frieden, zur Ausbreitung demokratischer Herrschaft, zu globalen Institutionen, zu Frieden und Menschenrechtsschutz oder zu kosmopolitischen Ansprüchen, ohne sich zumindest zu Kants Auffassungen in Beziehungen zu setzen.“16 Dieser Einschätzung, die Oliver Eberl und Peter Niesen in ihrem Kommentar Zum ewigen Frieden (2011) geben, ist kaum etwas hinzuzufügen. Auch ich werde wesentliche Motive des politischen Kosmopolitismus in Auseinandersetzung mit, letztlich aber in Abgrenzung zu Kant entwickeln.
Auf den ersten Blick scheint es wenig Grund zu geben, Kants ideengeschichtliche Innovationen auf dem Gebiet der kosmopolitischen Philosophie noch einmal hervorzuholen.17 Sein Beitrag ist genauer aufgearbeitet worden, als ich es im Rahmen einer systematischen Erörterung leisten kann. Auch besteht kein Anlass, seinen tatsächlichen Einfluss auf die gegenwärtige Theoriebildung überzubewerten. In der Diskussion um globale Gerechtigkeit ist Kant zwar omnipräsent, häufig dient er aber lediglich als historisches Vorbild für eine universalistische Moral oder für die Idee einer kosmopolitischen Verrechtlichung. Zwar beruft sich Rawls explizit auf Kant, im Grunde fällt er aber weit hinter dessen Forderung nach einem Weltbürgerrecht zurück (vgl. 1.3).18
Erst in jüngster Zeit hat die Diskussion um globale Gerechtigkeit eine Wendung genommen, die es noch einmal lohnenswert macht, Kants kosmopolitische Schriften durchzusehen. Wie einleitend erläutert, geht es um die Frage nach dem Verhältnis von idealer Theorie und politischer Praxis, die mit Blick auf globale Gerechtigkeit besondere Schwierigkeiten zu berücksichtigen hat. Dazu zählen …
…erstens, ein Mangel an politischen und juridischen Institutionen zur Bestimmung, Zuschreibung und Durchsetzung kollektiver Pflichten (das assurance-Problem);
…zweitens, die große Zahl unterschiedlich eingestellter Akteure, die in multifaktoriellen Handlungssystemen interagieren, was die Vorhersag...