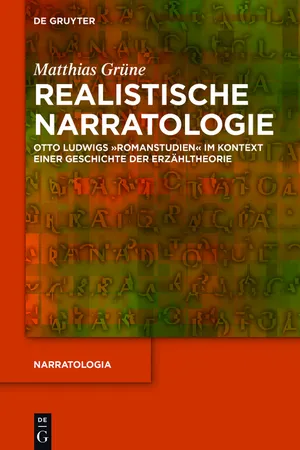1Einleitung
Das Erzählen ist überhaupt eine sehr
schweere Sache
Johann Georg Sulzer
Otto Ludwigs Romanstudien sind ein Produkt des Zweifels. Dabei entstanden sie zu einer Zeit, in der ihr Autor eigentlich allen Anlass für Zuversicht gehabt hätte. Mitte der 1850er Jahre war Ludwig im literarischen Deutschland kein Unbekannter mehr: Nach Jahren vergeblichen Bemühens und zahlreicher Fehlschläge war es ihm schließlich gelungen, mit der Tragödie Der Erbförster (1853) eines seiner Theaterstücke auf die Bühne zu bringen. Mehr noch, die Uraufführung dieses Stückes am Dresdner Hoftheater im März 1850 hatte ihn schlagartig und überregional bekannt gemacht. Von da ab galt der Thüringer ungeachtet seiner fast vierzig Jahre als eines der bedeutendsten Talente der deutschen Literatur. In seinen Dramen erkannte man trotz mancher Spuren fehlender Reife ein großes künstlerisches Potenzial. Gleiches gilt für die umfangreichen Erzählungen Die Heiteretei (1855–1856) und Zwischen Himmel und Erde (1856), die Ludwig selbst nur als Nebenproduktionen ansah, die von der Kritik aber vor allem aufgrund der fein nuancierten psychologisierenden Erzählweise mit Interesse aufgenommen wurden.1 In seiner Besprechung dieser Texte für die Grenzboten äußerte Julian Schmidt die optimistische Prognose, der Name des Autors könne bald „unter den besten unserer Literatur genannt werden“, so denn „die Gunst des Himmels, die Ludwig vielleicht mehr als irgend einen andern deutschen Dichter befähigt hat, starke Leidenschaften, düstere und heitere Stimmungen mit hinreißender Kraft zu versinnlichen, ihm das Glück verleih[t], ein harmonisches Gebilde zu schaffen“ (1857, 412).
Die Gunst des Himmels blieb jedoch aus. Bis zu seinem Tod im Jahr 1865 veröffentlichte Ludwig keinen einzigen Text mehr. Seine ganze Arbeitskraft verwendete der gesundheitlich angegriffene Autor stattdessen auf unermüdliche theoretische Studien. Die Aufmerksamkeit richtete er dabei hauptsächlich auf das Drama, für das er sich berufen fühlte. Dem Bedürfnis folgend, seine Produktion insgesamt auf ein gesichertes theoretisches Fundament zu stellen und dabei die Grenzen und Spielräume der jeweiligen Gattungen stärker zu berücksichtigen, kam Ludwig aber auch immer wieder auf Fragen der Roman- und Erzähltheorie zurück; zwei Hefte mit dem Titel „Romanstudien“ enthalten den wesentlichen Teil seiner diesbezüglichen Beobachtungen und Reflexionen.2 In allen diesen Studien sah Ludwig zunächst nicht mehr als einen Zwischenschritt in seiner künstlerischen Entwicklung. Sie sollten ihm dazu dienen, die formalen und stilistischen Unsicherheiten, die seine früheren Arbeiten auch in seinen Augen verrieten, endgültig zu überwinden. Im April 1856 schrieb er in einem Brief an Moritz Heydrich, seinen Freund und späteren Herausgeber der Shakespeare-Studien (1872), dass er den „Dichtdrang“ wieder in sich erwachen spüre, der nötig sei, ihn über die „Kluft“ zwischen Theorie und Praxis wieder „zurückzuflügeln“ und ihn von dem „fingerdick auf den Flügeln“ liegenden „Abstraktions- und Reflexionsstaub“ reinzuwaschen (zit. n. Stern 1906 [1891], 324). Die Hoffnung aber erfüllte sich nicht, der ,Reflexionsstaub‘ legte sich immer dichter um ihn und ließ ihn den Weg zurück zur Praxis nicht mehr finden.
Produktiv war Ludwig in dieser Zeit durchaus, wenn auch nicht in dem von ihm gewünschten Sinn. Seine tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, in denen sich allgemeine poetologische Betrachtungen mit Notizen zu eigenen Projekten abwechseln, wuchsen zu voluminösen Konvoluten heran. Angesichts der schieren Menge stellt sich die Frage, ob Ludwig eigentlich sein künstlerisches Leistungsvermögen über- oder nicht vielmehr seine Begabung zur kritischen Reflexion und systematisierenden Analyse unterschätzt hat. Denn möglicherweise überragt seine Leistung auf dem Gebiet der Theorie den Wert seiner literarischen Arbeiten. Mit Wolfgang Preisendanz (1977 [1963], 69) kommt immerhin einer der führenden deutschen Realismusforscher des zwanzigsten Jahrhunderts zu dem Ergebnis, dass Ludwig „heute weniger durch seine Dichtungen als durch seine ausgedehnten und intensiven […] Studien über Wesen und Struktur der dramatischen und der epischen Dichtung interessiert“. Dieses Urteil mag übertrieben sein angesichts der Tatsache, dass noch rezente Forschungsbeiträge zum Realismus ihr Epochenkonzept am Beispiel von Ludwigs Erzählung Zwischen Himmel und Erde entwickeln.3 Dennoch ist Preisendanz’ Wertschätzung der theoretischen Arbeiten nachvollziehbar, insbesondere wenn man nicht nur den Umfang, sondern auch Form und Gehalt der Aufzeichnungen berücksichtigt. Bemerkenswert ist bereits ihr unabgeschlossener, tentativer und mitunter erratischer Charakter. Sie dokumentieren Ludwigs Hang zum beständigen Neuansetzen der Denkbewegung und zur Hinterfragung bereits gewonnener Positionen. Ludwigs Zeitgenossen und die ältere Forschung sahen darin eine „allzupeinliche Strenge“ (Stern 1891, 28). Aus heutiger Sicht aber kommt es den Texten zugute, dass ihnen bei allem Bemühen um Systematik und feste Grundsätze der dogmatische und erzieherische Gestus abgeht, den Widhammer (1972, 107) nicht ganz zu Unrecht an den Dokumenten des Programmrealismus kritisiert.
Von den programmatischen Schriften beispielsweise eines Julian Schmidt unterscheiden sich Ludwigs Aufzeichnungen aber noch in einem anderen Punkt: Sie enthalten in erster Linie Reflexionen über den Aufbau und die Struktur literarischer Texte in Abhängigkeit von den medialen Bedingungen dramatischer und erzählender Darstellung. Allgemeine Fragen nach dem Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit sowie den Zielen realistischen Schreibens, die Schmidt überwiegend beschäftigen, stehen nicht im Zentrum der Diskussion, sondern werden nur gelegentlich gestreift (vgl. Aust 2006, 70). Dessen ungeachtet hat sich die Forschung vorzugsweise mit diesen grundsätzlichen poetologischen Kommentaren auseinandergesetzt. Auf Resonanz ist so vor allem Ludwigs Begriff des „poetischen Realismus“ (STD 1, 458) gestoßen (vgl. u. a. Markwardt 1959, 257–258; Eisele 1976, 62–66; Preisendanz 1977 [1963], 69–71; Cowen 1985, 14–22; Aust 2000 [1977], 23–26), auch weil er sich als bündige Formel für die Verklärungsästhetik des deutschsprachigen Realismus im Gegensatz zum „kritischen“ Realismus anderer Nationen anbot (Müller, K.-D. 1981, 12).4 Dabei bleiben gerade Ludwigs programmatische Überlegungen, wie bereits Preisendanz (1977 [1963], 69–70) bemerkt, oft vage und allgemein, so dass sie außer einer losen Orientierung an der klassischen Tradition wenig über die Poetik des Verfassers und der Zeit aussagen. In der Tat lassen sich Bemerkungen wie die, der Dichter schaffe kraft seiner Phantasie eine Welt, die zwischen naturalistischer Kopie und wirklichkeitsleerer Abstraktion die Mitte halte, „in der der Zusammenhang sichtbarer ist als in der wirklichen“ und die „alle ihre Bedingungen, alle ihre Folgen in sich selbst hat“ (STD 1, 458), wohl ohne größere Schwierigkeiten auch in den Kontext goethezeitlicher Ästhetik einrücken. Möglicherweise geht noch nicht einmal der Begriff des poetischen Realismus auf Ludwig selbst zurück; zumindest hält es Clifford Albrecht Bernds (1995, 142) für denkbar, dass Ludwig ihn – vermittelt über Julian Schmidt – aus der skandinavischen Realismusdiskussion übernimmt.
Wenn man sich hingegen den dramen- und erzähltheoretischen Analysen Ludwigs zuwendet, ergibt sich ein anderes Bild. Wobei seine Erzähltheorie die dramentheoretischen Studien an konzeptueller Originalität noch übertrifft. Denn in der Dramenpoetik bleibt Ludwig im Ganzen doch stark dem Vorbild Shakespeares verhaftet, was die systematische Relevanz und Aussagekraft seiner im Einzelnen bemerkenswerten Beobachtungen einschränkt. In den Romanstudien ist der Untersuchungsfokus hingegen deutlich breiter; zudem stehen die präferierten Autoren, Walter Scott und Charles Dickens, Ludwig historisch näher und ihre Werke werden nicht in gleicher Weise wie Shakespeares Tragödien zu überzeitlich verbindlichen Mustern erhoben. In seinen Urteilen und Analysen zeigt sich Ludwig darum weit unabhängiger von der poetologischen Tradition. Um ein Beispiel herauszugreifen: Für seine Typologie der Erzählformen (,eigentliche‘ vs. ,szenische Erzählung‘), die verschiedene Untersuchungskriterien wie Erzählperspektive, Erzählertyp oder narrative Distanz integrativ zusammenführt, gibt es keinen theoriegeschichtlichen Vorläufer (RS 654–657). Diese Bereitschaft zur konzeptuellen Innovation ist für die Romanstudien insgesamt charakteristisch. Seine Argumentation stützt Ludwig darin selten auf Autoritäten, die Erzähltheorien der Klassik und der idealistischen Ästhetik stellen für ihn keine verbindlichen Orientierungsrahmen dar.
In den Romanstudien gewinnen Ludwigs theoretische Vorstellungen deshalb am deutlichsten ein eigenes, historisch markantes Profil. Paradoxerweise ist es zugleich der Text, in der seine Theorie am aktuellsten erscheint, denn er berührt viele Anliegen der modernen Literaturtheorie (vgl. Steinecke 1984, 31). Nicht nur mit seiner Theorie der Erzählformen, auch mit den Reflexionen über die Spannungserzeugung, über die Stellung des Erzählers, über die Funktion des Helden, über den Zusammenhang von Figur und Raum oder die Charakteristika des erzählten Dialogs spricht Ludwig Themen von genuin narratologischem Interesse an. Er reflektiert mit anderen Worten über Probleme der allgemeinen Erzähltheorie auf der Basis der poetologischen und denkgeschichtlichen Prämissen des Realismus. Die Romanstudien, so könnte man sagen, enthalten eine realistische Narratologie.
Die Forschung ist bisher an der Frage vorbeigegangen, wie beide Seiten zusammenpassen. Sie hat nicht erhellt, worin der historische Gehalt, worin die aktuelle Relevanz von Ludwigs Erzähltheorie liegt.5 Darüber hinaus fehlen vergleichende Darstellungen zu den Beziehungen zwischen den Romanstudien und den erzähltheoretischen Beiträgen anderer Autoren der Epoche wie Friedrich Spielhagen oder Berthold Auerbach. Die Erzähltheorie des Realismus ist mit anderen Worten bisher ein weitgehend unbestelltes Forschungsfeld. Dieses Desiderat erklärt sich zum einen aus der Schwerpunktsetzung der Realismusforschung, die sich vorwiegend auf die ideologische und epistemologische Grundsatzkritik am realistischen Programm konzentriert hat (a); zum anderen lässt es sich aber auch auf den Umgang der modernen Narratologie mit ihrer eigenen Geschichte zurückführen (b).
(a) Die Literaturtheorie des Realismus steht in keinem guten Ruf. Die Einschätzung René Welleks (1974 [1965], 433), realistische Theorie sei „schlechte Ästhetik“, hat Rudolf Helmstetter (1998, 236) mit der Behauptung überboten, sie sei im Grunde genommen überhaupt keine Ästhetik, weil sie im Banne eines fragwürdigen Objektivitätsideals die Eigenwertigkeit ästhetischer Verfahrensweisen negiere. Auch Forschungsbeiträge, die zu einem ausgewogeneren Urteil kommen, betonen zumindest, dass die programmatischen Texte kaum dazu beitragen, die bedeutenden literarischen Leistungen der Epoche zu verstehen. Demgemäß relativiert Helmuth Widhammer (1972, 2–3) die Ergebnisse seiner wichtigen Abhandlung über die Literaturtheorie nach 1848 mit dem Hinweis auf die „Entfremdung“ von Theorie und Praxis. Einen Beleg für diese Annahme sieht er darin, dass die kanonischen Autoren dem Theoretisieren skeptisch bis ablehnend gegenübergestanden und nur „poetae minores“ wie Otto Ludwig oder Gustav Freytag poetologische Schriften in größerem Umfang hinterlassen hätten (Widhammer 1972, 7). Diese Beurteilung hat sich in der Realismusforschung über alle theoretischen und methodologischen Differenzen hinweg relativ konstant gehalten.6
Der angebliche Mangel an überzeugenden Beiträgen zur realistischen Theorie wird mitunter als Symptom einer allgemeinen Theoriemüdigkeit gedeutet, die sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts als Gegenreaktion zum Spekulationsbedürfnis des Idealismus erkennen lässt (Kinder 1973, 166; Widhammer 1972, 24–29; Bucher et al. 1981, 36). Der Hauptvorwurf, den die Forschung immer wieder gegen die Wortführer des realistischen Programms erhoben hat, bezieht sich aber nicht auf die Theoriemüdigkeit oder Spekulationsskepsis an sich, sondern vielmehr auf das uneingestandene Festhalten an den Prämissen der vordergründig abgelehnten idealistischen Ästhetik: „Die Spekulation wurde abgelehnt, aber ihre Ergebnisse wurden übernommen. […] Wie die geschichtsphilosophischen, so wurden auch die ästhetischen Vorstellungen des Idealismus an den Realismus weitergegeben“ (Bucher et al. 1981, 37; vgl. Aust 2006, 65). Damit verbunden ist der Vorwurf des Rückzugs in einen epigonalen und noch dazu unreflektierten Klassizismus, der die Auseinandersetzung mit der sozialen Realität meidet. Statt an der „zeitgenössischen Wirklichkeit“ hätten sich die Programmrealisten an den „Erfordernissen eines idealistisch vorgeprägten Kunstbegriffs“ orientiert (Widhammer 1972, 64).7
Konjunktur hatte diese Sichtweise im Kontext einer ideologiekritischen Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Liberalismus in den 1970er Jahren. Doch auch in neueren Arbeiten, die nicht mehr unmittelbar diesem Zusammenhang entstammen, wird die Kritik am Verfehlen der ,eigentlichen‘ Wirklichkeit wiederholt. In weitgehender Übereinstimmung dazu heißt es etwa bei Gerhard Plumpe (2003, 221): „Der Realismus des 19. Jhs. hat nicht etwa die ,Wirklichkeit‘ seiner Zeit zum Thema gemacht; ihm lag vielmehr ein voraussetzungsvolles ästhetisches Programm zugrunde, das die Konstruktion literarischer Realitäten konditionierte“. Plumpe geht davon aus, dass die Literatur nach 1850 ihren eigenen Referenzanspruch angesichts der gestiegenen Komplexität moderner Welterfahrung – er spricht von einer „bodenlos kontingenten modernen Wirklichkeit“ (1985, 263) – nicht mehr habe erfüllen können und stattdessen in eine „innerliterarische Umweltsimulation“ verfallen sei (1985, 262).8 Nach dieser Deutung stößt der Realismus gar nicht mehr zur Realität vor, sondern inszeniert ein Surrogat, ein Trugbild mit kompensatorischen Zügen. Plumpe bezieht dieses Urteil sowohl auf die Theorie als auch auf die Literatur, belegt es aber primär durch Verweise auf den theoretischen Diskurs, in dem auch er eine ungebrochene „Vorherrschaft idealistischer Ästhetik“ erkennt (2005 [1985], 16). Demgegenüber hätten es die bedeutenden Autoren vermocht, die idealistische Verklärungsästhetik in ihrer literarischen Produktion „ironisch außer Kurs [zu] setzen“ (Plumpe 2003, 223). Damit bestätigt Plumpe die Behauptung einer Entfremdung zwischen Theorie und Praxis und ebenso die Annahme, der Grund für diese Diskrepanz liege in einer mangelnden Bereitschaft der programmatischen Realisten, sich auf die Wirklichkeit überhaupt einzulassen.9
Gegen diese kontrastive Gegenüberstellung von literarischer Scheinwirklichkeit und gesellschaftlicher Realität sind aus gutem Grund Einwände erhoben worden. Es wurde darauf hingewiesen, dass Realität nie als etwas „unmittelbar Gegebenes“ angesehen werden kann, sondern „immer schon das Produkt einer auf Wissensmengen und Denkstrukturen der Epoche basierenden, ,Daten‘ selegierenden und interpretierenden sozialen Konstruktion“ darstellt (Titzmann 2000a, 101). Literatur referiert demnach nicht auf eine faktisch gegebene und deshalb für den Literaturhistoriker zugängliche Umwelt, sondern entwirft fiktive Welten und Handlungen auf Grundlage historisch variabler epistemologischer, anthropologischer, sozialer, politischer, kultureller etc. Prämissen. Daher ist der „Referenzpunkt einer ,Mimesis‘“ nie eine historisch rekonstruierbare Realität, sondern immer ein zeitspezifischer „Realitätsbegriff“ (Titzmann 2000a, 101; vgl. Ritzer 2003, 217).10 Für die Literaturgeschichtsschreibung bedeutet dies, dass Vergleiche zwischen der literarisch dargestellten und einer außerliterarisch vorhandenen Wirklichkeit nur mit äußerster Vorsicht zu ziehen sind.11 Zudem lässt sich die Annahme, dass „bestimmte literarische Strukturen in einem gegebenen historischen Zustand ,angemessener‘ wären als andere“, auf dieser Basis kaum noch halten (Titzmann 2000a, 100). Der Vorwurf der Wirklichkeitsflucht und des Rückzugs in eine klassizistisch unterfütterte Verklärungsästhetik beruht mithin auf problematischen methodologischen Prämissen.
Eine andere Traditionslinie der Realismuskritik widersetzt sich diesem Vergleich von außer- und innerliterarischer Wirklichkeit und konzentriert sich dagegen stärker auf die epistemologischen und poetologischen Aporien der realistischen Theorie. Ulf Eiseles Arbeit zur literarischen Theorie nach 1848 ist nicht zuletzt deshalb wegweisend, weil sie es unternimmt, den Realismus von innen heraus, das heißt mit Bezug auf den ihn fundierenden „Realitätsbegriff“, zu bestimmen (1976, 52). Basis der realistischen Poetik ist nach Eisele ein spezifisches Erkenntnismodell, das er als identitätsphilosophisch gestützten Empirismus bezeichnet und das Erkenntnis als einen Vorgang der Extraktion eines essenziellen Kerns aus der Hülle des Inessenziellen beschreibt (Eisele 1976, 53).12 Diese Position, so Eisele, konfligiert mit der für die Realisten bindenden Prämisse, Literatur habe stets das Konkret-Individuelle und nicht nur das Allgemein-Abstrakte zu zeigen. Die Theorie fordere deshalb, dem abstrahierten Wesentlichen im Nachhinein das Gewand einer konkret-sinnlichen Wirklichkeit umzulegen und zu suggerieren, jene Extraktion habe noch gar nicht stattgefunden und der essenzielle Kern sei immer noch mit Zufälligem vermischt. Literatur soll mit anderen Worten „am Essentiellen […] die Form des Inessentiellen nach[ahmen]“ und auf diese Weise die Identität des Dargestellten mit der Realität vortäuschen (Eisele 1976, 74–75). Der gewünschte Illusionseffekt sei aber nur durch eine „Ve...