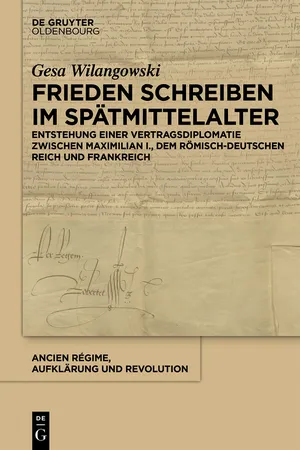1Einleitung
„Die ersten tzwen atrickel ob die fursten im anfang benenet werden sullen ...“?1 In dieser Randbemerkung und der einfachen Frage, die sich der Schreiber offenbar im Zuge seiner Textabfassung stellt, versinnbildlicht sich gleichsam die Problematik des spätmittelalterlichen Reiches: Wo nämlich die Fürsten, vorrangig natürlich die Kurfürsten, zu stehen hätten? Mit der Goldenen Bulle war 1356 bereits eine Antwort auf diese Frage formuliert worden. Säulen des Reiches sollten diese sein. Im Gegensatz zum Königreich Frankreich, in dem sich eine monarchische Herrschaftsverdichtung entwickelte, konsolidierte sich mit der verfassungsmäßigen Etablierung der Kurfürsten im Reich das Wahlkönigtum. Der Grundstein war gelegt für einen Prozess, den Peter Moraw 1989 als eine Entwicklung von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung beschreibt und an dessen Ende sich ein in Europa singulärer ständischer Dualismus etablieren sollte. An der Wende zur Neuzeit institutionalisierte sich die Mitwirkung der Stände an der Herrschaft im Reich und aus dem bis dahin königlich beherrschten Hoftag konstituierte sich über die Tagsatzungsform des königslosen Tages der Reichstag, auf dem die Reichsstände mit den Kurfürsten an der Spitze beanspruchten ihrerseits das Reich zu repräsentieren, auch ohne und bisweilen sogar gegen den König.2
Frankreich stand, soviel lässt sich für das ausgehende Mittelalter zunächst feststellen, ein in seinen inneren Strukturen gewandelter Nachbar gegenüber, was sich entsprechend auf die diplomatische Praxis beider Länder auswirkte.3
Wie agierten die Protagonisten eines sich dualistisch ausdifferenzierenden Reiches bei politischen Kontakten, welche die Grenzen des eigenen Ordnungsgefüges überschritten? Jene Randnotiz, die von der Unsicherheit des Schreibers über die „Stellung“ der Kurfürsten zeugt, befindet sich am Rande eines Vertragsentwurfes, genauer der Erneuerung eines Bündnisses zwischen Kaiser Friedrich III., den Kurfürsten des Reiches und Ludwig XI. von Frankreich vom 17. April 1475.4 Die simpel anmutende Frage des Verfasser verweist den aufmerksamen Leser auf eine Überlappung zweier Prozesse. Sowohl das Reich selbst als auch die normativen Grundlagen zwischen den Mächten befanden sich in einem Prozess der Ausformung und Aushandlung.
Der Vertragstext, die vermeintlich „positiv-rechtliche Basis internationaler Beziehungen“,5 wird zum Schauplatz dieses Phänomens. Anhand der spätmittelalterlichen diplomatischen Kontakte zwischen dem Reich und Frankreich sollen daher Gestaltung und Überwindung der Grenzen zwischen den Herrschaftsbereichen am Beispiel diplomatischer Verträge und im Kontext eines strukturellen Wandels im Reich, der Reichsreform, untersucht werden. Hierbei wird von der Annahme einer sukzessiven Veränderung der im Text repräsentierten Verfahrensformen ausgegangen.
Der Bearbeitungszeitraum wird dazu im Wesentlichen auf die Regierungszeit Maximilians I.6 begrenzt, denn diese erlaubt die Anwendung besonders günstiger Untersuchungsparameter: Seine Ehe mit Maria von Burgund und deren früher Tod führten bald zu Verwicklungen in den ohnehin umstrittenen Verhältnissen in den burgundischen Erbländern. Verträge und Waffenstillstände sollten das ehemalige Herrschaftsgebiet Karls des Kühnen neu ordnen, auf das sowohl Ludwig XI. als auch Maximilian als Herzog von Burgund Ansprüche erhoben.
Ein Höhepunkt der Reformentwicklungen des Reiches war 1495 mit dem Wormser Reichstag erreicht. Reichsregiment und Reichskammergericht sind hier ebenfalls als Ergebnisse temporärer oder dauerhafter Verdichtung greifbar. Fast zeitgleich ist der Beginn der Italienkriege als Ausgangspunkt für eine weitgehend auf Frankreich fixierte und intensivierte Vertragspolitik des römisch-deutschen Reiches anzusetzen. Inwiefern der Statuswandel Maximilians zum römisch-deutschen König und die Entwicklungen des Reiches Auswirkungen auf die Vertragsdiplomatie hatten und haben konnten, lässt sich somit anhand der Verträge aus dem Kontext des Italienkrieges analysieren und in eine direkte Relation zu den Vereinbarungen des vorangegangenen Erbschaftskonfliktes stellen.
Der Vertrag von Cambrai 1508 und nicht das Ende der Regierungszeit Maximilians soll den Abschluss dieser Untersuchung bilden, da dieser Pakt mit der von nun an gegen Venedig gerichteten Bündnispolitik einen deutlichen Bruch markiert.7 Mit der Reichskammergerichtsordnung von 1507 war im Vorjahr die Neuaufrichtung des Zentralgerichts vollzogen und eine dauerhafte Institution als Eckstein der Reichsreform geschaffen worden.8
1.1Forschungsstand
Die neuere mediävistische Forschung bietet zahlreiche Einzeluntersuchungen zu den verschiedensten Aspekten und Akteuren außenpolitischen Handelns. Vertragstexten wurde in dieser Forschungslandschaft bislang weder eine Gelenkstellenfunktion zugesprochen noch wurden sie als Schauplatz diplomatischer Strategien analysiert.
Der zentrale Quellenwert von friedensstiftenden Verträgen für völkerrechtliche Grundlagenforschung sowie für die Erforschung der Geschichte internationaler Beziehungen kann kaum überschätzt werden. Eine aktuelle Untersuchung von Theorie und Praxis spätmittelalterlicher Vertragsdiplomatie stellt jedoch, Alfred Kohler bemängelt dies 2008,9 noch immer eine Forschungslücke dar. Ältere Untersuchungen hierzu stammen aus dem Bereich einer Diplomatik der Vertragsurkunden von Ludwig Bittner (1924)10 und Heinrich Fichtenau (1957).11 Eine universalgeschichtliche Studie hat 1979 Jörg Fisch vorgelegt.12
Für die aktuelle Forschung ist die Studie von Nicolas Offenstadt von zentralem Wert. Die Untersuchung zum Themenkomplex des Friedensschlusses in der Zeit des Hundertjährigen Krieges liefert einige wichtige Ansatzpunkte zur Erforschung vormoderner Friedensverträge.13 Im Rahmen einer 2010 erschienenen, programmatisch als Beziehungsgeschichte zwischen dem Reich und Frankreich angelegten Veröffentlichung greift auch Jean-Marie Moeglin die Vertragsthematik auf. Den Versuch, eine stabile Beziehung zweier Königreiche auf „staatsvertraglicher“ Basis herzustellen, hebt er als roten Faden in der Entwicklung während des 13. und 14. Jahrhunderts hervor.14 Weitere grundlegende Forschungsergebnisse zur Quellenbasis der Vertragsurkunden entstehen gegenwärtig auf dem Arbeitsfeld der Frühen Neuzeit. In Anbindung an das Mainzer Institut für Europäische Geschichte wird seit 2000 unter Leitung von Heinz Duchhardt ein großangelegtes Forschungsprojekt gesamteuropäischer Dimension durchgeführt: Langfristiges Ziel ist die historischkritische Edition frühneuzeitlicher, europäischer Friedensverträge zwischen ca. 1450 und der Französischen Revolution. Die mediale Realisierung durch eine Online-Datenbank ermöglicht es schon jetzt, Teile eines einzigartigen Bestandes frei zugänglich einzusehen.15
Eine eingehende, systematische Beschäftigung mit Friedensverträgen erfolgte bislang von Seiten der Rechts- und Völkerrechtsgeschichte. 2005 erschien unter der Herausgeberschaft Randall Lesaffers ein grundlegender, epochenübergreifender Band zu Friedensverträgen und ihrer völkerrechtlichen Entwicklung.16 Randall Lesaffer verortet auf der Grundlage einer Analyse rechtswirksamer Bestandteile der Vertragsurkunden zwischen 1450 und dem Westfälischen Frieden eine wichtige Beschleunigungsphase in der Entwicklung des modernen europäischen Staatensystems und seines internationalen Rechts.17 Diese Tatsache macht die Frage nach dem völkerrechtlichen oder normativen Status von Verträgen auch für die Zeit vor dem Westfälischen Frieden relevant, welcher von der älteren Forschung als zentrale Zäsur in der Geschichte der Verträge und des internationalen Rechts gesehen worden ist.18
Grundsätzlich soll in der vorliegenden Arbeit die Notwendigkeit betont werden, einen Vertrag über seine rechtliche Fundierung hinaus als facettenreiches Instrument der Diplomatie zu begreifen, um die funktionierende diplomatische Praxis des ausgehenden Mittelalter zu beschreiben. Wie relevant die Betrachtung des Ineinandergreifens mündlicher, zeremonieller und schriftlicher Formen sowie die Wiederverwendungssituation von Urkunden ist, haben grundlegend die Arbeiten aus dem Umfeld Hagen Kellers, maßgeblich für Italien, gezeigt.19 Die Schrift fungiert gleichsam als Protokoll konstitutiver zeremonieller Handlungen. Ausgehend von dem hier geplanten Versuchsaufbau lässt sich feststellen, dass sich in den Verträgen und deren Verbindlichkeitsgarantien eine potentiell funktionale Deckungsmenge zweier divergenter politischer Verfassungen verdichtet. In diesem Zusammenhang ist die textliche Umsetzung gemeinsam von Reich und Frankreich akzeptierter Rituale und deren mögliche konstitutive Relevanz für den Friedensschluss sowie die schriftliche Inszenierung der jeweiligen (Völkerrechts-)Subjekte zu untersuchen.
Als Endpunkt komplexer Entscheidungsfindungs- und Kommunikationsprozesse erfahren Vertragstexte also eine kulturwissenschaftliche Perspektivierung: Politisches Handeln ist immer auch kommunikatives Handeln. Von dieser Voraussetzung ausgehend, sind Vertragsurkunden nicht lediglich als durchformalisierte Zeugnisse politischer Beschlüsse zu verstehen. Ebenfalls soll ihre Aussagekraft hinsichtlich der Perspektiven und Entwicklungsstadien sozialer Realitätsinterpretation und ihr bislang unterschätztes Potential für die Beschreibung politischer, grenzübergreifender Prozesse insgesamt gewürdigt und erkenntnisleitend genutzt werden.
Die Bedeutung der diplomatischen Verhandlung ist in einer inhaltlich wie methodisch grundlegenden Studie bereits 1998 von Christina Lutter als zentral herausgestellt und für die Beziehungen zwischen Maximilian und Venedig erforscht worden.20 Daran anschließend lässt sich hier die Frage aufwerfen, inwiefern textliche Innovationen in Verträgen durch ihre normierende Wirkung die Grenzen politischer, kommunikativer Handlungsspielräume in der Praxis verschieben konnten und nicht lediglich im legitimatorischen Nachvollzug bereits abgeschlossene Veränderungen beschreiben. Bedeutung und Funktionalität von vertraglichen Normierungsversuchen lassen sich nach diesen Kriterien bewerten.21
Das sich im Rahmen der Untersuchung entfaltende Spannungsfeld zwischen Innen und Außen ist von der Forschung bereits aus verfassungsgeschichtlicher Perspektive betrachtet worden, mit der Untersuchung von Vertragstexten wird jedoch eine eigene Quellengattung zu dieser Problemstellung erkundet und nutzbar gemacht. Das Reich als heterogenes Gebilde sowie der stetige Interessensgegensatz zwischen den Akteuren der Reichspolitik erschweren Untersuchungen mit der kategorischen Vorannahme und Trennung von Innen- und Außenpolitik.22 Petra Ehm-Schnocks illustrierte 2003 am Beispiel der Beziehungen zwischen England und den Hansestädten die negativen Auswirkungen von Systemdivergenzen für das diplomatische Verhältnis.23 Eine solche Problematik soll nun, ausgehend von der Analyse der Vertragstexte und insbesondere vor dem Hintergrund der Verfassungsreform im Reich, betrachtet werden. Die im Wandel befindliche Reichsverfassung wird dabei, dem etablierten Ansatz von Ernst Schubert folgend, als dynamisches Zusammenspiel institutioneller, personeller und rechtlicher Elemente verstanden. In seiner für die Forschung noch immer substanziellen Habilitationsschrift von 1974 bedient Schubert sich wort- und begriffsgeschichtlicher Methoden, um die dualistische Ausprägung des Reiches nachzuvollziehen. Er geht damit über eine rein politikgeschichtliche Analyse hinaus und macht Wandel im Spiegel von Sprache deutlich, wie es auch in dieser Analyse angestrebt wird. Anders als bei Ernst Schubert richtet sich der Blick hier jedoch nicht auf die innere ...