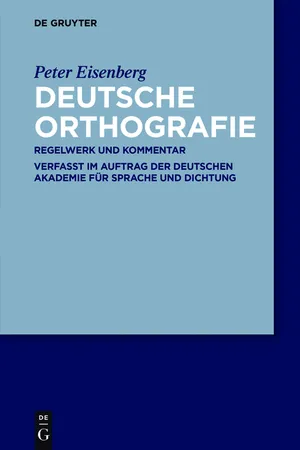1.1Orthografische Regeln
Schreiben und Lesen
Das Deutsche verfügt über einen Wortschatz von Hunderttausenden wenn nicht Millionen Wörtern, die nicht einmal das umfangsreichste orthografische Wörterbuch alle enthält. Das ist auch gar nicht nötig, denn wenn jemand eine gewisse Menge an Wörtern richtig schreiben und lesen kann, dann dient ihm das als Grundlage für das Schreiben und Verstehen einer viel größeren Zahl von ihnen. Er kennt dann nämlich die Regelmäßigkeiten, nach denen wir schreiben, und er kennt die Wortbestandteile, aus denen komplexe Wörter aufgebaut sind. Unbekannte Wörter können geschrieben und gelesen werden, weil sie Bestandteile enthalten und nach Regelmäßigkeiten gebaut sind, die man als Benutzer der Sprache beherrscht. Bei allen Unterschieden kann man sagen, dass die Orthografie wie die Aussprache oder die Syntax als Teil eines Systems erworben wird. Aus dem, was geschrieben und gelesen wird, bilden die Schreiber ein internes, implizites Wissen über Regelmäßigkeiten der Schreibung heraus (Sprachwissenschaftler sprechen gern von ‚Regularitäten‘), auf dessen Grundlage Verallgemeinerungen möglich sind. Mit implizit ist gemeint: Die Schreiber können irgendwann schreiben und folgen den Regelmäßigkeiten, können diese aber nicht in Sprache fassen. Das müssen sie auch nicht. Kein Normalsprecher kann ja etwa die Regelmäßigkeiten der Pluralbildung beim Substantiv hersagen, auch wenn er alle Plurale richtig bildet.
Trotzdem kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Schreibunsicherheiten kommen. Der Orthografieerwerb findet vergleichsweise spät statt, und er ist gesteuert. Schreibvarietäten, die etwa einer Umgangslautung, dialektalen oder soziolektalen Färbung vergleichbar wären, gibt es nicht. Die orthografische Norm ist eindeutig und für alle dieselbe. Zwar gibt es Varianten, sie haben aber einen anderen Status als im Gesprochenen. Vieles hängt von der Art der Steuerung des Erwerbs ab, von der Progression und immer wieder vom verwendeten Sprachmaterial. Lehrer müssen wissen, in welchen Erwerbsstadien welches Material zu verwenden ist und – genauso wichtig – welches nicht. Hier liegt eine zentrale Aufgabe der Schreib- und Lesedidaktik. Ihr Erfolg hängt wesentlich davon ab, dass Lehrer die Orthografie nicht nur selbst beherrschen, sondern auch die Schreibregularitäten kennen. Denn nur dann verstehen sie, warum Kinder bestimmte Fehler machen und warum welches Material im Unterricht angemessen ist.
Wie überall gibt es auch beim Orthografieerwerb Kompensationsstrategien, etwa das Memorieren großer Mengen von Einzelfällen. Wird es richtig ins Werk gesetzt, etwa als Trainieren wichtiger, häufig gebrauchter Wörter, kann es bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich sein. Irgendwann wird auch das beste Gedächtnis an Grenzen stoßen und der größte Teil des Wortschatzes bleibt dem Schreiber verschlossen.
Jeder von uns hat schon erlebt, dass es genügen kann, bei Unsicherheiten die infrage kommenden Formen hinzuschreiben und das Auge entscheiden zu lassen, welche die richtige sei. Wir wissen nicht warum, aber das Auge sagt uns, wie zu schreiben ist. Es gibt keine schönere Bestätigung für die These, die Orthografie sei für das Auge gemacht. Eine Kehrseite sind Unsicherheiten aus dem Schreibkontext heraus. Jemand liest etwa Formen wie knallt, krallt und fragt sich plötzlich, warum kalt, halt mit nur einem l geschrieben werden. Oder er sieht Lohn, Sohn und fragt sich, warum Ton, Fron korrekt sein können. Er weiß vielleicht, dass man schreibt im Allgemeinen, aber was kann daraus geschlossen werden in Hinsicht auf im wesentlichen, aufs äußerste, von neuem, ohne weiteres, seit langem? Und warum schreibt man Nation und Sozialismus, nicht aber Nazion und Sotialismus, wo doch sowohl Existenzialismus als auch Existentialismus geschrieben werden kann?
Ein Rechtschreibwörterbuch gibt über solche Schreibungen Auskunft, nicht jedoch über ihre Begründung. Aber die Benutzung eines Rechtschreibwörterbuchs ist alles andere als ein mechanisch ablaufender Prozess, der mechanisch zum Erfolg führt. Zwar ist die alphabetische Ordnung von Buchstaben für unser Alltagsverständnis eine äußerliche Ordnung, die man sich einprägt, um das Wörterbuch zu verwenden. Fragen und Zweifel erstrecken sich aber in den meisten Fällen auf einzelne Eigenschaften geschriebener Formen, wie gerade demonstriert. Was man, um das zu realisieren, schon wissen muss, ist erheblich mehr und setzt eine gewisse Vertrautheit mit dem System voraus. Ist sie nicht vorhanden, kann kaum erfolgreich gesucht werden. Darüber hinaus sind unsere neueren Wörterbücher dazu übergegangen, in zahlreichen Fällen auf den Regelhintergrund hinzuweisen und Regelformulierungen der einen oder andern Art als Vorspann oder Anhang gleich mitzuliefern. Am prinzipiellen Unterschied zwischen den beiden Zugängen zur Orthografie ändert das nichts.
Regeln
Die wichtigste Eigenschaft einer Rechtschreibregel ist, dass sie Eigenschaften geschriebener Formen verallgemeinert. Sie gilt für große oder sehr große Mengen von Formen und teilt auch mit, welche das sind. Eine Regel hat einen Geltungsbereich, man spricht von ihrer Domäne. Wie sie formuliert ist, liegt nicht von vornherein fest. Es kann beispielsweise sein, dass eine Formulierung die Regeldomäne nicht ganz ausschöpft, dafür aber einfach ist und immerhin die wichtigsten Fälle erreicht. Aus dem Grad der Verallgemeinerung ergibt sich in vielen Fällen auch ein Ansatz zur Deutung im Sinne von Begründung für die Existenz einer Regel. Immer wieder werden wir beispielsweise sehen, dass eine orthografische Regel dazu dient, eine auf das Ohr zugerichtete gesprochene Form sozusagen auf Augentauglichkeit zu transformieren.
Ein weitgehend neutraler Regelbegriff zur Beschreibung sprachlichen Verhaltens expliziert ‚Regel‘ als Bestandsaufnahme von Regelmäßigkeiten beobachteter Sachverhalte, in unserem Fall von Regelmäßigkeiten des Baus gesprochener und geschriebener sprachlicher Einheiten. Von größtem Interesse sind dann natürlich Regelmäßigkeiten, die das Verhältnis der beiden Seiten betreffen, eben des Gesprochenen und des Geschriebenen.
Wie eine orthografische Regel formuliert wird, hängt auch davon ab, wie die Beschreibung von Regelmäßigkeiten aussieht, welche Begriffe verwendet werden und welche Daten der Analyse zugrunde liegen. Das ist genau so, wie wir es von Grammatiken kennen. Wie beispielsweise das Pluralssystem der Substantive, der Komparativ der Adjektive, der Konjunktiv, das Passiv usw. beschrieben wird, unterscheidet sich von Grammatik zu Grammatik teilweise erheblich. Und im Regelwerk von Kapitel 3 geht es ja gerade darum, Regeln teilweise anders zu formulieren, als sie im amtlichen Regelwerk (Rat Hg. 2006) stehen. Unterschiede finden sich in allen Teilen des Regelwerks. Wir illustrieren das Problem an den Abschnitten 3.1 und 3.4.
Abschnitt 3.1 hat die Überschrift ‚Buchstabenschreibung‘, der entsprechende Abschnitt im amtlichen Regelwerk steht unter der Überschrift ‚Laut-Buchstaben-Zuordnungen‘. Dort wird angenommen, die Beziehungen zwischen der lautlichen Seite von Wörtern und ihrer geschriebenen Seite seien über Zuordnungen von Lauten zu Buchstaben zu erfassen. Eine Regel lautet etwa (Rat Hg. 2006: 20): „Folgt im Wortstamm auf einen kurzen Vokal nur ein einzelner Konsonant, so kennzeichnet man die Kürze des Vokals durch Verdoppelung des Konsonant- buchstabens.“, wie in Ebbe, Paddel, schlaff, Affe. Die entsprechende Regel in 3.1. (R13) lautet: „Steht in einer Langform zwischen einem betonten kurzen und einem unbetonten Vokal ein einzelner Konsonant, dann wird der entsprechende Konsonantbuchstabe verdoppelt.“
Der wichtigste Unterschied liegt bei Verwendung des Begriffs Langform, womit hier ein Zweisilber aus betonter und unbetonter Silbe gemeint ist, wie in der besprochenen Form von Ebbe, Paddel, Affe, aber nicht von schlaff. Diese Form wird von unserer Regel nicht direkt erfasst, sondern indirekt über Bezug auf einen Zweisilber (eine Langform) wie schlaffes. Die Übertragung vom Zweisilber auf den Einsilber erfolgt über das sog. morphologische Prinzip, das dazu dient, die Bestandteile geschriebener Wörter möglichst immer gleich zu schreiben und damit ihre Wiedererkennung zu erleichtern. Die Buchstabenschreibung hat also drei Typen von Regeln. Neben der Zuordnung von Buchstaben zu Lauten gibt es silbische und morphologische Bedingungen. Man spricht auch vom phonografischen, silbischen und morphologischen Prinzip der Buchstabenschreibung. Weitere Beispiele und Erläuterungen in Abschnitt 2.1.
Die drei Prinzipien entfalten ihre Wirkung in ganz unterschiedlichen Bereichen der Orthografie. Ihre Fruchtbarkeit beruht auch darauf, dass mit diesen Begriffen gleichzeitig sehr allgemeine Prinzipien der historischen Entwicklung von Alphabetschriften aufgegriffen werden. Danach steht am Anfang einer solchen Entwicklung meist eine mehr oder weniger ununterbrochene Buchstabenreihe, wie sie für das Deutsche näherungsweise bei der Schreibung mit der karolingischen Minuskel vorlag. Je weiter die Entwicklung fortschreitet, desto stärker wird diese Scriptio continua gegliedert, durch Wortabstände, durch Interpunktionszeichen usw., und wortintern eben durch die Silbe und durch die morphologischen Bestandteile, die Morpheme. Wer so verfährt, gelangt zu anderen Formulierungen bei seinen Regeln als jemand, der die Gliederung von Wörtern in Silben nicht berücksichtigt.
Im Abschnitt 3.4 geht es um die Groß- und Kleinschreibung. Im amtlichen Regelwerk (Rat Hg. 2006: 56) heißt es dazu: „Die Abgrenzung der Groß- und Kleinschreibung, wie sie sich in der Tradition der deutschen Orthografie herausgebildet hat, macht es erforderlich, neben den Regeln für die Großschreibung auch Regeln für die Kleinschreibung zu formulieren.“ Unser Abschnitt 3.4 beginnt dagegen mit dem Satz „Die Wortformen eines laufenden Textes bestehen im Allgemeinen aus Kleinbuchstaben und beginnen auch mit einem Kleinbuchstaben. Nur in bestimmten, genau geregelten Fällen beginnt eine Wortform mit einem Großbuchstaben.“ Der ganze Abschnitt konzentriert sich also auf das Vorkommen von Großbuchstaben und folgt damit einem sehr allgemeinen Prinzip zur Erfassung sprachlicher Regelmäßigkeiten (weiter 2.4, 3.4). Beide Beispiele zeigen, dass es erhebliche Unterschiede bei der Formulierung von orthografischen Regeln geben kann, die bei denselben Schreibungen enden. Das ist sehr wichtig. In Abschnitt 2.2 wird etwas näher begründet, warum unser Regelwerk keine andere Orthografie als das amtliche anstrebt, wohl aber andere Regelformulierungen.
Über Ausnahmen
Geht es nicht lediglich um eine Bestandsaufnahme von Regelmäßigkeiten, sondern auch um eine Beeinflussung des Sprachverhaltens, hat man es mit normativen Regeln zu tun. Das bedeutet aber nicht, Regeln unbedingt als Vorschriften zu formulieren. Eine Regel wie ‚Substantive werden großgeschrieben‘ kommt als Beschreibung eines Sachverhalts daher, ist aber als Anweisung zu verstehen. Ganz allgemein stellt sich natürlich die Frage, wie man von deskriptiven zu normativen Regeln gelangt. Sie ist gerade für die Orthografie von entscheidender Bedeutung und verlangt zunächst eine Erläuterung zum Begriff ‚Ausnahme von einer Regel‘, der ja in der Orthografie hochpräsent ist.
Weisheiten wie ‚Keine Regel ohne Ausnahme‘ oder ‚Ausnahmen bestätigen die Regel‘ können nicht falsch sein, führen aber auch nicht viel weiter. Es geht ja nicht um Toleranz oder Liberalität im Umgang mit Regeln, sondern immer wieder um die Frage, wie weit man mit Regeln kommen kann, wo die Grenzen von Regelmäßigkeiten erreicht sind. Sieht man die Schreibung Eltern als Ausnahme an, dann ist man einer historischen Sichtweise gefolgt. Das Wort ist aus dem Komparativ zu alt entstanden. Ein Herkunftswörterbuch (Duden 2013a) schreibt dazu „Die Schreibung mit E- blieb erhalten, weil der Begriff ‚alt‘ gegenüber der Vorstellung ‚Vater und Mutter‘ verblasste.“ Mit der normativen Erzwingung von die Ältern würden wir keine Ausnahme beseitigen, sondern eine Regelmäßigkeit missachten.
Ein anderer Typ von Ausnahme betrifft sog. Subregeln. Wir schreiben Kasse, aber nicht Laschsche, obwohl lautlich ganz ähnliche Strukturen vorliegen. Ein sog. Mehrgraf wie sch wird nicht verdoppelt, auch wenn er sich auf einen Einzellaut bezieht. Das ist keine Ausnahme, sondern eine Subregel. Sie begrenzt die Reichweite der Regel zur Verdoppelung von Konsonantbuchstaben und wird höchst systematisch angewandt. Es kommt dann vor allem darauf an, die Gründe für eine solche Subregel zu erfassen. In einem Regelwerk, das einen größeren Kreis von Benutzern anspricht, kann und darf man aber nicht zu sehr in Einzelheiten gehen, die nach Jahren intensiver Forschung heute bekannt sind.
Eine weitere Möglichkeit, Ausnahmen in ein Regelwerk zu integrieren, ist folgende. Die Wirkung einer Regel kann man sich als gerichtet vorstellen: Es gibt einen Regelinput, in dem die Bedingungen für ihre Anwendung beachtet sind, und es gibt einen Output, an dem deutlich ist, was die Regel bewirkt. Es fällt nun auf, dass viele Schreibungen einem Regeloutput entsprechen, ohne dass es einen entsprechenden Input gibt. Beispielsweise schreiben wir hübsch, ob, ab, obwohl diese Wörter im Gesprochenen kein [b], sondern ein [p] enthalten. Ihre Schreibung könnte es durchaus geben, läge Auslautverhärtung vor (3.1). Das ist nicht der Fall. Trotzdem sind die Schreibungen nicht einfach irregulär, sondern sie überdehnen die Domäne der entsprechenden Regel. Wir wollen versuchsweise von einem Regelüberschuss sprechen. Ein Regelüberschuss kann sprachhistorisch bedingt sein, aber auch auf andere Weise zustande kommen. Möglicherweise lohnt es sich, einen solchen Begriff weiter zu verfolgen.
Jedenfalls werden wir mit dem Begriff Ausnahme vorsichtig umgehen. Es ist in mehrerer Hinsicht kontraproduktiv, wenn man den Gesamtbestand an Wortschreibungen einfach in regelhafte und irreguläre oder eben Ausnahmen aufteilt. Man bestätigt damit nur das Vorurteil, die Orthografie sei willkürlich oder beli...