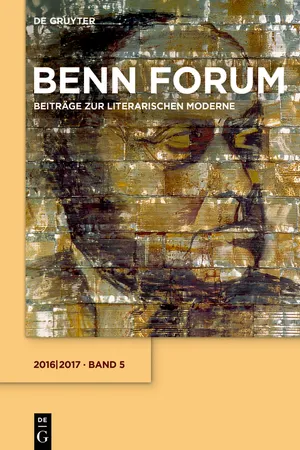
- 249 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Das Benn Forum erscheint in Verbindung mit der Gottfried Benn-Gesellschaft und veröffentlicht Aufsätze, Vorträge, Miszellen und Dokumente zu Benn und zur literarischen Moderne. Darüber hinaus gibt es einen ausführlichen Rezensionsteil, der speziell Neuerscheinungen zu Benn und seinem literarischen Umfeld im Blick hat. Eine umfassende, periodisch angelegte Personalbibliographie beschließt das im Zweijahresrhythmus erscheinende Benn Forum und informiert in einer systematischen Übersicht über neue Titel der Primär- und Sekundärliteratur zu Benn.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Beiträge
Hermann Korte
„Jeder Brief von Ihnen ist mir ein Genuss u. eine Freude“
Die Edition des Briefwechsels Gottfried Benn und Friedrich Wilhelm Oelze (1932–1956)
Der von Harald Steinhagen herausgegebene Briefwechsel zwischen Gottfried Benn und Friedrich Wilhelm Oelze gehört zu den großen abgeschlossenen Editionsprojekten des Jahres 2016. Entstanden ist ein vierbändiges Kompendium, das innerhalb der Benn-Forschung endlich eine große Lücke schließt.1 Übersichtlichkeit gehört zu den vielen Vorzügen der Ausgabe; das gilt sowohl für die souveräne Präsentation der chronologischen Gliederung der Briefe, sodass deren Dialog-Charakter dominiert, als auch für die zuverlässig recherchierten, übersichtlich lemmatisierten, vom Umfang her arbeitsökonomisch klug kalkulierten Briefkommentare von Stefan Kraft und Holger Hof, den zwei weiteren Mitherausgebern. Die Fülle der Hinweise eröffnen einen kulturellen Horizont, in dem sich Benn wie Oelze bewegten, und vor allem für die Zeitphase des Nationalsozialismus einen Einblick in Mechanismen des autoritären Staates, von dem sich Benn wie Oelze zunehmend bedroht fühlten. Ein Personen- und Werkregister schließt jeden Band ab; im vierten und letzten Band fasst Steinhagen wesentliche Informationen zum Briefwechsel und zur Überlieferungslage der Quellen als „Nachwort“ zusammen (4, 573–481), in dem auch geklärt wird, wie es zur Veröffentlichung der Oelze-Briefe gekommen ist, obwohl der Verfasser ihre Publizierung testamentarisch untersagte.
Wer aus heutiger Perspektive den exorbitanten, umfangreichen Briefwechsel aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts literarhistorisch einordnet, hat Einblick in eine Korrespondenz, die immer noch, 60 Jahre nach Benns Tod, keinen Archiv-Staub angesetzt hat: Es handelt sich um derart lebendige Dokumente, dass sie einen einzigartigen Zugang zu einer der dunkelsten Epochen der Zeitgeschichte erlauben. Für die Benn-Forschung zeigen sie nicht nur den bisher weithin unbekannten Briefpartner, sondern auch den auf Dialog bedachten, am ergiebigen, offenen Gespräch interessierten Schriftsteller, dessen Äußerungen stets auf prägnante Weise adressatenbezogen sind. Es ist die Innenseite der zeitgenössischen Literaturgeschichte, die im Briefwechsel über 20 Jahre hinweg aus der Perspektive zweier Partner entfaltet wird, die von Anfang an auf die private, ja intime Seite des Gesprächs verzichten. Sogar dort, wo Briefe etwas Alltägliches streifen, dient die Mitteilung dem Vermitteln der so gänzlich verschiedenen Lebenspraxis. In diesen Kontext gehören Oelzes Kurzberichte von zahlreichen Reisen ins In- und Ausland und – seit 1935 – Benns Nachrichten vom Militärdienst in Hannover. Symptomatisch für die Aussparung des Privaten ist eine Vermutung Stefan Krafts, des hoch kompetenten Kommentators, zu Benns Brief vom 21.10.1935: „Offenbar waren Benn auch nach fast drei Jahren des Briefwechsels die Vornamen seines Gegenübers unbekannt“ (1, 424). Es ist jedoch Vorsicht geboten, daraus ein Desinteresse Benns an Oelze abzuleiten. So lässt er sich in vielen Briefen Oelzes Bremer Lebens- und Wohnsituation schildern, widmet ihm und auch Oelzes Frau Texte und nimmt Anteil an den zahlreichen geschäftlichen Aktivitäten des Briefpartners.
Es war immer schon ein Trugschluss zu glauben, dass die ganz sicher asymmetrische Briefkommunikation letztlich durch Benn dominiert wurde und Oelzes Anteil daran nicht erheblich sei. Ein solches Urteil bedarf dringend der Korrektur: Oelzes Briefe dokumentieren einerseits, dass ein bildungsbürgerlicher Bremer Kaufmann Literatur, Kunst, Musik und bildende Kunst so leidenschaftlich rezipieren konnte, dass die Kultur im Alltag das ökonomische Hauptgeschäft in den Hintergrund drängte. Andererseits zeugen seine Briefe von einer beeindruckenden Selbständigkeit im Urteil über Dichtung, Philosophie, Kultur, aber auch Politik und Zeitgeschichte, sodass es verständlich war, dass nicht nur Benn ihn immer wieder als Ratgeber und Mitgestalter seiner literarischen Produktion heranzog, sondern auch, wie gleich nach 1945, Verleger und Lektoren ihn kontaktierten, wenn es um die Veröffentlichung von Texten Benns ging. Steinhagens Edition des Briefwechsels ermöglicht daher einen sehr differenzierten Blick auf Oelze, der seit den 1930er Jahren mit seinen markanten Positionen Benns Interesse weckte und als Gesprächspartner, Korrektor, Archivar und Anreger einen aktiven Anteil an der Entstehungsgeschichte des Werkes hatte.
1.
Nun erschienen Benns Briefe an Oelze schon zwischen 1977 und 1980 in kommentierten Ausgaben und haben seitdem als bedeutende Forschungsquelle eine vielfältige Resonanz erzeugt.2 Wer aber Benns Briefadressat war und wovon dessen Briefe konkret handelten, war oft Gegenstand von Spekulationen. Oelze blieb jahrzehntelang in der Benn Rezeption eine undurchsichtige Hintergrundfigur: eben ein reicher Bremer Überseekaufmann mit Südamerika- und Jamaika-Flair, dessen genaue Tätigkeit auch Benn selber offenbar nicht kannte.3 In einem Brief an Tilly Wedekind berichtete dieser im Juni 1936 von einer Begegnung mit Oelze in Hannovers Weinhaus Wolf und charakterisierte ihn auf anschauliche Weise:4
Mit Oelze war es nett. […] Oe. sah extravagant aus. Wirklich ein merkwürdiger Typ, gänzlich undeutsch. Sieht älter aus, als er ist (45 J.). Haar fast weiß, sehr schlank, schmales spitzes Gesicht, Gesichtsfarbe rötlich wie bei Lungenkranken, unwahrscheinlich gut angezogen. Er sieht eigentlich aus wie aus einer Revue, Hoffmanns Erzählungen, am Rand von Wirklichkeit u. Halluzination.
Einer solchen Persönlichkeit tritt Benn nicht gleichgültig und uninteressiert entgegen. Dass es allerdings zu einem über 20 Jahre währenden Briefwechsel kommt, ist am Anfang keineswegs abzusehen. Oelze selbst wertet in seiner Erinnerung an Gottfried Benn dessen ersten Antwortbrief vom Winteranfang 1932 sogar als „Absage“ (1 / 7) an jede Kommunikation. So jedenfalls hat er Benns unmissverständliche Zurückweisung von persönlichen Begegnungen verstanden: „Eine mündliche Unterhaltung würde Sie enttäuschen. Ich sage nicht mehr, als was in meinen Büchern steht“ (1 / 22). Eine „Absage“? Aus der Retrospektive liest sich Benns Antwort eher als ein Prinzip, eine kategorische Bedingung, an die er die Korrespondenz mit Oelze zu knüpfen gedenkt – falls dieser überhaupt weiterhin daran interessiert ist. Im Übrigen antwortet Benn nicht irgendeinem Verehrer seines Werkes, sondern einem enthusiastischen Leser des eben erschienenen Essays Goethe und die Naturwissenschaften.5 Benn entschließt sich, Oelze eine Handvoll Sätze zu schreiben, weil dieser als bildungsbürgerlicher Goethe-Kenner den Argumentationsansatz des Essays nicht nur nachzuvollziehen weiß, sondern die innovative, dem geläufigen Goethe-Bild des frühen 20. Jahrhunderts konträre Leistung Benns präzise erfasst hat. Indem Benn eine „mündliche Unterhaltung“ zurückweist, hat er die Richtung vorgegeben, die für die kommende Zeit gelten sollte: Einer Korrespondenz ohne oberflächliche Plauderei und ohne belanglosem Gerede öffnet sich Benn erstaunlich schnell; schon im August 1933 bekennt er (1, 23):
[I]ch lese alle Ihre Briefe mit tiefem Gefühl. Im letzten, von gestern, aber steht das Hervorragendste, das ich je in ihnen las, nämlich das über Goethe u. Nietzsche. Es ist so ungemein wahr, was Sie schreiben u. so ungemein meine Ansicht auch, dass ich sofort es Ihnen bestätigen muss.
Benns Begeisterung gilt hier dem philosophischen Diskurs mit Oelze, wie in späteren Briefen den kulturellen, zeithistorischen und politischen Diskursen, die beide in erstaunlich kurzer Zeit eng zusammenbringt. Die dialogische Nähe ist intellektuell definiert, nicht durch Privatheit und bloße Freundschaft. Daher dominiert der briefliche Austausch, nicht die persönliche Begegnung. So verwundert es nicht, dass gleich in Benns ersten Briefen – denen des Jahres 1933 – der Dialog über Goethe, Nietzsche und Nihilismus entfaltet wird. Nichts klingt nach Konversation, schon gar nichts nach Small Talk. Typisch ist, dass erst im dritten Brief die Frage „Wer sind Sie, sehr verehrter Herr Oelze, nun eigentlich?“ (1, 23) gestellt wird, Benn also die förmlichen Vorbehalte gegen den Briefpartner aufgibt und sogar eine Aufmunterung zum Telefonanruf wagt, falls Oelze „einmal in Berlin“ (ebd.) sei. Vor diesem Hintergrund deutet sich bereits die Rolle an, die Benn dem Korrespondenzpartner zuerkennt – als Privileg! Oelzes Briefe sind keine bloße Stichwortsammlung für einen Dichter, der Positionen und Standpunkte im dialogischen Epistelformat entwickeln möchte, ohne den Briefpartner im Blick zu haben. Oelzes Briefe eröffnen auch Benn Perspektiven, themenzentriert und auf der Basis fundierter bildungsbürgerlicher Kenntnis: „Es ist so ungemein wahr, was Sie schreiben u. so ungemein meine Ansicht auch, dass ich sofort es Ihnen bestätigen muss“ (ebd.). Dabei geht es nicht um Nebensächlichkeiten, sondern um nichts Geringeres als den Konnex von „Goethe u. Nietzsche“ (ebd.), also um einen Diskurs, in dem Benn ebenso engagierte wie dezidierte Positionen vertritt.
Schon Benns Oelze-Briefe des Jahres 1933 sind keine Briefmonaden, sondern haben einen genuin dialogischen Charakter. Hier liegt die große Bedeutung der Briefwechsel-Edition; sie eröffnet einerseits endlich den Blick auf die Briefe des Partners, der nun aus dem Dunkel des Spekulativen hervortritt, und verweist andererseits auf den Benn-Part der Korrespondenz zurück: Benns Briefe erhalten, nun im Kontext publiziert, eindeutig etwas Dialogisches – und dies sogar im frappierenden Sinn. Der Dichter greift die von Oelze angesprochenen Themen auf, er beantwortet Nachfragen und Bitten um Erklärungen, er stellt gewissen Standpunkten Oelzes klare Kontrafakturen entgegen, etwa wenn er dessen Hohes Lied auf den deutschen Klassizismus relativiert, korrigiert und nicht zuletzt auch ironisiert.
Wer die Frage zu beantworten versucht, wieso zwei in ihren Lebens- und Arbeitsverhältnissen so gegensätzliche Männer wie Benn und Oelze überhaupt so problemlos und rasch miteinander in einen engen Briefaustausch treten konnten, wird den Zeitpunkt der Kontaktaufnahme berücksichtigen müssen. Für Oelze war 1932 ein durch Goethe prononciertes Jubiläumsjahr; bis dahin gab es für ihn keinen Anlass, mit Benn näher bekannt zu werden, zumal dessen expressionistische Frühphase außerhalb des literarischen Interessenhorizonts Oelzes lag, für den Rilke die Moderne repräsentierte. So war es eine kleine Sensation, dass zum Abschluss des Goethe-Jahrs Benns Essay über den Naturwissenschaftler Goethe erschien, und zwar derart professionell und kenntnisreich, dass der enthusiasmierte Oelze zur Feder greift und dem Autor schreibt, ausdrücklich mit Bezug auf diese und keine weitere Schrift Benns. Nun ist Oelze nicht der einzige, der den Goethe-Essay als einen der substanziellsten Beiträge deutscher Gegenwartsschriftsteller zum hundertsten Todestag des Weimarer Klassikers betrachtet. Benn entschließt sich Ende Dezember zur höflichen Antwort, während er selbst schon ein paar Wochen später in die kulturpolitischen Turbulenzen der Akademie gerät – mit entsprechenden Folgen: Seit Anfang 1933 reduziert sich aufgrund der politischen Verhältnisse die Zahl derer, mit denen Benn ein offenes Wort und einen kulturellen Diskurs führen kann. Während emigrierte Schriftsteller den Kontakt mit Benn abbrechen, bewahren die neuen, mit Akademieposten versehenen nationalkonservativen bzw. nationalsozialistischen Autoren ihre strikte Distanz zu Benn als Verkörperung des ihnen verhassten modernen Intellektuellentypus. Der Auftakt des Briefwechsels mit Oelze fällt also in eine Zeit dramatischer Kontakt-Abbrüche, sodass Benn im Februar 1936 in einem Brief an Tilly Wedekind die Sonderrolle Oelzes auf glaubhafte Weise hervorhebt: „Mein einziger Schreibgefährte ist Herr Oelze. Mit dem ist wirklich so eine Art Freundschaft entstanden, die mir wertvoll ist u anregend. Ich muß ihm dankbar sein, daß er meine Eisbarriere manchmal durch seine Boten u Rufe durchbricht.“6
Die Bezeichnung „einziger Schreibgefährte“ und die Umschreibung der eigenen Distanzhaltung in der Metapher „Eisbarriere“ charakterisiert für die nächsten Jahre die Grundlage der Korrespondenz mit Oelze. Diesem jedoch ist das Durchbrechen der „Eisbarriere“ durchaus rasch gelungen, wie sich in jenen politischen Krisenphasen zei...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Beiträge
- Rezensionen
- Bibliographie
- Anschriften der Autorinnen und Autoren
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu 2016/2017 von Holger Hof, Stephan Kraft, Holger Hof,Stephan Kraft, Gottfried-Benn-Gesellschaft im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Deutsche Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.