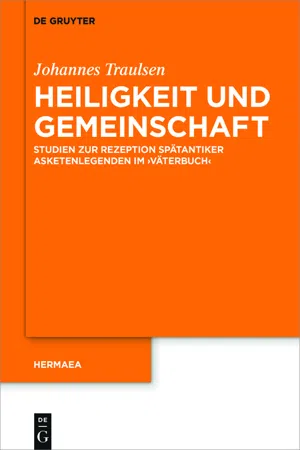1Aufgehoben – Leben in der monastischen Gemeinschaft
Im 3. Jahrhundert begann an den südöstlichen Rändern des römischen Reichs eine folgenreiche Entwicklung: Einzelne Christen lösten sich aus ihren Familien, verließen ihre Wohnorte und zogen sich als Einsiedler in die Wüste zurück, um ihr Leben mit Askese und Kontemplation ganz dem Gottesdienst zu widmen. Diese spätantike eremitische Bewegung war die Keimzelle des christlichen Mönchtums.
Auch wenn sich einige der Eremiten Schweigen auferlegten, waren die meisten von ihnen höchst beredt. Mit der Autorität, die ihnen ihr asketisches Leben eintrug und aufgrund derer sie den Ehrentitel ‚Wüstenväter‘ trugen, prägten sie Sentenzen und Parabeln, die in ihrer Gesamtheit ein Panorama der eremitischen Bewegung und ein Regelwerk für das asketische Leben darstellen. Zusammen mit den Biographien der Wüstenväter wurden ihre Aussprüche in wachsenden Sammlungen schriftlich festgehalten. Das widersprach zwar dem eigentlich schrift- und bildungsfernen Lebensentwurf der Eremiten, ermöglichte aber die Verbreitung ihrer asketischen Ideale. Durch die schriftliche Weitergabe ihrer Biographien und Weisheiten wurden die Eremiten selbst zu Objekten der literarischen Gestaltung. Die Autoren der Einsiedlerviten, allen voran Athanasius von Alexandria und Hieronymus, entwarfen in ihren Texten schon zu deren Lebzeiten die Wüstenväter als Figuren, die für bestimmte Konzepte und Vorstellungen des eremitischen Lebens und der Askese standen. Seit ihren Anfängen sind die Wüstenväter damit auch ein literarisches Phänomen. Die so entstandene Literatur bildete in Europa einen konstitutiven Bestandteil der monastischen Kultur, in der sie aber nicht nur rezipiert, sondern auch immer wieder um- und neugeschrieben wurde. Auf diese Weise entstand ein disparates Konvolut von asketischen Texten, das in unterschiedlichen Zusammensetzungen kursierte und im lateinischen Bereich erst im 17. Jahrhundert von dem Jesuiten Heribert Rosweyde systematisch zusammengefasst wurde.1 In der lateinischen Welt wurden die dem Konvolut angehörigen Texte mit dem mittellateinischen Titel ‚Vitaspatrum‘,2 ‚Leben der Väter‘, bezeichnet.
Die Erinnerung an die Ursprünge der monastischen Kultur in der Wüste wurde zu einer Herausforderung, als ab dem 13. Jahrhundert die Anzahl der Klosterangehörigen wuchs, die kein Latein beherrschten und deshalb nicht mehr in der Lage waren, die ‚Vitaspatrum‘ zu verstehen. Für ein nicht lateinisch gebildetes Publikum entstand um 1280 das ‚Väterbuch‘3 als erste Übersetzung der ‚Vitaspatrum‘ in die deutsche Sprache. Der Text konnte auch in der neuen Sprache seine wichtigen Funktionen erfüllen: Er beleuchtete die Ursprünge des Mönchtums, er vermittelte dessen wichtigste Regeln und Grundsätze und er stellte vorbildliche Figuren vor Augen, an denen man sich orientieren konnte.
Auch wenn das ‚Väterbuch‘ im weitesten Sinne eine Übersetzung der ‚Vitaspatrum‘ ist, so sind doch tausend Jahre des Erzählens und Wiedererzählens nicht spurlos an dem Stoff vorbeigegangen. Viten und Weisheiten der Wüstenväter haben, wenn sie im ‚Väterbuch‘ in deutscher Sprache festgehalten werden, drei historische und kulturelle Schwellen überwunden: Zunächst wurde die Kultur der häufig illiteraten Wüsteneremiten von spätantiken Autoren in griechischer und koptischer Sprache literarisch gestaltet. Die Texte wurden dann aus dem Bereich des nordafrikanischen hellenistischen Christentums in den des europäisch-lateinischen Christentums überführt und dort in lateinischer Sprache weiter tradiert. Schließlich hat man sie im 13. Jahrhundert erstmals aus dem Lateinischen in die Volkssprache übertragen und damit für nicht klerikal Gebildete zugänglich gemacht. So ist das ‚Väterbuch‘ des 13. Jahrhunderts Produkt eines umfassenden Transformationsprozesses: Der Text erinnert an die spätantike Eremitenkultur und schreibt sie fort, zugleich aber macht er sie sich zu eigen, variiert und rekonstruiert sie in einem gänzlich neuen Zusammenhang. Eine Analyse des ‚Väterbuchs‘ – mit Blick auf seine Vorlagen – verspricht daher vertiefte Einblicke in mehrere Zusammenhänge, nämlich in die literarische Tradition der Wüstenvätererzählungen, ihre spezifische Ausformung in der Volkssprache und die Wandlungsprozesse, denen sie unterworfen war. Da dem ‚Väterbuch‘ seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts keine größere Studie mehr gewidmet wurde, ist es an der Zeit, die wichtigsten Aspekte dieses Werkes im Licht der aktuellen Forschung neu zu beleuchten.
Das Leben in der monastischen Gemeinschaft prägte in der Vormoderne ein Aufgehobensein in doppelter Hinsicht: Während die meisten Lebensformen einen kontinuierlichen Identitätsentwurf mit sich brachten, indem etwa die Standeszugehörigkeit ererbt wurde, verlangte das monastische Leben einen Identitätswandel: Man wurde nicht als Einsiedler, Mönch oder Nonne geboren, sondern man trat in dieses Leben ein. Einerseits hob der Übertritt, zumindest formal, die vorherige Identität mit ihren Privilegien und Einschränkungen auf. Andererseits war der neue Ordensangehörige aufgehoben in einer neuen Gemeinschaft mit seinen Brüdern und Schwestern, mit Christus und den Heiligen. Damit war die Entscheidung zum monastischen Rückzug keinesfalls nur eine Entscheidung gegen die Standes- oder Familiengemeinschaft. Die Asketinnen und Asketen verließen ihre ursprünglichen Zusammenhänge und kamen in der Wüste oder im Kloster zu einer neuen Gemeinschaft zusammen, deren gemeinsames Ziel der Gottesdienst war. Entsprechend spielt die monastische Literatur alle möglichen Verhältnisse von Identität, Askese und Gesellschaft durch. Die Exemplarizität der Figuren, die in den Texten als Leitbilder vor Augen gestellt werden, drückt sich auch darin aus, dass sie als Heilige verehrt werden. Doch erscheinen sie nicht als einsame Glaubenshelden, sondern sie verstehen sich, wie die Klosterangehörigen, als Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Die große Bedeutung der Gemeinschaft prägt auch die Entwürfe von Heiligkeit selbst. Bereits in der frühen ‚Augustinusregel‘ bezeichnet communio nicht nur das Leben in einer sozialen und wirtschaftlichen Einheit, sondern die Gemeinschaft der Mönche setzt der Regel zufolge das Leben der urchristlichen Kirchengemeinde fort und ist Bedingung der Gottesnähe.4 Entsprechend erscheint auch die monastische Heiligkeit als Gemeinschaftsprodukt:5 Sie beruht auf dem Wirken des Einzelnen für die Gemeinschaft und sie ist für jeden durch die Teilhabe an der Gemeinschaft zugänglich. Obwohl die monastischen Heiligen sich in ihren Lebensberichten vielfach begegnen, voneinander lernen und füreinander einstehen, hat sich die jüngere germanistische Legendenforschung vor allem auf den Heiligen als einzelne Figur konzentriert. Doch die Betonung der Singularität des oder der Heiligen unterschlägt, dass auch die literarische Inszenierung heiliger Figuren, etwa im ‚Väterbuch‘, deutlich von einem Gemeinschaftsgedanken geprägt ist. Entsprechend werden die folgenden Untersuchungen sich besonders auf das Verhältnis von Heiligkeit und Gemeinschaft konzentrieren. Damit wird nicht nur ein abgeschlossener Bereich innerhalb der vormodernen Literatur beleuchtet, denn die asketische Literatur war im Mittelalter weitläufig bekannt, wovon die umfangreiche Überlieferung zeugt. Es ist außerdem davon auszugehen, dass sie auch den Verfassern der weltlichen mittelhochdeutschen Literatur vertraut war, denn die literarische Tradition der ‚Vitaspatrum‘ hat auch in der höfischen Literatur Spuren hinterlassen.6 Sie werden zum Beispiel dort erkennbar, wo sich Entsagung und Bewährung verbinden, wo sich neue spiritualisierte Gemeinschaften gegenüber weltlichen Zusammenhängen konstituieren und wo Lehrer-Schüler-Verhältnisse von Bedeutung sind. Strukturanalogien zu den ‚Vitaspatrum‘ sind immer dort erkennbar, wo das Vitenschema prägend ist, wo Spruch und Exempel als literarische Formen auftauchen oder wo der Lehrdialog aufgegriffen wird. Betrachtet man diese Prämissen nur mit Blick auf die sogenannte mittelhochdeutsche Klassik, lassen sich auf den ersten Blick sowohl bei Hartmann von Aue als auch bei Gottfried von Straßburg und natürlich bei Wolfram von Eschenbach entsprechende Motiv- und Strukturparallelen feststellen.7 Es ist deshalb zu hoffen, dass die folgenden Ausführungen auch über ihren Gegenstand hinaus etwas zur Erforschung der deutschen Literatur des Mittelalters beitragen können.
Der Untersuchung des ‚Väterbuchs‘ gehen im Folgenden eine Reihe von Vorüberlegungen voran, die den Text kulturell, literarhistorisch und forschungsgeschichtlich einordnen. Dabei wird zunächst auf die Geschichte und die Prinzipien der christlichen Wüstenaskese eingegangen (Kap. 2). Danach werden die literarischen Strömungen dargestellt, die daraus entstanden und die sich zur europäischen Tradition der ‚Vitaspatrum‘ verdichteten. Auf diese Weise soll die Traditionslinie erkennbar werden, an deren vorläufiger Spitze das ‚Väterbuch‘ als erste deutsche Übertragung der ‚Vitaspatrum‘ im späten 13. Jahrhundert steht (Kap. 3). Der Text wird dabei als eine Form legendarischen Erzählens betrachtet, wodurch sich auch Vergleichsmomente mit anderen religiösen Texten ergeben und Anschlussmöglichkeiten an die aktuelle altgermanistische Forschung gegeben sind. Um diese auszuloten, wird nicht nur auf den Stand der Forschung zum ‚Väterbuch‘, sondern auch die Legendenforschung im Allgemeinen eingegangen (Kap. 4).
Der erste Teil der Textanalyse erschließt programmatische Teile des ‚Väterbuchs‘ (Kap. 5). Er behandelt Pro- und Epilog sowie die heilsgeschichtliche Rahmung des Textes, zu der auch eine ‚Siebenschläferlegende‘ und eine Erzählung vom Jüngsten Gericht gehören. Die programmatischen Passagen stellen die den Text prägenden Vorstellungen von Zeit und Geschichte dar und verdeutlichen, in welchem Verhältnis das ‚Väterbuch‘ zu seinem Gegenstand, den Wüstenvätern, steht.
Die folgenden Kapitel entsprechen der Gliederung des ‚Väterbuchs‘ und untersuchen jeweils exemplarische Passagen. Zunächst wird die am Anfang des ‚Väterbuchs‘ stehende ‚Antoniusvita‘ behandelt (Kap. 6). An der Vita werden paradigmatische Prinzipien der Eremitenbewegung und ihrer literarischen Darstellung aufgezeigt. Zudem hat die ‚Antoniusvita‘ im ‚Väterbuch‘ den Charakter einer Gründungserzählung, in der zentrale Aspekte der Einsiedelei (Desozialisierung, Askese, Versuchung, Gemeinschaft) diskutiert werden.
Das folgende Kapitel widmet sich dem zweiten Teil des ‚Väterbuchs‘ (Kap. 7). In diesem Teil steht die Wüste als Handlungsraum und zentrale Denkfigur im Fokus. Als Modus der Erfahrung und als strukturierendes Prinzip der Narration erscheint die Reise beziehungsweise die Reiseerzählung. In der Textanalyse werden drei unterschiedliche Episoden in den Blick genommen. Es werden Fragen der Wissensvermittlung, des Verhältnisses von innerer Haltung und äußerer Lebensform, der Gemeinschaft und der Form und Funktion von Erzählungen verhandelt.
Das anschließende Kapitel nimmt die zahlreichen Sprüche im ‚Väterbuch‘ in den Blick (Kap. 8). Sie sind bislang am wenigsten untersucht worden. Ausgehend von Überlegungen zur literarischen Form des Spruchs werden die Sprüche und Mikronarrative so weit wie möglich systematisiert und gruppiert. Die Analyse richtet sich auf besonders markante Komplexe und Einzelsprüche, die sowohl inhaltlich als auch formal auf ihre Funktion und Bedeutung für den Gesamttext hin betrachtet werden. Dabei werden besonders die Regelhaftigkeit der Sprüche und ihre Rolle bei der Konstitution einer monastischen Lebensform in den Blick genommen.
Das letzte Analysekapitel behandelt die längeren Legenden im letzten Teil des ‚Väterbuchs‘ (Kap. 9). Die auf den ersten Blick heterogen erscheinenden Texte sind durch das Thema des Identitätswechsels und den damit zusammenhängenden Gemeinschaftsbezug miteinander verbunden. Sie alle befassen sich mit verschiedenen Konfigurationen des Zusammenlebens, wobei Familienbeziehungen eine besondere Rolle zukommt. Am Ende folgt ein kurzer, die Arbeit zusammenfassender und perspektivierender Abschnitt.