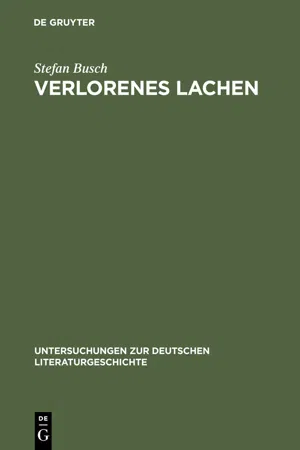
Verlorenes Lachen
Blasphemisches Gelächter in der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart
- 221 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Verlorenes Lachen
Blasphemisches Gelächter in der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart
Über dieses Buch
In literarischen Texten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Lachen, in der jüdisch-christlichen Überlieferung als signum infidelitatis verdächtigt, im Zeichen aufklärerischer Zweifel und der Theodiezeeproblematik mit beeindruckender Geschwindigkeit zu einem weit verbreiteten Motiv. Die motivgeschichtliche Arbeit diskutiert eingangs die theologischen und anthropologischen Bedingungen für dieses literarische Phänomen; die außerliterarischen Parallelen werden dabei anhand von historischen Fallstudien (u.a. aus dem »Magazin für Erfahrungsseelenkunde« und M. Foucaults »Pierre Rivière«) einbezogen.
Im Hauptteil der Untersuchung werden kanonische Texte aus drei Jahrhunderten auf die sich verändernden Funktionen des Lachmotivs hin befragt. In seinen ersten Jahrzehnten ist die Kombination theologischer und gesellschaftlicher Krisen charakteristisch. Dies gilt für Lessings »Minna von Barnhelm« ebenso wie etwa für Moritz' autobiographischen Roman »Anton Reiser«, die »Nachtwachen des Bonaventura«, Tiecks Romanfragment »Der Aufruhr in den Cevennen« und Büchners Erzählung »Lenz«. In »Der Ketzer von Soana« scheiterte Hauptmann bei dem Versuch, menschlichem Lachen eine neuheidnische Unschuld zuzuschreiben. Im christlichen Kulturkreis enthält Lachen unvermeidlich Anklänge metaphysischer Rebellion.
Die Untersuchung zeigt abschließend, wie diese Tatsache in Texten des späten 20. Jahrhunderts (so z.B. bei Wolf, Ransmayr, v. Düffel) als Störfaktor wirken und die ästhetische Stringenz bedrohen kann. Wie sich schon in Thomas Manns »Faustus«-Roman andeutete, kam der motivgeschichtliche Alterungsprozeß dort zu einem (vorläufigen?) Abschluß, wo blasphemisches Lachen nur noch eine Marke in einem postmodernen Zitierspiel ist.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Entstehungsbedingungen des Motivs
- 1. »Die Welt lacht / Jesus weint. Mit einem muß mans halten.« – Zur lachfeindlichen Tradition im Christentum
- 2. Der Geist, der lachend stets verneint – Zur Psychologie des verzweifelten Lachens
- 3. Irre, Tod und Teufel – Blasphemisches Lachen als Provokation der aufgeklärten Gesellschaft
- III. Unter dem Einfluß Saturns – Wandlungen des Motivs von Klopstock bis Büchner
- 1. Das Lachen des Hohepriesters Philo in Klopstocks Messias
- 2. »Ich habe nie fürchterlicher fluchen hören« – Das Lachen des Melancholikers Teilheim
- 3. Klingers Die Zwillinge: Rollenspiel, Zitat und Selbstbeobachtung
- 4. Anton Reisers unterdrücktes Gelächter – Blasphemie hinter vorgehaltener Maske
- 5. Die Kunst, über »das tolle Spiel der Welt« zu lachen – Wezels Belphegor und die Nachtwachen des Bonaventura
- 6. Tiecks Der Aufruhr in den Cevennen und Büchners Lenz – Pathogener Glaube und Weltverlust
- IV. »Jahrhundertealtes Gelächter« – Ausklänge im 20. Jahrhundert
- 1. Einmal lacht’ ich wie Götter – Gerhart Hauptmanns Konstruktion einer neuheidnischen Unschuld in Der Ketzer von Soana
- 2. Von Die Schlafwandler zu Der Tod des Vergil – Das leise Verklingen des blasphemischen Lachens bei Hermann Broch
- 3. Das unmögliche Lachen der Übertretung bei Georges Bataille
- 4. Nachleben im Zitat: Joseph Roths Hiob und Thomas Manns Doktor Faustus
- V. Vom Nachleben eines Motivs in Zeiten seiner Obsoletheit
- 1. Einleitende Bemerkung zu einer motivgeschichtlichen Spätzeit
- 2. Der triviale Kontrast: Die Hohlheit des Pathos in Dürrenmatts Der Richter und sein Henker und Robert Schneiders Schlafes Bruder
- 3. »Höllengelächter« – Blasphemische Konnotationen als Störfaktor in von Düffels Vom Wasser und Christa Wolfs Kein Ort. Nirgends
- 4. Vorläufiges Ende oder »Play it again, Sam«: Bodo Kirchhoff, Infanta
- Literaturverzeichnis