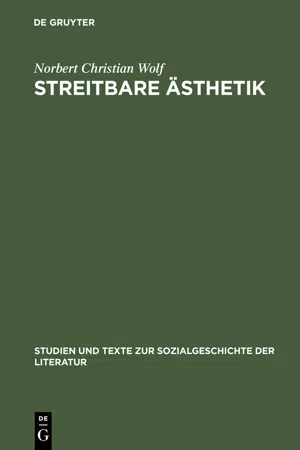
Streitbare Ästhetik
Goethes kunst- und literaturtheoretische Schriften 1771–1789
- 575 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Streitbare Ästhetik
Goethes kunst- und literaturtheoretische Schriften 1771–1789
Über dieses Buch
Die Studie bemüht sich um eine genaue Rekonstruktion des ästhetischen Denkens Goethes von den frühesten Äußerungen bis zu den Ergebnissen der italienischen Reise. Dieses Untersuchungsgebiet ist insbesondere deshalb von großem transdisziplinärem Interesse, als sich hier schon sehr früh Tendenzen zur Autonomisierung der Künste und zur theoretischen Reflexion dieses Prozesses abzeichnen. Darüber hinaus stellen die lakonischen, genialisch-rhapsodischen oder manifestartig verknappten Essays Goethes auch in formaler Hinsicht ein Spezifikum dar: Sie thematisieren und reflektieren ihren theoretischen Gehalt selbst in ihrer textuellen Performanz. In methodischer Anlehnung an Pierre Bourdieus Theorie des literarischen Feldes unternimmt der Verfasser eingängige intertextuelle Mikroanalysen paradigmatischer und programmatischer theoretischer Schriften (»Zum Schäkespears Tag«, »Von deutscher Baukunst«, »Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl«) und berücksichtigt dabei erstmals auf systematische Weise sowohl die unmittelbaren Entstehungsumstände und künstlerischen Bezugspunkte als auch v.a. die epistemologischen und ideengeschichtlichen Voraussetzungen im übernationalen europäischen Kontext. Ein Ergebnis der Studie ist die genauere Differenzierung zwischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten im ästhetischen Denken Goethes auf epistemologischem und auf kognitivem Niveau. Des weiteren wird die kultursoziologische und diskurshistorische Funktionalität zahlreicher Phänomene in den Blick genommen. Die Spezifik wie auch die Exemplarität des (häufig geringgeschätzten) nicht-systematischen "Ästhetikers" Goethe können somit vor einem erweiterten Horizont neu diskutiert werden.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einführung
- 1. Leitlinien der Untersuchung
- 2. Die Spezifik der ästhetischen Reflexionen Goethes
- 3. Literarisches Feld und polemisches Denken: Zur Methode
- TEIL 1: 1771/72
- I. Genieästhetik in genialischer Form: Die Inszenierung charakteristischer Subjektivität in Goethes Rede Zum Schäkespears Tag (1771)
- 1. Zu einigen ideengeschichtlichen Voraussetzungen der Shakespeare-Rede im europäischen Genie-Diskurs des 18. Jahrhunderts
- 1.1 Vorläufer
- 1.2 Zentrale Texte
- 1.3 Wende der Aufklärung
- 2. Emphatik, Rhapsodik und Opazität als Pensum einer Anthropologie des Genies
- 2.1 Die epistemologische Grundlage des Darstellungsproblems
- 2.2 Spontaneität als inszenierte Textstrategie
- 3. Die Epiphanie des gottgleichen Genies als Problem der Ästhetik
- 3.1 Radikale Immanenz und schöpferische Autonomie
- 3.2 Symbolische Verdichtung als ästhetische Vermittlung
- 4. Auratische Originalität als Darstellungsprinzip und polemische Strategie im literarischen Feld
- 4.1 Grundpositionen der Genieästhetik
- 4.2 Die Attacke auf Wieland
- 4.3 Die Attacke auf Voltaire
- 4.4 Originalitätspostulat und Verzicht auf Publikation
- 5. Bruchstücke einer revolutionären Dramenpoetik aus der Konsequenz des Genie-Diskurses
- 5.1 Kunst als Natur
- 5.2 Kunst und Geschichte
- 5.3 Der ›geheime Punkt‹ und das Böse
- II. Ästhetische Konzeption und Konzeption der Ästhetik im Essay Von deutscher Baukunst (1772). Mit Blick auf die Frankfurter gelehrten Anzeigen
- 1. Performanz als polemisches und kompositorisches Kalkül
- 1.1 Die polemische Funktion des genialischen Darstellungsprinzips
- 1.2 Die Komposition von struktureller Tektonik und motivischer Textur
- 2. Ein Abschied vom Prinzipiellen aus dem Geist sensualistischer Vernunftkritik
- 2.1 Ästhesiologie und Kunstwahrnehmung
- 2.2 Stellenwert der Baukunst in der Ästhetik
- 2.3 Das ästhetische Erkenntnismodell des jungen Goethe
- 3. Die Vergötterung des kreativen Genies als Instrument der Autonomisierung
- 3.1 Methode der Ambivalenz
- 3.2 Verabschiedung der Wirkungsästhetik
- 3.3 Zur sozialen Funktion säkularisierter Frömmigkeitsformen in der Kunstreligion
- 4. Die Proklamation der charakteristischen Kunst gegen die Doktrin des Schönen. Eine Revolution im Feld der Ästhetik
- 4.1 Verdrängung der Nachahmung durch die Schöpfung
- 4.2 Depotenziemng der klassizistischen Schönheitsdoktrin
- 4.3 Goethes ›Begriff‹ des Erhabenen
- 4.4 Der organische Zusammenhang ›charakteristischer Kunst‹
- TEIL 2: 1788/89
- III. Goethes italienische Ästhetik als Fanal des kallistischen Objektivismus: Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl (1789) im Kontext der Reiseschriften
- 1. Sprachliche Transparenz als Pensum und Darstellungsprinzip klassischer Ästhetik
- 1.1 Adelungs klassizistische Stillehre und Goethes klassisches Stilideal
- 1.2 Die Bedeutung Wielands
- 1.3 Die Bedeutung Winckelmanns
- 1.4 Der klassische Stil als Medium ›etablierter Avantgarde‹
- 2. Die Begriffsarchitektur von Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl
- 2.1 Entwicklungsgeschichte und Typologie
- 2.2 Differenzierung des Nachahmungsbegriffs
- 2.3 Goethes Konzept der Manier als Revokation der ›charakteristischen Kunst‹
- 2.4 Die Inszenierung des ›Styls‹ als Synthese
- 3. Der theoriegeschichtliche Ort von Goethes klassischer Begriffsarchitektur
- 3.1 Naturnachahmung und Manier in der kunsttheoretischen Idea-Tradition
- 3.2 Der Diskussionshorizont der zeitgenössischen Kunsttheorie
- 3.3 Die historische Leistung von Goethes Stil-Begriff
- IV. Der objektive ›Styl‹ zwischen Naturwissenschaft und Kunstautonomie. Versuch einer Rekonstruktion mit Ausblicken bis zur Winckelmann-Schrift (1805)
- 1. Das Verhältnis von Kunst und Natur
- 1.1 Italienische Erfahrungen
- 1.2 Die ›hochklassische‹ Position
- 1.3 Morphologische Differenzierungen
- 2. Die klassische Adaption des sensualistischen Wahrnehmungs- und Erkenntniskonzepts
- 2.1 Schule des Sehens
- 2.2 Gegenständliches Denken
- 2.3 Ästhetische und anthropologische Implikationen
- 3. Die Neubegründung des normativen Schönheitspostulats im Rahmen klassischer Kunstautonomie
- 3.1 Reinstallation einer klassizistischen Schönheitsdoktrin
- 3.2 Innere Vollkommenheit des Kunstwerks
- 3.3 ›Uneigennützigkeit‹ des Rezipienten
- 3.4 ›Uneigennützigkeit‹ des Künstlers
- 3.5 Differenzen zwischen Goethe und Moritz
- 4. Subjekt, Objekt und Methode des ›Styls‹
- 4.1 Geistige Disposition
- 4.2 Gegenstandsbereich und methodisches ›Prinzip‹
- Schlußbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Register