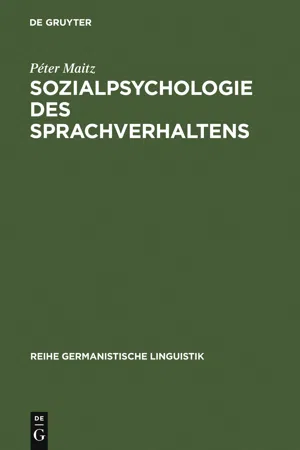
Sozialpsychologie des Sprachverhaltens
Der deutsch-ungarische Sprachkonflikt in der Habsburgermonarchie
- 237 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Sozialpsychologie des Sprachverhaltens
Der deutsch-ungarische Sprachkonflikt in der Habsburgermonarchie
Über dieses Buch
Die im Buch dokumentierten Untersuchungen haben eine doppelte Zielsetzung: (a) die Erklärung des Sprachverhaltens verschiedener sozialer Gruppierungen in einer historischen Sprachkonfliktsituation, und im Zusammenhang damit (b) die Klärung der Frage, ob die zur Lösung dieses soziolinguistischen Problems angewendete bzw. anhand der Lösung dieses Problems erprobte sozialpsychologische Verhaltenstheorie, die Theorie des geplanten Verhaltens, tatsächlich im Stande ist, Spracherhalt und Sprachwechsel als sprachliche Verhaltensweisen zu erklären und vorherzusagen.
Zunächst werden anhand sprachstatistischer Daten zur Muttersprache bzw. zu den Sprachkenntnissen der Sprecher die zu erklärenden sprachlichen Verhaltensweisen beschrieben. Im nächsten Schritt werden die theoretischen und methodologischen Grundlagen der Untersuchung umrissen. So wird der Stellenwert des Untersuchungsgegenstandes (Sprachverhalten im Sprachkonflikt) innerhalb der Sprachgeschichtsschreibung und der Kontaktlinguistik bestimmt sowie die Begrifflichkeit der Theorie des geplanten Verhaltens eingeführt. Auf diese Ausführungen folgen die Untersuchungen zu den Hintergründen der beschriebenen Sprachverhaltensweisen: zum Sprachwechsel der Sprecher des traditionell deutschsprachigen Bürgertums und zum Spracherhalt der deutschsprachigen bäuerlichen Dorfbevölkerung während des deutsch-ungarischen Sprachkonflikts in Ungarn im Zeitalter der Habsburgermonarchie (1867-1918).
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 0. Einleitung
- 0.1. Definition des Begriffs und wissenschaftliche Einordnung des Gegenstandes ,Sprachkonflikt'
- 0.2. Zeitliche und räumliche Abgrenzung der untersuchten Sprachkonfliktsituation
- 0.3. Der deutsch-ungarische Sprachkonflikt in Ungarn zwischen 1867 und 1918 als Gegenstand bisheriger Forschung
- 0.4. Aufbau und Gliederung der Arbeit
- 1. Problemstellung
- 1.1. Das Sprachverhalten im Spiegel der Bevölkerungs- und Sprachstatistik
- 1.2. Konklusion
- Theoretische Grundlagen
- 2. Sprachkonflikt als Gegenstand der Sprachgeschichte
- 2.1. Problemstellung: Die Geschichte des Deutschen in Ungarn – Forschungsstand und Forschungsdefizite
- 2.2. Der (deutsch-ungarische) Sprachkonflikt als Forschungsgegenstand vor dem Hintergrund sprachhistorischer Theoriebildung
- 2.3. Der Lösungsversuch: Soziopragmatische Sprachgeschichtsschreibung als Untersuchungsrahmen von Sprachkonflikt
- 2.4. Das 19. Jahrhundert und der Sprachkontakt als Gegenstände einer soziopragmatischen Sprachgeschichte
- 2.5. Zusammenfassung
- 3. Sprachkonflikt als Gegenstand der Kontaktlinguistik
- 3.1. ,Sprachkonflikt'
- 3.2. ,Spracheinstellung'
- 3.3. Die Theorie des geplanten Verhaltens
- 3.4. Konklusion
- Analysen
- 4. Vorbemerkungen
- 5. Die Vorgeschichte des Sprachkonflikts
- 5.1. Die Herausbildung der deutschen Sprachgemeinschaft Ungarns
- 5.2. Der (sprach)ideologische und sprachenpolitische Existenzrahmen
- 5.3. Zusammenfassung
- 6. Zur Morphologie der deutschen Sprachgemeinschaft Ungarns 1867–1918
- 6.1. Das Bürgertum
- 6.2. Die bäuerliche Dorftbevölkerung
- 6.3. Terminologischer Exkurs: Sprachinsel'
- 6.4. Konklusion
- 7. Entstehung des Sprachkonflikts: die auferlegten Gewalt- und Machtstrukturen und ihre Folgen auf das Sprachverhalten
- 7.1. Ideologisierung von Sprache
- 7.2. Sprachenpolitik
- 7.3. Die Folgen der auferlegten Gewalt- und Machtstrukturen auf das Sprachverhalten
- 7.4. Konklusion
- 8. Die Hintergründe des Sprachverhaltens im Lichte der Theorie des geplanten Verhaltens
- 8.1. Methodologische Vorbemerkungen
- 8.2. Das Bürgertum
- 8.3. Die bäuerliche Dorftbevölkerung
- 9. Schlussfolgerungen und Ergebnisse
- 9.1. Rückblick
- 9.2. Objektebene
- 9.3. Metaebene
- Literatur
- Anhang