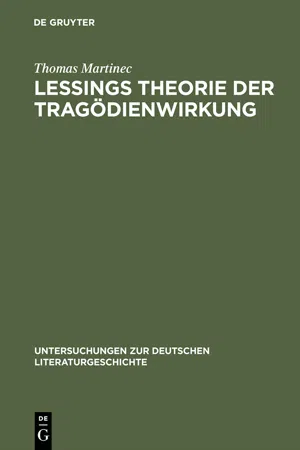
Lessings Theorie der Tragödienwirkung
Humanistische Tradition und aufklärerische Erkenntniskritik
- 257 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Lessings Theorie der Tragödienwirkung
Humanistische Tradition und aufklärerische Erkenntniskritik
Über dieses Buch
Als Friedrich Nicolai seinem Freund Lessing 1756 schrieb, Aristoteles habe sich mit seiner Behauptung, daß die Tragödie durch die Erregung von Leidenschaften den Zuschauer bessere, geirrt, konnte er nicht ahnen, daß seine Kritik eines der originellsten Tragödienmodelle der deutschen Literaturgeschichte hervorrufen würde: Lessings Theorie nämlich, wonach die Tragödie den Zuschauer bessert, indem sie dessen Mitleid erregt. Die vorliegende Studie untersucht, aus welchen Quellen sich diese Theorie speist. Auf der Basis einer präzisen Erschließung der verschiedenartigen Probleme, mit denen sich Lessing im Rahmen seiner Überlegungen zur Tragödienwirkung auseinandersetzt, werden die Voraussetzungen für sein Modell sowohl in der humanistischen Tradition als auch in der aufklärerischen Erkenntniskritik, vor allem bei Leibniz, Wolff, Baumgarten, Mendelssohn und Hutcheson, identifiziert. Dabei wird gezeigt, daß und auf welche Weise Lessing überlieferte Vorstellungen auf der Grundlage der zeitgenössischen Philosophie in ein neuartiges Modell überführt. Um diesen Wandel zu skizzieren, untersucht die Studie vor allem die Umformung des Affekts von einem rhetorischen Mittel der Persuasion zu einer spezifischen Erkenntnisart, wobei Lessings eigenwilligem Umgang mit den hierfür relevanten Quellen, allen voran dem aristotelischen Tragödiensatz und Mendelssohns Theorie der vermischten Empfindungen, besondere Aufmerksamkeit zukommt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil. Die sinnliche Wirkung des Trauerspiels
- 1. Der rhetorische Affektbegriff als Grundlage tragödienpoetologischer Wirkungsvorstellungen in Antike, Humanismus und Barock
- 1.1. Die Vorstellung von der Steuerbarkeit des Affekts in der Rhetorik
- 1.2. Der rhetorische Affektbegriff in der antiken, humanistischen und barocken Tragödientheorie
- 2. Entstehung und Entwicklung eines neuartigen Affektbegriffs durch die Erkenntniskritik der Aufklärung
- 2.1. Lessings Distanz zur Rhetorik
- 2.2. Die Problematisierung der Erkenntnis durch Leibniz und Wolff
- 2.3. Die Emanzipierung der sensitiven Erkenntnis gegenüber der Vernunft durch Baumgarten
- 2.4. Mendelssohns »Psychologie« des Empfindens
- 3. Die Tragödienpoetik der Aufklärung als Spiegelung der erkenntniskritischen Affektdiskussion
- 3.1. Handlungsprimat und Erkenntnishierarchie bei Gottsched
- 3.2. Charakterprimat und »analogon rationis« bei den Schweizern und J. E. Schlegel
- 3.3. Das Fühlen des Zuschauers als Kriterium in Lessings Überlegungen zur sinnlichen Wirkung des Trauerspiels
- 3.4. Das Fühlen des Zuschauers als Kriterium in Lessings Interpretation des aristotelischen Tragödiensatzes
- Zweiter Teil. Der moralische Zweck des Trauerspiels
- 4. Die rhetorische Einheit von sinnlicher und moralischer Wirkung des Trauerspiels in der humanistischen Tradition
- 4.1. Die moralische Funktionalisierung des Tragödienzwecks im rhetorischen Zusammenhang
- 4.2. Die Einheit von sinnlicher und moralischer Wirkung des Trauerspiels in Humanismus und Barock
- 5. Die Theorie des Tragödienzwecks vor dem Hintergrund der aufklärerischen Moralphilosophie
- 5.1. Die moralphilosophische Auseinandersetzung um den Ursprung sittlichen Verhaltens in der frühen Aufklärung
- 5.2. Gottscheds Rückführung des moralischen Tragödienzwecks auf einen vernünftigen Satz
- 5.3. Die Ausrichtung des Tragödienzwecks auf ein moralisches Empfinden durch Bodmer und Breitinger
- 6. Lessings Vorstellung vom sittlichen Zweck des Trauerspiels vor dem Hintergrund der aufklärerischen Moralphilosophie
- 6.1. Die Auseinandersetzung zwischen Lessing und Mendelssohn um den Ursprung moralischen Verhaltens
- 6.2. Die Differenzen von Lessings Konzept des moralischen Tragödienzwecks zur »moral sense«-Philosophie und zur Position der Schweizer
- 6.3. Impulse für Lessings Idee eines moralisch wirksamen Mitleids
- Dritter Teil. Die Quelle des ästhetischen Vergnügens
- 7. Die Entstehung der Auseinandersetzung zwischen Lessing und Mendelssohn um die Quelle des ästhetischen Vergnügens
- 8. Der Ursprung des ästhetischen Vergnügens als erkenntniskritisches Problem in der aufklärerischen Poetik
- 8.1. Rationalistische Modelle des ästhetischen Vergnügens
- 8.2. Sensualistische Modelle des ästhetischen Vergnügens
- 9. Die Auseinandersetzung zwischen Lessing und Mendelssohn um die Quelle des ästhetischen Vergnügens als Ausdruck eines psychologischen Bewußtseins
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- 1. Quellen
- 2. Forschungsliteratur