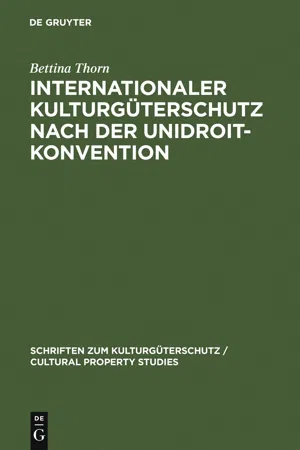
- 436 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Internationaler Kulturgüterschutz nach der UNIDROIT-Konvention
Über dieses Buch
Kulturgüter bedürfen auf Grund ihrer Einmaligkeit eines besonderen Schutzes, der nicht allein mit finanziellen und tatsächlichen Mitteln, sondern auch auf rechtlicher Ebene durchgesetzt werden muss. Die vorliegende Arbeit stellt die Möglichkeiten des rechtlichen Schutzes von Kulturgütern anhand der UNIDROIT-Konvention über gestohlene oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter vom 24. 06. 1995 dar, deren Verabschiedung einen Meilenstein auf dem Weg zur Lösung des Problems des illegalen Handels mit Kulturgütern bildet.
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Zunächst erfolgt eine Gesamtschau des rechtlichen Rahmens des Kulturgüterschutzes aus völkerrechtlichen Verträgen und europäischen Rechtsakten. Es folgt die Einzelanalyse der Regelungen der UNIDROIT-Konvention. Daran schließt sich eine Gegenüberstellung der Konvention und nationaler gesetzlicher Bestimmungen in ausgewählten europäischen Ländern und freiwilliger Verhaltenskodizes an, wobei ein Schwerpunkt auf dem Kulturgüterschutz in Deutschland liegt.
So zeigt die vorliegende Arbeit auf, dass ein wirksamer Kulturgüterschutz die Zusammenarbeit der Staaten und der kulturellen Einrichtungen, welche durch völkerrechtliche Regelungen und nationale Gesetzgebung abgestützt werden muss, erfordert. Die Ratifizierung der UNIDROIT-Konvention erweist sich demnach als äußerst wünschenswert, wobei aber auch Revisionsmöglichkeiten des Konventionstextes hinsichtlich der Einrichtung eines internationalen Registers gestohlener Kulturgüter und einer allgemeinen Meldepflicht für Diebstähle bedeutender Kulturgüter erörtert werden.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- § 1 Einleitung
- I. Ziel der Arbeit
- II. Die gegebene rechtliche und tatsächliche Situation
- 1. Problemstellung
- 2. Lösungsansätze
- III. Definition des Begriffes „Kulturgut“
- § 2 Rechtlicher Rahmen
- I. Schutz von Kulturgütern im Krieg als erste und besondere Entwicklungslinie des Kulturgüterschutzes
- 1. Beuterecht im Krieg
- 2. Wandel der Anschauungen
- 3. Die Haager Landkriegsordnungen von 1899 und 1907
- 4. Der Washingtoner Vertrag vom 15.4.1935
- 5. Die UNESCO-Konvention vom 14.5.1954
- II. Nationale, europäische und internationale Ansätze zu einem allgemeinen Kulturgüterschutz
- 1. Denkmalschutzgesetze
- 2. Zuordnungsgedanken
- 3. Kulturgüterschutz in Europa
- 4. Universelle Abkommen
- III. Kulturgüterschutz durch die UNESCO
- 1. Das Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut vom 14.11.1970
- 2. Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von 1972
- 3. Auswirkungen der UNESCO-Konventionen auf den internationalen Schutz von Kulturgütern
- IV. Zusammenfassende Bewertung
- § 3 Analyse der UNIDROIT-Konvention
- I. Die Notwendigkeit einer internationalen Regelung
- 1. Mängel der bisherigen Regelungen
- 2. Internationales Privatrecht
- 3. Die Notwendigkeit einheitlicher privatrechtlicher Regelungen
- II. Entstehung der Konvention
- 1. Das Internationale Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts
- 2. Die Entwicklung der Konvention durch UNIDROIT
- III. Allgemeine Grundzüge der UNIDROIT-Konvention
- 1. Anwendungsbereich der UNIDROIT-Konvention
- 2. Rechtsnatur der UNIDROIT-Konvention
- 3. Tragende Grundsätze der UNIDROIT-Konvention
- IV. Präambel
- V. Die Kulturgüter und ihre Definition
- VI. Die Rückgabe der gestohlenen Güter
- 1. Die Kompromisslösung der Art. 3 und 4 UNIDROIT-Konvention
- 2. Fall: Winkworth v. Christie’s
- 3. Zusammenfassung und Kritik
- 4. Prozessrechtliche Überlegungen
- VII. Die archäologischen Funde
- 1. Besondere Gefährdungen archäologischer Kulturgüter
- 2. Die Regelungen der UNIDROIT-Konvention
- 3. Der Interessenkonflikt zwischen Archäologie und Kunsthandel
- 4. Wertung der Lösungsmöglichkeiten durch die UNIDROIT-Konvention
- VIII. Die Rückführung der rechtswidrig ausgeführten Güter
- 1. Beschränkung des Anwendungsbereichs
- 2. Öffentlich-rechtlicher Charakter des Rückgabeanspruchs
- 3. Vergleich des III. Kapitels der UNIDROIT-Konvention mit der Richtlinie 937/EWG
- 4. Ergebnis
- IX. Der Ausgleichsanspruch des Besitzers
- 1. Höhe der Entschädigung
- 2. Voraussetzungen
- 3. Besondere Ansprüche an die Feststellung des guten Glaubens
- 4. Zusammenfassung
- X. Die Verjährungsfristen
- 1. Die Regelungen der Konvention
- 2. Internationaler Vergleich der Verjährungsfristen
- 3. Zusammenfassung
- XI. Allgemeine Bestimmungen der UNIDROIT-Konvention
- 1. Die Gerichtstandsregelung
- 2. Die Möglichkeit der Übertragung an ein Schiedsgericht
- 3. Der „favor legis rei sitae“ für dringliche Maßnahmen
- 4. Der „favor legis nationalis“
- 5. Rückwirkung der Konvention
- XII. Schlussbestimmungen der UNIDROIT-Konvention
- XIII. Kritik
- 1. Definition der Schutzobjekte der Konvention
- 2. Die Verjährungsfristen
- 3. Die Durchbrechung des Territorialitätsgrundsatzes
- 4. Die Umkehr der Beweislast
- 5. Die Gerichtstandsregelung
- 6. Zusammenfassung
- XIV. Eigene Stellungnahme
- § 4 Vergleich der Gesetzgebung einzelner europäischer Länder mit den Gedanken der UNIDROIT-Konvention
- I. Der Kulturgüterschutz in Großbritannien
- II. Der Kulturgüterschutz in der Schweiz
- 1. Die bisherige Rechtslage
- 2. Das neue Kulturgütertransfergesetz
- 3. Ausblick
- III. Der Kulturgüterschutz in Österreich
- 1. Allgemeines Zivilrecht
- 2. Sonderregeln für Kulturgüter
- 3. Haltung zur UNIDROIT-Konvention
- IV. Der Kulturgüterschutz in Italien
- 1. Definition von Kulturgut
- 2. Instrumente des Kulturgüterschutzes
- 3. Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten
- 4. Ratifikation der UNIDROIT-Konvention und Umsetzung
- V. Der Kulturgüterschutz in Spanien und Portugal
- VI. Der Kulturgüterschutz in Frankreich
- VII. Der Kulturgüterschutz in der Bundesrepublik Deutschland
- 1. Die Regelungen des BGB
- 2. Fall: Kunstsammlungen zu Weimar v. Elicofon
- 3. Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung
- 4. Kulturgüterrückgabegesetz
- 5. Kollisionsrecht
- VIII. Zusammenfassung
- IX. Umsetzung der Gedanken der UNIDROIT-Konvention in freiwilligen Maßregelungen wie Verhaltenskodizes
- 1. Die ICOM Ethischen Richtlinien für Museen
- 2. Verhaltenskodizes anderer Verbände
- 3. Zusammenfassung
- § 5 Zusammenfassung und Ergebnis
- I. Vorschläge zur Ergänzung der UNIDROIT-Konvention
- II. Abschlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- I. Völkerrechtliche Verträge
- 1. UNIDROIT-Konvention über gestohlene oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter vom 24.6.1995
- 2. Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut vom 14.11.1970 (UNESCO-Konvention von 1970)
- II. EG-Vorschriften
- 1. Verordnung (EWG) Nr. 3911/92 des Rates vom 9.12.1992 über die Ausfuhr von Kulturgütern
- 2. Richtlinie 93/7/EWG des Rates über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern vom 15.3.1993
- III. Deutsche Vorschriften
- 1. Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung vom 6.8.1955
- 2. Kulturgüterrückgabegesetz – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG des Rates über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern und zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung
- IV. Verhaltenskodizes
- 1. ICOM Ethische Richtlinien für Museen
- 2. Berliner Erklärung über Leihgaben und Neuerwerbungen von archäologischen Objekten durch Museen
- 3. Verhaltenskodex für den internationalen Handel mit Kunstwerken des Bundesverbandes des Deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels (BDKA)
- 4. Verhaltensgrundsätze des Bundesverbandes Deutscher Kunstversteigerer e.V. (BDK)
- Stichwortverzeichnis