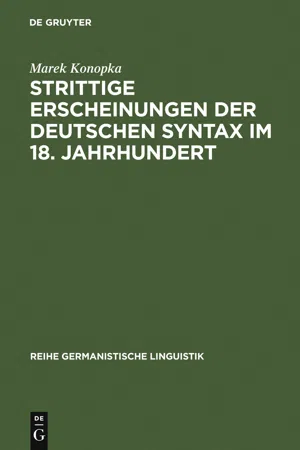
- 264 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Strittige Erscheinungen der deutschen Syntax im 18. Jahrhundert
Über dieses Buch
Das 18. Jahrhundert wird von den meisten Forschern als eine Epoche angesehen, in der sich die heute geltenden syntaktischen Regeln herausbildeten. Es stellt sich die Frage, welche Rolle den Sprachtheoretikern in diesem Prozeß zukam. Die Arbeit nimmt sich dieser Problematik an, indem sie diejenigen Erscheinungen der deutschen Syntax im 18. Jahrhundert untersucht, die in der zeitgenössischen Syntaxbeschreibung unterschiedlich beurteilt wurden.
Zunächst werden auf der Suche nach kontroversen syntaktischen Äußerungen 17 Grammatiken und Rhetoriken aus dem 18. Jahrhundert analysiert. Diese Teiluntersuchung zeichnet die wissenschaftliche Entwicklung der Syntaxbeschreibung nach und zeigt, wie die Forderungen des jeweiligen Sprachtheoretikers in der (etwa aufklärerischen oder kanzleisprachlichen) Tradition, in der er stand, eingebettet waren. Anschließend wird anhand von 37 Quellen der Sprachgebrauch in den als strittig erkannten Bereichen (Wortstellung und Satzkomplexität) untersucht, wobei zeitliche, räumliche und textsortenspezifische Unterschiede im Sprachgebrauch festgestellt werden. Der darauffolgende Vergleich der Ergebnisse beider Teiluntersuchungen zeigt zunächst, wie die Kontroversen unter den Sprachtheoretikern die Variation im Sprachgebrauch widerspiegeln. Zum Schluß führt er zur endgültigen Bestimmung des wissenschaftlichen und praktischen Wertes der Anweisungen einzelner Sprachtheoretiker.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Vorbemerkung
- 2. Einige Erklärungen zur Beschreibung der Objektsprache
- 2.1. Der Satz
- 2.2. Folgeelemente und Stellungsfaktoren
- 2.3. Satzrahmen
- 2.4. Stellungsfelder
- 3. Sprachgeschichtlicher Forschungsstand als Ausgangspunkt der Untersuchung
- 3.1. Syntax des Neuhochdeutschen seit dem 17. Jahrhundert
- 3.2. Sprachreflexion im 18. Jahrhundert
- 3.3. Sprachreflexion und Sprachgebrauch
- 4. Stellung der vorliegenden Arbeit im Forschungsspektrum
- II. Untersuchung der Sprachreflexion
- 1. Aufbau des Corpus I
- 2. Grundlinien und Grundbegriffe der Sprachreflexion: Vom Denken zum Text
- 2.1. Sprachphilosophische Grundlagen
- 2.2. Grundbegriffe der Syntax
- 2.3. Vorbilder der Sprachreflexion
- 2.4. Abschließende Bemerkungen zu Konsequenzenen für die Satz- und Textgestaltung
- 3. Satzrahmen
- 3.1. Bewußtsein des Rahmenprinzips
- 3.2. Folge mehrerer (potentiell) rahmenschließender Elemente
- 3.3. Folgeelemente im Mittelfeld und Nachfeld
- 3.4. Afinite Nebensätze
- 3.5. Andere Folgeelemente als Subjekt im Vorfeld
- 3.6. Zusammenfassung
- III. Untersuchung des Sprachgebrauchs
- 1. Aufbau des Corpus II
- 1.1. Zeit
- 1.2. Textsorte
- 1.3. Raum
- 1.4. Quellenangaben und Codierung der Faktoren Zeit, Raum, Textsorte
- 2. Gegenstand und Methode der Sprachgebrauchsanalyse
- 3. Sprachgebrauchsanalyse
- 3.1. Einfache Folgeelemente
- 3.2. Zu+Infinitivphrasen
- 3.3. Nebensätze
- 3.4. Folge in mehrgliedrigen Verbalkomplexen
- 3.5. Afinite Nebensätze
- 4. Abschließende Bemerkungen zur Untersuchung des Sprachgebrauchs
- IV. Sprachreflexion und Sprachgebrauch
- 1. Deskriptivität der sprachreflexiven Werke
- 1.1. Einfache Folgeelemente
- 1.2. Zu+Infinitivphrasen
- 1.3. Nebensätze
- 1.4. Verbalkomplexe
- 1.5. Fazit
- 2. Präskriptivität
- 2.1. Zeitlicher und räumlicher Zusammenhang zwischen Präskriptivität und Sprachgebrauch
- 2.2. Schreibtraditonen, Darstellungsfunktion und kommunikative Wirksamkeit
- 3. Wirkungsfrage
- V. Rückblick
- Literatur
- 1. Quellen
- 2. Sekundärliteratur
- Anhang