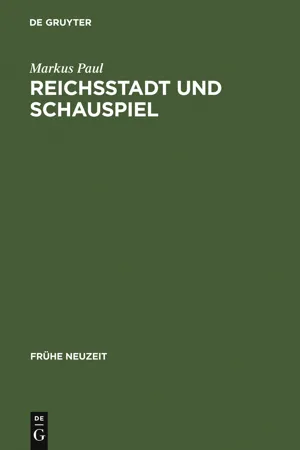
- 699 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Im Barockzeitalter zog nach Richard Alewyn ein »bacchantischer Festzug« durch Europa mit pompösen Theater- und Opernspektakeln im Schlepptau. Anders als weithin angenommen machte der Festzug allerdings nicht nur an den Höfen Station. Dies zeigt das erstmals dargestellte Beispiel der bislang unbekannten theatralen Kunst im Nürnberg des 17. Jahrhunderts, das die vorherrschende Auffassung von der fürstlich geprägten Theaterkultur im Barock korrigiert und demgegenüber den Blick auf die lebendige reichsstädtische Festkultur dieser Zeit richtet.
Im 17. Jahrhundert entwickelte sich im urbanen Raum eine Vielfalt theatralischer Präsentations- und Unterhaltungsformen, die im Rahmen eines paradigmatischen Aufrisses aufgezeigt werden: vom Ballett und Trauerspiel über Schuldramen, Haupt- und Staatsaktionen sowie Hanswurstiaden bis hin zu Festspielen und Opernspektakeln - wobei Nürnberg längere Zeit die heimliche Opernhauptstadt unter den Reichsstädten im Süden Deutschlands war. Vielfach getragen vom Mäzenatentum der Stadtobrigkeit und Großkaufleute bildete die theatrale Kunst einen wesentlichen Faktor im öffentlichen Leben der Reichsstadt. Dies gilt sowohl für die Gastspiele der Wandertruppen, das Schultheater oder die Opernaufführungen zu festlichen Anlässen als auch für die (oft vernachlässigten) theatralen Kleinformen im Kreis geladener Gesellschaften. Beispiele aus all diesen Bereichen belegen, in welch hohem Maße Theater als offizielle Gebrauchskunst für repräsentative und politische Zwecke instrumentalisiert wurde. Dies soll als Anstoß und Beitrag zu einer Neubewertung der Reichsstädte als Zentren und Vermittler von Literatur, Musik und Theater im 17. Jahrhundert verstanden werden.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Der unbekannte Gegenstand? Nürnberg und das Barocktheater. Forschungssituation, Quellenlage und methodische Überlegungen
- TEIL A: VORAUSSETZUNGEN UND BEDINGUNGEN
- 1. Die Situation des Schauspiels und der Bühnen um 1600
- 1.1. Die Engländer kommen und die Meistersinger gehen: Veränderungen in der Nürnberger Theaterlandschaft zu Beginn des 17. Jahrhunderts
- 1.2. Der erste städtische Theaterbau im Alten Reich: das Fechthaus von 1628
- 2. Zwischen Repräsentationswillen und Sittenwahrung: das Theater im Spiegel obrigkeitlichen Stadtregiments
- 3. Musikkultur im Nürnberg des 17. Jahrhunderts
- 4. Spectaculum christianum versus pompa diaboli. Zur Schauspieltheorie bei den ›Nürnbergern‹
- 4.1. Sigmund von Birken und Johann Conrad Dürr
- 4.2. Georg Philipp Harsdörffer
- TEIL B: THEATRALE KUNST ALS INTEGRALER BESTANDTEIL FRÜHNEUZEITLICHER STADTKULTUR IM NÜRNBERG DES 17. JAHRHUNDERTS
- 1. Importeure der großen Bühnenwelt: Gastspiele auswärtiger Wandertruppen und Theaterbanden
- 2. Das Schultheater als Bildungsinstrument und Teil urbaner Festkultur
- 2.1. Zur Tradition des Schultheaters in Nürnberg
- 2.2. Tugendspiegel, Friedensdank und Repräsentation: Paradigmen von Formen und Funktionen des Schultheaters
- Beispiel 1: Actus oratorius et festivus – Johann Klaj im Kontext des Nürnberger Schulactus am auditorium publicum (1644–1650)
- Beispiel 2: »Eine Sittenschule für die patrizische Jugend«. Die Schuldramen Sigmund von Birkens im Überblick (1651–1655)
- Beispiel 3: Der Parnaß in der Noris. Johann Geuders Freudenspiel Macaria und die Einweihung des neuen Nachtkomödienhauses (1668)
- Beispiel 4: Das Nürnberger »Friedensdankfest« von 1679 und die Friedensschauspiele der Schulen
- 3. »Zu ewigem Gedächtnuß der Nachkommenheit«: Sigmund von Birkens Teutscher Kriegs Ab= und Friedens Einzug bei den Friedensfeiern von 1649/50
- 4. Ein Roßballett mit Holzattrappen: Jacob Langs Kinder=Ballet als Ausdruck patrizischen Repräsentationswillens und Anteilnahme am Kaiserhaus (1668)
- 5. Vom »Musik-Kränzlein« zum Opernspektakel. Theatrale Kunst aus dem Umfeld Nürnberger Handelsleute und des Pegnesischen Blumenordens
- 5.1. Die »Gesellschaft der vordersten Kaufleute« von 1671 und ihre Musikgesellschaften
- 5.2. Ein Nürnberger Übersetzungsprojekt. Johann Gabriel Meyers Übertragung der ›Jahrhundertoper‹ II pomo d’oro im zeitgenössischen Kontext (1672)
- Exkurs I: Verdolmetschen und Nachahmen. Nürnberger Schauspielübersetzungen des Barock
- 5.3. Formen und Funktionen theatraler Kleinformen im kulturellen Leben der Reichsstadt anhand von Aufführungsbeispielen im Rahmen von Musikkränzen
- Beispiel 1: Johann Ludwig Fabers und Johann Löhners Kurzopern für die geselligen Zusammenkünfte der Handelsleute (1675/76)
- Beispiel 2: Eine Trauerfeier als Schauspiel. Die Pia Memoria Joachim Müllners, Jacob Langs und Albrecht M. Lunßdörffers zu Ehren Melchior Schmieds (1682)
- Exkurs II: Spielen bei Gelegenheit. Die unbekannte Masse halbtheatraler Darbietungsformen im Kreise geladener Gesellschaften
- 5.4. Die Nürnberger Barockoper als Höhepunkt urbaner Festkultur
- 6. Buchhändler und Bortenmacher als Komödianten: Theaterunternehmungen Nürnberger Handwerker und Krämer
- 6.1. Ungeliebte Untertanen: die Obrigkeit und die leidenschaftlichen Laienspieler
- 6.2. Antiquar, Verleger, Prinzipal: der Modellfall Georg Scheurer
- 7. Ausklang und Ausblick – Theater in Nürnberg nach 1700 bis ca. 1730
- Zusammenfassung
- Abbildungen
- TEIL C: ANHANG
- 1. Abkürzungen
- 2. Quellen
- 2.1. Bibliographien, Repertorien und elektronische Internet-Recherchemaschinen
- 2.2. Archivalien und Handschriften
- 2.3. Gedruckte Quellen
- 3. Literatur
- 3.1. Lexika und biographische Nachschlagewerke
- 3.2. Artikel, Aufsätze, Handbücher, Monographien und Sammelbände
- 4. Ratsverlässe zur Nürnberger Theatergeschichte des 17. Jahrhunderts
- 5. Register