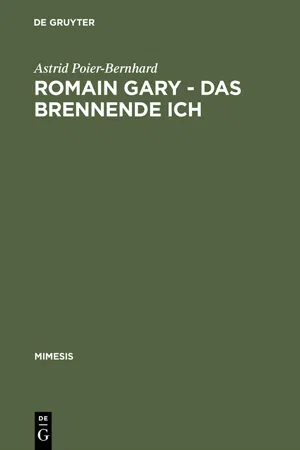
Romain Gary – Das brennende Ich
Literaturtheoretische Implikationen eines Pseudonymenspiels
- 224 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Romain Gary – Das brennende Ich
Literaturtheoretische Implikationen eines Pseudonymenspiels
Über dieses Buch
Das Interesse der Studie gilt der sogenannten "Aventure Ajar", einem von Romain Gary (1914-1980) im Zeitraum von 1974-1980 inszenierten Pseudonymenspiel, dessen Aufdeckung im Jahre 1981 im französischen Literaturbetrieb für große Überraschung sorgte: Emile Ajar, jener junge Autor, dessen mysteriöse Identität lange Zeit die Medien beschäftigt und in den man vielfach große Hoffnungen gesetzt hatte, erwies sich als der literarische Einzelgänger Romain Gary, der seit 1946 publizierte und abseits der markanten Strömungen nach dem Zweiten Weltkrieg einen eigenen, wenig beachteten Weg gegangen war. Die Tatsache, daß den vier mit dem Autornamen Emile Ajar gezeichneten Texten, deren originelle Sprachverwendung bald als style Ajar von sich reden machte, größerer Erfolg und eine wesentlich bewußtere Lektüre zuteil wurde als gleichzeitig verfaßten Romanen Garys, fordert zu einer spezifisch literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Pseudonymenspiel heraus. Neben den biographisch-motivationalen Aspekten der Inszenierung, die auch Garys Persönlichkeitsideal des 'brennenden Ich' betreffen, steht das poetologische Verhältnis der beiden Textserien zur Debatte. Da der ungewöhnliche Fall auch Erkenntnismöglichkeiten im Bereich der allgemeinen Literaturtheorie bietet, beschäftigt sich Poier-Bernhard auch mit Themen wie der Konstitution literarischer Ironie, der Bedeutung des Autornamens, Pseudonymität und Heteronymität; zahlreiche andere, zum Vergleich herangezogene Texte der deutschen und der portugiesischen Literatur verleihen der Arbeit dabei eine komparatistische Weite. Einen theoretischen Schwerpunkt der Studie bildet Poier-Bernhards Beitrag zur Autobiographie-Diskussion, in dem der Versuch einer grundlegenden Begriffsklärung zum Zwecke einer präzisen Textsortenbestimmung unternommen wird.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Siglenverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Gattungstheoretische Vorüberlegungen zur Autobiographie
- 1. Zur Gattungszugehörigkeit von Einzeltexten
- 2. Zur Autobiographie
- 2.1. Autobiographische Dimension: Autobiographische Form
- 2.1.1. Autobiographische Form
- 2.1.2. Autobiographische Dimension
- 2.1.3. Autobiographische Form und autobiographische Dimension als Konstituenten der Gattungsfunktion
- 2.2. Fiktionalität und Referentialität in der autobiographischen Kommunikation
- 2.3. Autobiographische Referentialität als Spezifikum der autobiographischen Kommunikation
- III. Zur fingierten Autobiographie Pseudo
- 1. Fingierung der autobiographischen Dimension
- 2. Die autobiographische Form von Pseudo
- 2.1. Histoire & Discours
- 2.2. Identität
- 2.3. Schreiben über das Schreiben
- 2.4. Eigen- und Pseudo-Name als Element der autobiographischen Form
- 2.5. Kommunikation zwischen fiktivem Erzähler und fiktivem Adressaten
- 2.6. Autobiographische Form als Funktion der autobiographischen Dimension: Pseudo im Vergleich mit La Promesse de l’aube
- 2.7. Die Strategie der negativen Selbstdarstellung
- 3. Fiktionalisierende Elemente im Widerspruch zur Gattungsfunktion?
- 4. Aspekte der Doppelstruktur
- 4.1. Pseudo und sein idealer Leser
- 4.2. Ironie und Rahmung
- 4.3. «Face à qui se dérobe» – Zum Motto von Pseudo
- IV. Pseudonymität
- 1. Fiktionalisierung der Realität – Pseudonym und Heteronym unter narratologischer Perspektive
- 2. «Je ne m’occupe de moi-même que pour me réinventer sans cesse» – Zur Pseudonymität Romain Garys
- V. Die Ajar-Romane
- 1. Gros-Câlin
- 1.1. Ironische Brechung zwischen abstraktem Autor und Erzähler
- 1.2. Geschichte
- 1.3. Das Ende des Romans
- 1.4. Erzählstrukturen
- 1.5. Die Verwandlung des Erzählers und ihre erzähllogischen Konsequenzen
- 1.6. Die «neue Haut» – Gros-Câlin im Kontext der Aventure Ajar
- 1.7. Sprache
- 2. La Vie devant soi
- 2.1. Der naive Autobiograph
- 2.2. Geschichte
- 2.3. Dominanz des Durativen
- 2.4. Erzählstrukuren
- 2.4.1. Der Adressat der Geschichte
- 2.4.2. Die identifikatorische Schreibweise
- 2.4.3. Zeit- und Raumstruktur
- 2.5. Sprache
- 2.6. Pikareske Elemente des Romans
- 3. L’Angoisse du roi Salomon
- 3.1. Kontinuität von Motiven und Ausdrucksformen
- 3.2. Geschichte
- 3.3. Titel
- 3.4. Erzählstrukturen
- 3.4.1. Kommentare
- 3.4.2. Autorbewußtsein im Text
- 3.5. Sprache
- 3.6. Alter und Tod – Themen des Romans im Kontext der Aventure Ajar
- VI. Gary – Ajar
- 1. Rezeption
- 1.1. Rezeption und Rahmung
- 2. Einheit oder Differenz – Vorüberlegungen und Fragen
- 3. Konzepte und Ideale
- 4. Diskurs
- 5. Sprache
- 6. Hätte Gary als Ajar erkannt werden können?
- VII. Fiktionalisierung der Realität – Die Aventure Ajar als roman total
- VIII. Bibliographie
- 1. Romain Gary: Werkbibliographie
- 2. Literaturverzeichnis
- 2.1. Auswahlbibliographie zu Romain Gary
- 2.1.1. Selbständige Arbeiten
- 2.1.2. Artikel in Presse, Sammelbänden und wissenschaftlichen Zeitschriften
- 2.2. Allgemeine Literatur