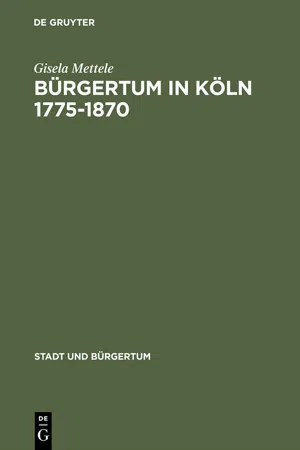
- 413 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Köln, die alte Reichsstadt und Handelsmetropole, war seit dem Ende des 18. Jahrhunderts mit massiven staatlichen Regulierungsansprüchen, zunächst Frankreichs, dann Preußens, konfrontiert. Ein selbstbewußtes Bürgertum mit ausgeprägten Traditionen städtischer Selbstorganisation setzte dem jedoch seinen Willen entgegen, die Stadtgesellschaft jenseits des staatlichen Zugriffs zu gestalten. Die Orientierung am städtischen "Gemeinwohl" blieb dabei eine wichtige Bedingung kommunaler Herrschaft, aber das Kölner Bürgertum verteidigte nicht defensiv ein überkommenes korporatives Stadtmodell. Aus der städtischen Lebenswelt entstand vielmehr das Programm eines neuen Typs von bürgerlicher Gesellschaft. Im lokalen Rahmen wollte das Bürgertum seine Geschichte politisch wie kulturell selbst bestimmen, und bezog daraus zunehmend auch den Anspruch, die Gesellschaft insgesamt mitzuformen.
Gisela Mettele spürt den vielfältigen Facetten der Kölner Bürgerwelt vom Ende der Reichsstadt bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinweg nach. Kommunale Selbstverwaltung und Armenfürsorge werden ebenso berücksichtigt wie Bürgerwehr und städtische Festkultur; von zentraler Bedeutung erwies sich das bislang wenig untersuchte Kölner Vereinswesen. Gefragt wird, wie sich im Netzwerk städtischer Öffentlichkeit das Bürgertum als soziale Einheit formierte, aber auch welche Spannungen und Konflikte es dabei immer wieder vor neue Zerreißproben stellte.
Bürgerliche Frauen - so eine wichtige Einsicht der Studie - trugen auch im öffentlichen Handlungsrahmen ihren Teil zur Konstituierung des Bürgertums bei. Trotz formaler politischer Rechtlosigkeit waren sie weit davon entfernt, sich nur für die Sphäre des inneren Hauswesens zuständig zu fühlen. Öffentliches Engagement und die Organisation in eigenen Vereinen war über das ganze 19. Jahrhundert hinweg ein wichtiger, ja geradezu selbstverständlicher Bestandteil des Selbstverständnisses der Kölner Bürgerinnen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. FRAGESTELLUNG
- 2. BÜRGERBEGRIFF UND FORSCHUNGSDISKUSSION
- 3. QUELLEN UND METHODE
- 4. LITERATUR
- 5. STADTTYP, STADTENTWICKLUNG UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR
- I. DIE REICHSSTADT KÖLN AM ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS
- 1. BÜRGERRECHT
- 2. DIE ÖKONOMISCHE STRUKTURKRISE DER STADT
- 3. POLITISCHE ORDNUNG
- 3.1. Struktur der städtischen Entscheidungsgremien
- 3.2. Personelle Zusammensetzung
- 4. KONFLIKTLAGEN
- 4.1. Deputatschaftsstreit
- 4.2. Toleranzstreit
- 4.3. Frachtwaagenstreit
- 5. NEUE: GESELLSCHAFTLICHE AKTIONSFORMEN
- 5.1. Lesegesellschaften und Freimaurerlogen
- 5.2. Handelskollegium
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
- II. DIE FRANZÖSISCHE ZEIT KÖLNS (1794–1814)
- 1. STADTGESELLSCHAFT IM ÜBERGANG
- 1.1. Die städtische Gesellschaft rückt zusammen
- 1.2. Die Vorstellungen der städtischen Elite über ihren zukünftigen Status
- 2. WANDEL DER STADTVERFASSUNG
- 2.1. Die erste Munizipalisierung Kölns (1796)
- 2.2. Endgültige Auflösung des alten Rats (1797)
- 2.3. Die Mairieverfassung (1800)
- 3. FRANZÖSISCHE HERRSCHAFT UND WIRTSCHAFTLICHER WANDEL
- 4. DAS KÖLNER VEREINS WESEN ZWISCHEN AUFKLÄRUNG UND GESELLIGKEIT
- 4.1. Lesegesellschaften
- 4.2. Der Konstitutionelle Zirkel 1798
- 4.3. Freimaurerlogen
- 4.4. Die geselligen Vereine
- 4.5. Die Sociite Maternelle
- 4.6. Die Musikalische Gesellschaft
- 5. ZUSAMMENFASSUNG
- III. DIE PREUßISCHE ZEIT KÖLNS BIS 1846
- 1. STADTGESELLSCHAFT IM ÜBERGANG (1814-1818)
- 1.1. Die Vorstellungen der städtischen Elite über ihren zukünftigen Status
- 1.2. Der vaterländische Frauenverein zwischen „Befreiungskrieg “ und Armenpflege (1814–1818)
- 2. KONSOLIDIERTE STADTBÜRGERLICHE HERRSCHAFT
- 2.1. Der Stadtrat im Vormärz (bis 1845)
- 2.2. Adolf Steinberger: Ein Oberbürgermeister im französischen Sinn?
- 3. BÜRGERTUM UND STÄDTISCHE ARMUT
- 3.1. Städtische Konfliktregulierung zwischen Fürsorge und sozialer Kontrolle
- 3.2. Ein freimaurerisches Konzept bürgerlicher Armenfürsorge
- 3.3. Frauen als Trägerinnen des Armenwesens
- 4. FORMEN BÜRGERLICHER GESELLIGKEIT
- 4.1. Kein Stand, keine Klasse – eine Kultur?
- 4.2. Casino
- 4.3. Kunstverein
- 4.4. Musikvereine
- 4.5. Turnverein
- 4.6. Das „gastliche Haus“
- 4.7. Das Theater
- 5. ASPEKTE DER POLITISIERUNG IM VORMÄRZ
- 5.1. Der rheinische Provinziallandtag (1826–1845)
- 5.2. Die Kölner Philhelleninnen (1826/27)
- 5.3. Der Kölner Kirchenstreit
- 5.4. Die Dombaubewegung
- 5.5. Das Fest als politische Demonstration
- 5.6. Der Karneval
- 6. DIE STÄDTISCHE GESELLSCHAFT VOR DER REVOLUTION
- 6.1. Prolog: Die Einrichtung einer Bürgerwache 1830 „zur Abwendung der angedrohten Excesse“
- 6.2. Die Martinskirmes 1846: Ein Konflikt zwischen Stadt und Staat und seine Bedeutung für die Gemeindepolitik
- 6.3. Die Gemeinderatswahlen von 1846
- 7. ZUSAMMENFASSUNG
- IV. DAS BÜRGERTUM IN REVOLUTIONÄRER UND NACHREVOLUTIONÄRER ZEIT
- VON DER BÜRGERSCHAFT ZUM BÜRGERTUM: ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
- QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS
- PERSONENREGISTER
- ORTS- UND SACHREGISTER