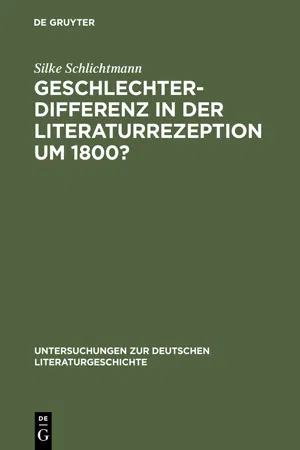
Geschlechterdifferenz in der Literaturrezeption um 1800?
Zu zeitgenössischen Goethe-Lektüren
- 311 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Geschlechterdifferenz in der Literaturrezeption um 1800?
Zu zeitgenössischen Goethe-Lektüren
Über dieses Buch
Lesen Frauen anders? Dieser Frage geht die historisch-empirische Studie für die Zeit um 1800 nach. Bisherige Forschung hat die Existenz klarer, plakativer Polaritäten (weiblich, emotional, identifikatorisch vs. männlich, rational, distanziert etc.) im Lesen postuliert, sich dabei aber entweder nur auf den zeitgenössischen (zumeist von männlicher Feder geführten) Lesesuchtdiskurs gestützt oder von einer sehr schmalen Basis von (vorwiegend weiblichen) Rezeptionszeugnissen aus argumentiert. Dagegen wird hier anhand eines breiten Korpus von verschriftlichten Goethe-Lektüren von Frauen und Männern aus dem gehobenen Bürgertum vergleichend untersucht, ob sich die Kategorie Geschlecht (verstanden im Sinne von Gender) um 1800 als ein den Leseakt bestimmendes Moment nachweisen läßt. Die Studie zeigt, daß vieles, was bei alleiniger Betrachtung der Lektüren von Frauen als typisch weiblich erscheint, weil es so treffend die entsprechenden Merkmale des Polaritätsmodells erfüllt, hinsichtlich seiner Geschlechtsspezifität zu relativieren ist, da es sich in den männlichen Lektüren ebenfalls nachweisen läßt. Während das Zwei-Geschlechter-Modell also auf die Lesepraxis nur sehr begrenzt Einfluß nimmt, wird es auf der Ebene der Selbstcharakterisierung der eigenen Lektüren vielfach fortgeschrieben. Für die Gestaltung des Leseakts aber gilt, daß weitaus gravierendere Unterschiede als die zwischen den Geschlechtern sich zwischen Lesenden desselben Geschlechts finden, andere Faktoren wie etwa poetologische Konzepte eine viel wichtigere Rolle spielen. Geschlecht ist nur ein Einflußfaktor unter vielen im Voraussetzungssystem der Lesenden und wird nur unter bestimmten Bedingungen zu einem besonders bedeutsamen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Siglen
- Zitierweise
- I. Einleitung: Erkenntnisinteresse, Forschungsstand, Quellen, Methode
- II. Von der »weibischen Neugierde, das Ende eines Buchs zu wissen«, und anderen sogenannten Fehlern: Das Postulat einer Geschlechterdifferenz im Lesen um 1800
- III. Goethe lesen - Goethe schreiben: Lektüren in Briefen an den Autor
- 1. Die liebende Leserin
- a. Bettina Brentano: Ein Paradebeispiel?
- b. Leserinnenliebe im Plural
- 2. Auch Leser lieben
- a. Carl Friedrich Zelter: Nur eine Ausnahme?
- b. Leserliebe im Plural
- 3. Das Buch als Brief: Eine weibliche Lektüre?
- 4. Selbstparallelisierung mit dem Autor: Eine männliche Lektüre?
- IV. Geschlechtscharaktere und Lektüreweisen
- 1. Stoff und Form
- a. »Und wie ging’s weiter?«: Neugier, männliche und weibliche
- b. Poetologiekonzept versus Geschlecht als Einflußfaktor
- c. ›Die Wahlverwandtschaften‹ Ethik versus Ästhetik?
- 2. Emotionalität und Rationalität
- a. Meinungen und Urteile
- b. Verstehen
- c. Identifikatorische Nähe versus reflektierende Distanz?
- d. Stillgestellt oder sinnlich rege: Der Körper im Leseakt
- 3. Rezeptivität und Produktivität
- V. Lektüre in Funktion
- 1. Beziehungsmedium
- a. Erkennen und Verkennen: Identifikatorische Lektürestrategien im Briefwechsel der Geschlechter
- b. »freilich sagt Göthe nur was wir wißen! «:Wir-Konstitution jenseits der Geschlechtergrenzen
- 2. Lebensorientierung
- a. Lesen und Handeln
- b. Lesen als Kur und Kompensation
- c. »das ist meine heilige Schrift! «: Weiblich-jüdische Akkulturationsversuche
- VI. Resümee
- VII. Quellen- und Literaturverzeichnis
- 1. Quellen
- a. Archivalien
- b. Gedruckte Briefe und Sammlungen weiterer Lektürezeugnisse
- c. Weitere zeitgenössische Texte
- 2. Sekundärliteratur