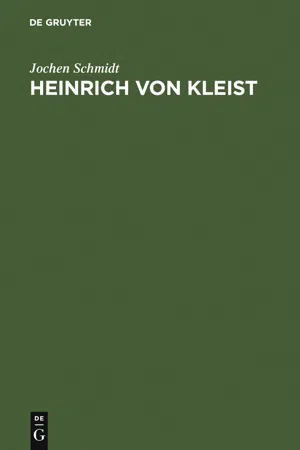
- 271 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Über dieses Buch
Keine ausführliche Beschreibung für "Heinrich von Kleist" verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Heinrich von Kleist von Jochen Schmidt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Deutsche Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- 1. DIE SKEPTISCHE GRUNDHALTUNG: IRONIE, KRITIK, EXPERIMENT
- 1. Das frühe Zeugnis der Briefe
- 1.1. Kleists kritische Lösung aus allen gesellschaftlichen Bindungen und der Scheincharakter der Kantkrise
- 1.2. »Reisen« und Sehnsucht nach »Ruhe« als dialektische Grundfigur experimenteller Haltung
- 2. Die Ironisierung des Gefühls, besonders seiner religiösen Dimension
- 2.1. Grundpositionen der Forschung
- 2.2. ›Die Marquise von O ...‹
- 2.3. ›Das Erdbeben in Chili‹
- 2.4. Die ästhetische Bejahung des Gefühls: die Illusionslehre des Helvétius und das Verhältnis zum subjektiven Idealismus
- 3. Nicht Schicksalsglaube, sondern Gesellschaftskritik
- 3.1. ›Die Familie Schroffenstein‹
- 3.2. Gesellschaftskritik in den Erzählungen
- 3.3. Das Mißverständnis bei Lukács
- 3.4. Die Vertiefung des gesellschaftskritischen Ansatzes in der ›Penthesilea‹
- 3.5. Grundmotive gesellschaftlich negativ bestimmten Geschehens: das Paria-Motiv und das Rache-Motiv
- II. REGIE
- 1. Physiognomik
- 1.1. Die Einheit des dramatischen und des erzählerischen Werks
- 1.2. Die allgemeine Funktion der Physiognomik
- 1.3. Typisierende Physiognomik und deren Begründung in der »Sphäre«
- 1.4. Charakterisierende Physiognomik
- 1.5. Dramatische Funktionen
- 1.6. Die Pantomime als letzte Konsequenz
- 2. Signale, Namen
- 2.1. Signal und Signalmetaphorik
- 2.2. Namen als äußere Signale. Wendung ins Innere: die Namensszene als Kernstück der Anagnorisis
- 2.3. Signalisierender Stil
- 3. Leitmotive
- 3.1. Allgemeine Funktion
- 3.2. Die Vorstufe im Erstlingswerk
- 3.3. Das monumental beherrschende Leitmotiv der ›Penthesilea‹-Phase
- 3.4. Das differenzierte Verfahren der Spätphase im ›Homburg‹
- 3.5. Die parallele Entwicklung der Leitmotivik in den Erzählungen
- III. KOMPOSITION
- 1. Finale Komposition
- 1.1. Die szenische Gestalt des Finales
- 1.2. Das Problem des schweren Schlusses
- 2. Dialektische Komposition
- 2.1. Die Schematik der gegenszenischen Komposition in der ›Familie Schroffenstein‹
- 2.2. ›Natur‹ und ›Kunst‹ in symbolischen Gegenszenen
- 2.3. Der Übergang zur dialektischen Struktur in der gegenszenischen Komposition: ›Penthesilea‹
- 2.4. Erzählerische Gegenbilder
- 2.5. Totalität der Durchführung und vollendete innere Dialektik: ›Homburg‹
- IV. DIE ZENTRALE FORM: PERSPEKTIVISCHE DARSTELLUNG
- 1. Subjektive Projektionen der agierenden Personen
- 1.1. Eve im ›Variant‹
- 1.2. Das Jupiterspiel im ›Amphitryon‹, Höhepunkt des Illusionismus in Kleists Werk
- 1.3. ›Die Marquise von O ...‹ als Seitenstück und ›Der Findling‹ als Umkehrung des ›Amphitryon‹
- 2. Erzählerperspektiven
- 2.1. Der Chronist im ›Kohlhaas‹
- 2.2. Die Zigeunerin im ›Kohlhaas‹: die ironische Objektivierung des Doppelgängers aus der Erzählerperspektive als letzte Stufe der Verfremdung
- 2.3. ›Der Zweikampf‹ und ›Die heilige Cäcilie‹ als ironisch erzählte Legenden
- 2.4. Rückblick auf die ersten Ansätze der Spätstufe: Perspektivenwechsel im ›Erdbeben‹
- V. GESICHTSPUNKTE DER PERIODENBILDUNG
- 1. Formgeschichtliche und thematische Zwischenergebnisse zur Periodenbildung
- 2. Die prägende Kraft literarischer Begegnungen bis zur ›Penthesilea‹-Phase
- 2.1. Die Shakespeare-Manier der Frühstufe: ›Die Familie Schroffenstein‹
- 2.2. Die Auseinandersetzung mit der antiken Tragödie
- 3. Die Phase des monumentalen Tragödienstils: ›Guiskard‹ und ›Penthesilea‹
- 4. Die Abwendung von der Tragödie in den drei »Schauspielen« der Schlußphase
- 4.1. Die Flucht ins problemlose »Positive«: ›Käthchen‹ und ›Hermannsschlacht‹
- 4.2. Rückkehr zum Bewußtseinsproblem, aber mit ironischer Entwirklichung: ›Prinz Friedrich von Homburg‹
- Literaturverzeichnis