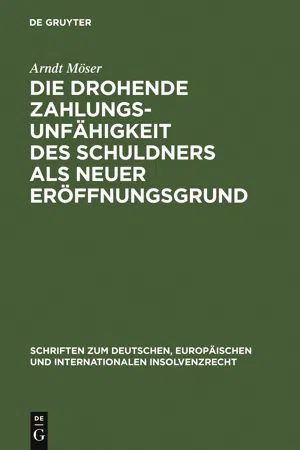
- 197 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Die drohende Zahlungsunfähigkeit des Schuldners als neuer Eröffnungsgrund
Über dieses Buch
Anliegen der Studie ist es, den Zusammenhang des neuen Eröffnungsgrundes der drohenden Zahlungsunfähigkeit einerseits und den neuen Instrumenten der InsO, dem Planverfahren und der Eigenverwaltung andererseits zu beleuchten. Nach den Vorstellungen des Reformgesetzgebers soll das neue Insolvenzrecht Instrumentarien bereitstellen, die es dem Schuldner erlauben, frühzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen, um mit den Instrumentarien der Eigenverwaltung und des Insolvenzplanverfahrens sein Unternehmen zu reorganisieren bzw. abzuwickeln. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die Rechtslage zwischen den Beteiligten nicht abschließend geordnet. Das Insolvenzverfahren ist als Verfahren selbst das Ordnungsinstrument. Eingehend wird untersucht, wie sich die drohende Zahlungsunfähigkeit als tragender Pfeiler in der Architektonik des Insolvenzverfahrens als Mittel der Verfolgung eigener wirtschaftlicher und rechtlicher Interessen des Schuldners erweist.
Die Arbeit zeigt auf, dass es keiner Überprüfung des Insolvenzgrundes bei einem Schuldnerantrag bedarf, wenn dieser mit dem Antrag auf Eigenverwaltung und der Vorlage eines Insolvenzplanes verknüpft ist, sofern dieser auf den Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit gestützt wird. Das Augenmerk des Gerichtes kann in diesen Fällen darauf gerichtet werden, zu prüfen, ob eine ausreichende Masse zur Kostendeckung vorhanden ist. Wenn diese Frage durch das Gericht bejaht werden kann, kann das Verfahren daher eröffnet werden. Ein widerstreitender Vortrag gegenüber den Gläubigern und dem Insolvenzgericht hinsichtlich der drohenden Zahlungsunfähigkeit wird hierdurch vermieden. In der Folge ist sowohl eine Entlastung des Schuldners als auch der Insolvenzgerichte zu erwarten.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Neue Institutionen der Insolvenzordnung
- II. Anliegen der Studie
- III. Neue gesetzliche Regelung
- B. Vorliegen eines Eröffnungsgrandes zwingende Voraussetzung für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens?
- I. Anliegen dieser Studie
- II. Gesetzeswortlaut des § 16 InsO
- III. Gläubigerantrag
- IV.Schuldnerantrag
- V.Problemstellung
- C. Neuer Eröffnungsgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- I. Drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.d. InsO
- II. Feststellung der drohenden Zahlungsunfähigkeit im Sinne einer Liquiditätsschau
- III. Folgen des Eintritts der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- IV. Bisherige strafrechtliche Regelung der drohenden Zahlungsunfähigkeit unter Geltung der KO, GesO und VglO
- V. Ausblick auf das neue Recht
- VI. Argumentation des Gesetzgebers zur strafrechtlichen Bedeutung des § 18 InsO
- VII. Änderungen der strafrechtlichen Betrachtungsweise durch die Neuregelung in der InsO
- VIII. Zusammenfassung / Stellungnahme
- D. Untersuchung der Erwartungen des Gesetzgebers in den neuen Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- I. Ziele der Insolvenzrechtsreform
- II. Ausführungen des Gesetzgebers zu Missbrauchsmöglichkeiten
- III. Redebeiträge der Abgeordneten des Deutschen Bundestages
- IV. Zusammenfassung zur Betrachtung der Begründung des Gesetzgebers und zur Abstimmungsdebatte über das neue Insolvenzrecht
- E. Bestandsaufnahme des überkommenen Rechts / Rechtslage im Geltungsbereich der KO/VglO
- I. Hohe Zahl der Abweisung mangels Masse bei Verfahren nach derKO
- II. Geringe Anzahl der gerichtlichen Bestätigungen eines Vergleichsverfahrens
- III. Anzahl der beantragten Insolvenzverfahren nach altem Recht / Übergangsphase zum neuen Recht
- F. Konkurs- und Insolvenzgründe nach der KO, VglO und der GesO nach überkommenem Recht
- I. Einleitung
- II. Allgemeine Insolvenzgründe nach bisherigem Recht
- III. Abgrenzung zur Kreditunwürdigkeit
- IV. Zahlungsunfähigkeit i.S.d. GesO
- G. Zusammenfassung / Zwischenergebnis zum überkommenen Recht, Vergleich zum Recht der InsO
- I. Darstellung der sonstigen Insolvenzgründe, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung nach der InsO
- II. Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit / Änderungen zum bisherigen Recht
- III. Insolvenzgrund der Überschuldung / Änderungen zum bisherigen Recht
- H. Überlegungen zu den überkommenen Eröffnungsgründen / Vergleich zum neuen Recht
- I. Übernahme der bisherigen Eröffnungsgründe
- II. Schlussfolgerungen für § 18 InsO/Intention des § 18 InsO
- III. Betrachtung der Eröffnungsgründe der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung
- IV. Ansicht von Smid zum Eröffnungsgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- V. Zwischenergebnis zum neuen Eröffnungsgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- I. Vordrucke für das Verbraucherinsolvenzverfahren / Vortragspflicht des Schuldners im Verbraucherinsolvenzverfahren
- I. Neue Vordrucke für das Verbraucherinsolvenzverfahren
- II. Vorlage von Unterlagen im Verbraucherinsolvenzverfahren
- III. Zwischenergebnis zum neuen Eröffnungsgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- IV. Rolle der drohenden Zahlungsunfähigkeit im Eröffnungsverfahren
- V. Struktur der Eröffnungsgründe im Hinblick auf die Reichweite der Amtsermittlungspflicht i.S.d. § 5 InsO
- J. Jüngste höchstrichterliche Entscheidungen
- I. Entscheidung des BGH vom 12. 12. 2002
- II. Bemerkung zu dem Beschluss des BGH vom 12. 12. 2002
- III. Erkenntnisse aus der eben zitierten BGH-Entscheidung vom 12. 12. 2002
- IV. Entscheidung des BGH vom 24. 05. 2005
- V. Bemerkungen zu der Entscheidung des BGH vom 24. 05. 2005
- K. Ansicht der Literatur zur Vortragspflicht des Schuldners
- I. Durch den Schuldner vorzulegende Unterlagen
- II. Hierzu vertretene Auffassungen
- III. Prüfungspflicht durch das Insolvenzgericht hinsichtlich des Vorliegens eines Eröffnungsgrundes
- IV. Prüfungsaufwand durch das Insolvenzgericht beim Eigenantrag des Schuldners / vergleichende Betrachtung mit dem gerichtlichen Mahnverfahren
- V. Zwischenergebnis zu den vorzulegenden Unterlagen
- L. Überlegungen zum Prüfungsumfang durch das Insolvenzgericht zum Insolvenzgrund / Eröffnungsgrund
- I. Vorbemerkung
- II. Amtsermittlungspflicht für das Insolvenzgericht, § 5 InsO
- III. Prüfung der Antragsberechtigung / des Eröffnungsgrundes
- IV. Schuldnerantrag nach altem Recht
- V. Festlegung des Verfahrensgegenstandes im Insolvenzverfahren nach der InsO
- VI. Entscheidungen des Insolvenzgerichtes nach neuem Recht
- VII. Ausgestaltung der Auskunftspflichten des Schuldners anhand der vorzulegenden Unterlagen
- VIII. Hilfspersonen des Konkursgerichts nach altem Recht
- IX. Regelung der Hilfspersonen des Insolvenzgerichts nach der InsO
- X. Auskunftsperson Schuldner
- XI. Darlegung eines Insolvenzgrundes
- XII. Der Eigenantrag des Schuldners nach neuem Recht
- M. Vergleichbarkeit des Verfahrens gestützt auf den Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Vergleichsverfahrens
- I. Zielsetzung einheitliches Verfahren
- II. Schaffung eines einheitlichen Insolvenzverfahrens durch den Gesetzgeber
- III. Beseitigung der Zweigleisigkeit des Verfahrens / frühzeitigere Eröffnung eines mehroptionalen Verfahrens
- IV. Besonderheiten des Vergleichsverfahrens
- V. Ergebnis zu den Antragsgründen nach überkommenen Recht / Vergleichbarkeit zu den Antragsgründen nach neuem Recht
- N. Folgerungen für die Antragstellung
- I. Nochmals: Neuer Eröffnungsgrund: drohende Zahlungsunfähigkeit
- II. Ziel des Gesetzgebers: Früherer Eigenantrag des Schuldners
- III. Historie der Insolvenzordnung
- IV. Reihenfolge der Konkursgründe nach der Intention des Gesetzgebers zur KO
- V. Entscheidungen des Insolvenzrichters zur Verfahrenseröffnung
- O. Folgen eines Insolvenzverfahrens
- I. Vorteile eines Insolvenzverfahrens für den Schuldner
- II. Negative Folgen eines Insolvenzantrags für den Schuldner
- III. Programmierter Selbstmord des Schuldners?
- IV. Drohende Zahlungsunfähigkeit als Chimäre?
- V. Eigenantrag des Schuldners ohne Rücksicht auf Verluste?
- VI. Auswirkungen für den Gläubiger
- VII. Folgen auch bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung
- VIII. Auswirkungen der Restschuldbefreiung
- P. Steuerbarkeit eines Verfahrens für den Schuldner
- I. Verlust der Verwaltungs-und Verfügungsbefugnis
- II. Motivationslage: strafbewehrte Insolvenzantragsverpflichtung
- III. Sinnhaftigkeit eines vorzeitigen Eigenantrages
- IV. Eigenverwaltung
- V. Erforderlicher Vortrag / erforderliches Abstimmungsverhalten des Schuldners vor Antragstellung
- VI. Insolvenzplan
- VII. Verbraucherinsolvenzverfahren
- VIII. Keine Nachteile für die Gläubiger bei ungesteuertem Insolvenzantrag des Schuldners
- Q. Annahme der neuen Instrumente der Insolvenzordnung durch die Praxis / Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Recht
- I. Statistik zu den Insolvenzplanverfahren
- II. Ziel der Prophylaxe nicht erreicht
- III. Zwischenergebnis / Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Recht
- IV. Geringere Voraussetzungen an die Prüfung der Zulässigkeit eines Vergleichsantrages als Kriterium der Vergleichbarkeit
- V. Strukturelle Unterschiede zwischen dem Verfahren nach der KO undderVglO
- VI. Ergebnis zur Untersuchung der Parallelen zwischen dem Vergleichsverfahren und dem Insolvenzplanverfahren
- R. Weitere Folgen eines Insolvenzantrages gestützt auf den Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- I. Stilllegung des schuldnerischen Unternehmens?
- II. Auswirkung auf bestehende Bankkredite
- S. Nochmals: Auswirkungen auf die Prüfungspflicht des Insolvenzgerichts
- I. Glaubhaftmachung i.S.d. ZPO
- II. Ermittlungen des Insolvenzgerichts
- III. Einordnung und Wertung des Eröffnungsgrundes der Überschuldung nach neuem Recht
- IV. Folgen für die Antragstellung?
- V. Folgerungen für den Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit aus dieser Erörterung
- T. Auswirkungen der drohenden Zahlungsunfähigkeit auf das Strafrecht?
- I. böswillige Zahlungsverweigerung nach überkommenem Recht
- II. strafrechtliche Bewertung der böswilligen Zahlungsverweigerung
- III. Frühere Verfahrensauslösung
- U. Bindungswirkung eines Strafverfahrens für die Feststellung der Insolvenzgründe durch das Konkurs-/Insolvenzgericht als Prüfungserfordernis für das Insolvenzgericht?
- I. Bindungswirkungen nach überkommenem Recht
- II. Folgen für den Prüfungsumfang des Insolvenzgerichts bei Vortrag des Insolvenzgrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit durch den Schuldner
- V. Vermeidung widersprüchlichen Vortrags durch den Schuldner
- I. Darlegungspflicht ggü. dem Insolvenzgericht hinsichtlich des Eröffnungsgrundes der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- II. Darlegungspflicht ggü. dem Insolvenzgericht im Hinblick auf die Anordnung der Eigenverwaltung
- III. Beurteilung der Gefahr des Eintritts „sonstiger Nachteile“ durch das Insolvenzgericht im möglichen Widerstreit mit der Prognosebeurteilung hinsichtlich der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- IV. Vortrag des Schuldners hinsichtlich eines Insolvenzplans bei einem V. Eigenantrag gestützt auf drohende Zahlungsunfähigkeit
- V. Abstimmung der Eigenverwaltung und des Insolvenzplanes mit den später am Verfahren Beteiligten
- VI. Schlussfolgerung für die Vortragspflicht des Schuldners
- W. Wesentliche Erkenntnisse der Studie
- I. Vortragspflicht des Schuldners
- II. Keine Vorlage von zusätzlichen Unterlagen bei der Antragstellung
- III. Keine echte Schlüssigkeitsprüfung
- IV. Frühere Eröffnung von Insolvenzverfahren als Ziel des Reformgesetzgebers
- V. Gefahren eines Eigenantrags ohne Nachweis eines Insolvenzgrundes
- X. Schlussbemerkung
- I. Entbehrlichkeit der Prüfung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
- II. Fazit
- Sachregister