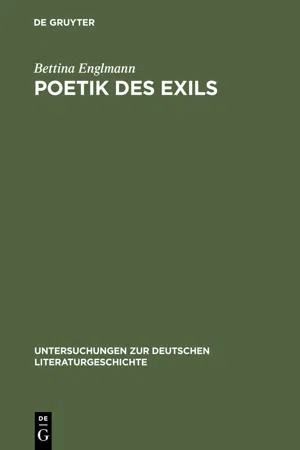
- 457 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Nach der Machtübernahme der Nazis verließen zahlreiche Schriftsteller Deutschland. Dennoch wurde die deutschsprachige Literatur der kommenden Jahrzehnte nicht nur vom politischen Engagement prominenter Flüchtlinge geprägt, jenseits des öffentlichen Diskurses wurden auch "ästhetische" Folgen des Nationalsozialismus für die moderne Kultur reflektiert. Der Blick des Autors auf den ferngerückten Leser veränderte sich ebenso wie der Blick auf die eigene Rolle als Erzähler. Damit änderten sich auch die poetischen Ziele. Das Exil wurde zum Ort der Reflexion, der Beschäftigung mit ästhetischer Theorie, z.B. bei Brecht oder Benjamin. Kulturelle Aporien wurden in eine erkenntniskritische Poetik übersetzt, der Bezug zwischen Fiktion und Realität wurde problematisiert. Diese Entwicklung prägte die poetische Produktion bekannter und vergessener Autoren - exemplarisch wird dies an verschiedenen Romanen von Alfred Döblin, Veza Canetti, Soma Morgenstern und anderen. Der Exilroman führte den modernen Romandiskurs der 20er Jahre weiter, doch er fand neue poetische Lösungen. Das Konzept eines "einfachen" Erzählens setzte sich durch, vieldeutige, auch verstörende Bilder traten neben philosophische Reflexionen. Indem der Exilroman seine Sprachen und Fiktionen thematisierte, veränderte er den Blick auf den Text und auf seinen Bezug zur Realität. Die fiktionalen Entwürfe des Exils erzeugen komplexe imaginäre Gegenwelten zu einer fragwürdigen Realität - die Ästhetik der Moderne wurde so dynamisch weiterentwickelt. Im Modell einer »Poetik des Exils« - zwischen Kulturaporetik, mimetischer Theorie und der Analyse von Weltentwürfen im Roman - konstituiert sich ein Lektüreparadigma, das vielfältige Zugänge zur Exilliteratur bietet.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Exil und Exilliteratur : zur Forschungslage
- 2. Wissenschaftliche Perspektiven einer Poetik des Exils
- I. Kulturaporetik oder »Was ist Realität?«
- 1. Literarische Kommunikation im Exil: Die Irritation des Rollenbezugs von Autor und Leser
- 2. Der Diskurs um Ratio im Exil
- 3. Der poetische Text in der kulturellen Negation: Autoreflexivität
- II. Literaturtheorie im Exil: Mimesis
- 1. Dimensionen der Kategorie Mimesis
- 2. Mimesis im ästhetischen Diskurs des Exils oder »Was ist Form?«
- 2.1. Mimesis als »dargestellte Wirklichkeit«: Erich Auerbach
- 2.2. Das mimetische Vermögen: Walter Benjamin
- 2.2.1. Das mimetische Vermögen der Lektüre
- 2.2.2. Schrift - Sprache – Bild
- 2.2.3. Die Entstellung der Wirklichkeit durch den Autor
- 2.3. Gestische Mimesis: Bertolt Brecht
- 2.4. Mimesis der Metamorphosen: Carl Einstein
- 3. Geschichtsdiskurse / Narrativik oder »Was ist Historie?«
- 3.1. Konzepte des Historischen im Exil
- 3.1.1. Geschichte und Fiktion: Alfred Döblin
- 3.1.2. Vom »Weltgeist« der Geschichte: Stefan Zweig
- 3.1.3. Bertolt Brechts »Historisierung«
- 3.1.4. Benjamins »kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung«
- 3.1.4.1. Geschichtstheorie
- 3.1.4.2. Mythische Elemente
- 3.1.4.3. Erzählstrukturen
- 3.2. Die Produktivität des Mythos im Exil
- 3.2.1. Mythos als »Existenzphilosophie«: Hermann Broch
- 3.2.2. Parodie der Historiographie im Mythischen: Thomas Mann
- III. Weltentwürfe der Exilliteratur – Exilromane
- 1. Erinnerte Welten
- 1.1. Soma Morgenstern: Funken im Abgrund
- 1.1.1. Strukturen chassidischen Erzählens – mythische Bilder
- 1.1.2. Erinnerungsbilder: narrative Funktionen des väterlichen Briefes und der Erzählungen Welwels
- 1.2. Eine »Kleine jüdische Welt« als Groteske – H. W. Katz: Die Fischmanns
- 1.3. Verfremdende Kinderblicke auf Deutschland – Ilse Losa: Die Welt in der ich lebte
- 1.4. Der Erinnernde als unzuverlässiger Erzähler der Vergangenheit - Joseph Roth: Die Kapuzinergruft
- 2. Verstörte Welten
- 2.1. Elisabeth Augustin: Auswege
- 2.1.1. Polyphonie der Auflösung: »Finden gelingt nur dem der nichts sucht«
- 2.1.2. Ariadne - Brüche im Mythos
- 2.1.3. »Nature morte« – Zur Autoreflexivität der Kunstdiskurse
- 2.2. Sprachverstörung nach dem ›Anschluß‹ – Veza Canetti: Die Schildkröten
- 2.3. Kamevalisierende »Untergangskulissen« – Alexander Moritz Frey: Hölle und Himmel
- 2.4. »Worte waren keine Entsprechung für die Abläufe« – Hans Henny Jahnn: Das Holzschiff
- 3. Fabelhafte Welten
- 3.1. Alfred Döblin: Babylonische Wandrung
- 3.1.1. Eine »unmögliche mögliche Welt«: Das Aufdecken der eigenen Künstlichkeit
- 3.1.2. »Ist die Geschichte schon zu Ende? Wer weiß es?« Die Wandrung als antihistorischer Text
- 3.1.3. Intertextuelle Bezüge zu Goethes Faust
- 3.2. »Je est un autre« - Franz Werfels ironisches Spiel mit der auktorialen Identität in Stern der Ungeborenen
- 3.3. Leo Perutz: Nachts unter der steinernen Brücke – eine »Logik des Wunderbaren«?
- Resümee
- Literaturverzeichnis