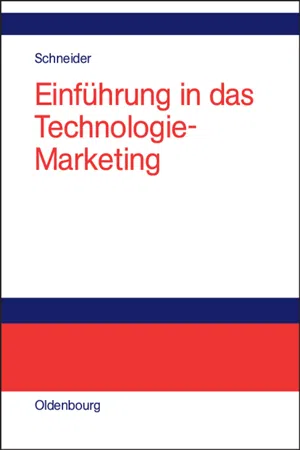
- 457 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Einführung in das Technologie-Marketing
Über dieses Buch
Das Lehrbuch "Technologie-Marketing" wurde mit der Zielsetzung einer Einführung in das Marketing technologieintensiver Unternehmungen des Business-to-Business-Bereichs verfasst. Es richtet sich vor allem an Studierende, die sich in dieses interessante Gebiet einarbeiten möchten. Der Aufbau des Buches orientiert sich an den Erfordernissen einer Marketingkonzeption von der Analyse- bis zur Durchführungs- und Kontrollphase unter besonderer Berücksichtigung der Besonderheiten des Business-to-Business-Bereichs.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Einführung in das Technologie-Marketing von Dieter J.G. Schneider im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Verwaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Vorwort
- Kapitel I: Grundlagen des Technologiemarketing
- 1. Rahmenbedingungen des Technologiemarketing
- 1.1 Veränderungen der Rahmenbedingungen
- 1.1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 1.1.2 Technologische Rahmenbedingungen
- 1.1.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 1.2 Für das Technologie-Marketing relevante Unternehmensbedingungen
- 1.2.1 Die Unternehmenskultur als Einflußfaktor
- 1.2.2 Ressourcenpotential
- 1.2.3 Innovationsstrategische Konzepte
- 1.2.4 Überwindung konventioneller Strukturen
- 1.2.5 Unternehmensbedingungen und Erfolgsfaktoren
- 2. Einordnung des Technologiemarketing in das Marketing
- 2.1. Grundlagen des Marketingdenkens und von Marketingkonzepten
- 2.1.1 Der Wandel des Marketingdenkens
- 2.1.2 Das strategische Dreieck
- 2.1.3 Strategische und operative Marketingpolitik
- 2.2 Abgrenzung und Besonderheiten des Technologie-Marketing
- 2.2.1 Technologie-Marketing als Teilgebiet des Marketing
- 2.2.2 Begriffsabgrenzung
- 2.2.3 Im Spannungsfeld zwischen Technik und Marketing
- 2.2.4 Aufgaben und Ansatzpunkte eines Technologiemarketing
- 2.2.5 Risiken im Technologie-Marketing
- 3. Technologien als eine der Triebkräfte im Wettbewerb
- 3.1 Die Bedeutung der Technologie im gesellschaftlichen Umfeld
- 3.2 Der Technologielebenszyklus als Einflußfaktor auf den Wettbewerb
- 3.3 Klassifizierung von Technologien auf dem Hintergrund des Technologielebenszyklus
- 3.4 Technologien und Typen von Innovationsprozessen
- 3.5 Technologien als Gegenstand industrieller Vermarktungsprozesse
- 3.6 Zur Koordination von Technologie- und Bedarfspotentialen
- Literaturverzeichnis
- Kapitel II: Analyse der Ausgangslage von Unternehmung und Umwelt
- 1. Gründe für strategische Analysen
- 2. Die Unternehmensanalyse
- 2.1 Bereiche der Unternehmensanalyse
- 2.2 Die Instrumente der Unternehmensanalyse: die Wertkette als Beispiel
- 2.3 Ziele und Aufgaben der Unternehmensanalyse
- 3. Die Umweltanalyse
- 3.1 Bereiche der Umweltanalyse
- 3.1.1 Analyse der Rahmenbedingungen
- 3.1.2 Beschaffungsmärkte
- 3.1.3 Analyse der Absatzmärkte
- 3.2 Instrumente der Umweltanalyse
- 3.3 Ziele und Aufgaben der Umweltanalyse
- 4. Die SWOT-Analyse als Zusammenführung von Unternehmens und Umweltanalyse
- Literaturverzeichnis
- Kapitel III: Strategische Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungsfelder
- 1. Strategische Stoßrichtungen
- 1.1 Strategie der Differenzierung
- 1.2 Strategie der Kostenführerschaft
- 1.3 Hybride Wettbewerbsstrategien
- 2. Bedeutung von Wettbewerbsvorteilen
- 3. Zur Wahl strategischer Geschäftsfelder
- 3.1 Produkt-Markt-Matrix als Strukturierungshilfe bei der Geschäftsfeldwahl
- 3.2 Das Problemkonzept als integrative Kraft
- 3.3 Mehrdimensionale Abgrenzung von Geschäftsfeldern nach Abell
- 3.4 Internationale Erweiterung der Geschäftsfeldwahl
- 3.5 Zur Bildung Strategischer Geschäftseinheiten
- 3.6 Die Portfolio-Analyse als Planungsinstrument für die Steuerung strategischer Geschäftseinheiten
- 3.6.1 Das Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio (Boston Consulting Group BCG)
- 3.6.2 Das Marktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteile-Portfolio (Me Kinsey)
- 3.6.3 Technologie-Portfolio (Pfeiffer u.a.)
- 3.6.4 Kombinierte Markt-Technologie-Portfolios
- 3.7 Zu den Dimensionen strategischer Geschäftsfelder
- 3.7.1 Analyse und Auswahl von Funktionen potentieller Kunden
- 3.7.2 Zur Auswahl von Kundengruppen
- 3.7.3 Auswahl von Technologiebereichen
- 3.7.4 Auswahl von Ländermärkten
- 4. Timing-Aspekte (oder Timingstrategien)
- Literaturverzeichnis
- Kapitel IV: Organisationales Kaufverhalten
- 1. Besonderheiten des Kaufverhaltens im Technologie-Marketing
- 2. Intrapersonale Determinanten des organisationalen Kaufverhaltens
- 2.1 Aktivierende Prozesse
- 2.2 Kognitive Prozesse
- 3. Interpersonale Determinanten des organisationalen Kaufverhaltens
- 4. Monoorganisationale Erklärungsansätze zum organisationalen Kaufverhalten
- 4.1 Partialmodelle
- 4.1.1 Buying Center Konzepte
- 4.1.2 Determinanten der spezifischen Beschaffungssituation
- 4.2 Totalmodelle
- 4.2.1 Das Webster/Wind-Modell
- 4.2.2 Das Modell von Choffray/Lilien
- 4.3 Kritische Würdigung der monoorganisationalen Erklärungsansätze zum organisationalen Kaufverhalten
- 5. Interaktionsansätze zur Erklärung des organisational Kaufverhaltens
- 5.1 Personale Interaktionsansätze
- 5.2 Organisational Interaktionsansätze
- 5.2.1 Dyadisch organisationale Interaktionsansätze
- 5.2.2 Multiorganisationale Interaktionsansätze
- 5.3 Kritische Würdigung der Interaktionsansätze
- Literaturverzeichnis
- Kapitel V: Hinweise zum Instrumentaleinsatz
- 1. Leistungstypologien als Ansatzpunkt zur Entwicklung von Marketingkonzepten
- 1.1 Leistungstypologie nach Engelhardt/Kleinaltenkamp/Reckenfelderbäumer
- 1.2 Informationsökonomisch begründete Transaktionstypologie nach Weiber/Adler
- 1.3 Geschäftstypologie nach Kleinaltenkamp
- 1.4 Schwierigkeiten bei der Zuordnung realer Produkte
- 2. Hinweise zur Leistungspolitik
- 2.1 Entscheidungsfelder der Leistungspolitik
- 2.1.1 Kombination von physischen Produkten (Hardware) und Dienstleistungen (Software)
- 2.1.2 Standardisierung und Individualisierung
- 2.1.3 Qualitätspolitik
- 2.1.4 Markenpolitik
- 2.2.2 Entscheidungsbereiche der Programmpolitik
- 3. Hinweise zur Distributionspolitik
- 3.1 Grundlagen
- 3.1.1 Zu den Begriffen Distributionspolitik und Vertriebsweg
- 3.1.2 Distributionspolitik als integraler Bestandteil von Unternehmungs- und Marketingpolitik
- 3.2 Gestaltungsprinzipien internationaler Distributionssysteme
- 3.2.1 Direkter und indirekter Export
- 3.2.2 Direkter und indirekter Vertrieb
- 3.2.3 Einstufiger und mehrstufiger Vertrieb
- 3.2.4 Eingleisiger und mehrgleisiger Vertrieb
- 3.2.5 Betriebseigene und betriebsfremde Distributionsorgane
- 3.2.6 Individueller und kooperativer Vertriebsweg
- 3.3 Der Einsatz des Internet im Vertrieb
- 3.3.1 Die zunehmende Bedeutung elektronischer Medien im Vertrieb
- 3.3.2 Einsatzmöglichkeiten des E-Commerce bei unterschiedlichen Geschäftstypen
- 3.3.3 Ausgewählte Entwicklungen und Ihre Auswirkungen auf das Zuliefergeschäft
- 3.4. Einflußfaktoren auf die Gestaltung der Distributionspolitik bei internationaler Unternehmenstätigkeit
- 3.4.1 Unternehmensexterne Faktoren
- 3.4.2 Struktur- und politikbezogene Einflußfaktoren der vertreibenden Unternehmung
- 3.5 Auswahl von Distributionsalternativen
- 3.6 Kommunikation, Steuerung und Kontrolle der Distributionspolitik
- 3.7 Konflikte und Konfliktbewältigung in Distributionskanälen
- 3.8 Logistik
- 4. Hinweise zur Kontrahierungspolitik
- 4.1 Vertragsgestaltung
- 4.2 Zur Preispolitik
- 4.2.1 Ausgewählte preistheoretische Grundlagen
- 4.2.2 Preisdifferenzierung
- 4.2.3 Anlässe von Preisentscheidungen
- 4.2.4 Für die Preispolitik bedeutsame Zielsetzungen und preisstrategische Optionen
- 4.2.5 Hauptdeterminanten der Preisentscheidung
- 4.3 Konditionenpolitik
- 4.3.1 Rabatte, Skonti, Boni
- 4.3.2 Liefer- und Zahlungsbedingungen
- 5. Hinweise zur Kommunikationspolitik
- 5.1 Grundlagen der Kommunikation
- 5.1.1 Begriffliche Grundlagen
- 5.1.2 Die Bedeutung der Kommunikationspolitik
- 5.1.3 Die Bedeutung neuer IuK-Technologien für die Kommunikationspolitik
- 5.2 Bedeutung des Buying-Center-Konzepts für die Ausgestaltung der Kommunikationspolitik
- 5.3 Ausgewählte Instrumente der Kommunikationspolitik
- 5.3.1 Zur Notwendigkeit der Abstimmung aller Kommunikationsinstrumente zur Erreichung eines konsistenten und stabilen Images
- 5.3.2 Public Relations
- 5.3.3 Persönliche Kommunikation
- 5.3.4 Verkaufsförderung
- 5.3.5 Werbung
- Literaturverzeichnis
- Kapitel VI: Ausgewählte Implementierungsprobleme
- 1. Wandel in den Anforderungen an das Management von Technologie-Unternehmungen
- 2. Spannungsfelder zwischen technischen und marktorientierten Bereichen
- 3. Lösungshinweise zur Schnittstellenproblematik zwischen Technikern und Kaufleuten
- 3.1 Die Unternehmenskultur als Ansatzpunkt zur Schnittstellengestaltung
- 3.2 Das Corporate Identity Konzept
- 3.3 Führung als Ansatzpunkt zur Schnittstellengestaltung
- 3.4 Die Organisation als Ansatzpunkt der Schnittstellengestaltung
- 3.5 Das Planungs- und Kontrollsystem als Ansatzpunkt zur Schnittstellengestaltung
- 3.6 Die personale Ebene als Ansatzpunkt zur Schnittstellengestaltung
- 4. Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Index