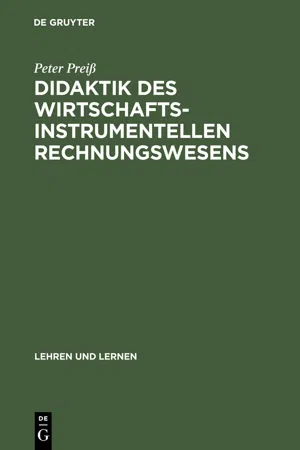
- 509 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Didaktik des wirtschaftsinstrumentellen Rechnungswesens
Über dieses Buch
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Didaktik des wirtschaftsinstrumentellen Rechnungswesens von Peter Preiß im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Verwaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- 1. Wirtschaftsinstrumentelles Rechnungswesen als Innovation in der kaufmännischen Bildung
- 1.1. Allgemeine Innovationserfordernisse in der kaufmännischen Bildung
- 1.2. Spezielle Innovationserfordernisse im Rechnungswesenunterricht
- 1.3. Grundzüge des wirtschaftsinstrumentellen Ansatzes
- 1.4. Zielsetzung und Aufbau der Darstellung
- 2. Curriculare Bezugspunkte des wirtschaftsinstrumentellen Rechnungswesenunterrichts
- 2.1. Veränderte Qualifikationserfordernisse in der kaufmännischen Ausbildung
- 2.1.1. Zielvorgaben in Ausbildungsordnungen, Rahmenlehrplänen, landesspezifischen Richtlinien und Prüfungsstoffkatalogen
- 2.1.2. Orientierungspunkte fachdidaktischer Zielpräzisierung
- 2.1.3. Konsequenzen des Wandels der Arbeitsbedingungen im Rechnungswesen
- 2.1.4. Internationale Reformbemühungen in der Rechnungswesenausbildung
- 2.2. Orientierung an fachwissenschaftlichen Forschungs- und Ausbildungskonzeptionen
- 2.2.1. Zum Verhältnis fachwissenschaftlicher und beruflicher Inhalte
- 2.2.2. Die „systemorientierte Betriebswirtschaftslehre“ als Ausgangspunkt integrativer Überlegungen
- 2.2.3. Einbeziehungen von Grundgedanken anderer betriebswirtschaftlicher Ansätze
- 2.2.4. Rechnungswesen-, bilanz- und kontentheoretische Grundlagen
- 2.3. Das „Allgemeine Unternehmensmodell“ als Hilfsmittel zum Verständnis der Buchungstechnik und ökonomischer Zusammenhänge
- 2.3.1. Modellierungsobjekte und -Subjekte sowie Zusammenhänge verschiedenartiger Modelle
- 2.3.2. Güter- und Geldströme in volkswirtschaftlichen Kreislaufmodellen
- 2.3.3. „Wertkette“ und „Wertschöpfungskette“ als Verknüpfung volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Perspektiven
- 2.3.4. Die Teilprozesse innerhalb eines Unternehmens und ihre monetäre Aspektuierung im Rechnungswesen
- 2.4. Vergleich der Modellierungsmethode mit traditionellen Konzeptionen des Rechnungswesenunterrichts
- 2.4.1. Vergleich mit anderen Einstiegskonzeptionen
- 2.4.2. Hervorhebung des Leistungsprozesses
- 2.4.3. Beginn mit einer Kapitalgesellschaft
- 2.4.4. Darstellung der Bilanzen als normierte, stichtagbezogene, externe Rechnungslegung
- 2.4.5. Erläuterung von Form und Inhalt der Konten sowie deren Ausdifferenzierung im Kontensystem
- 2.4.6. Intentionale Mehrdimensionalität und Interdependenz
- 2.5. Elaborative und integrative Makrosequenzierung
- 2.5.1. Die „Curriculumspirale“ als Leitgedanke der Lehrstoffabfolge
- 2.5.2. Integrationserfordernisse in Abhängigkeit von der Lehrplanorganisation
- 2.5.3. Skizzierung einer sequenztheoretischen Strategie für die Entwicklung kaufmännischer Curricula
- 2.6. Gestaltung der Lernmaterialien, Lernprozesse und Lernerfolgskontrollen im Sinne konstruktivistischer Prinzipien
- 2.6.1. Grundsätze des Lernhandelns
- 2.6.2. Gestaltung und Einsatz der Arbeitsmittel
- 2.6.3. Systematisierungen: Lehrbücher, Lernprogramme
- 2.6.4. Lehrerverhalten
- 2.6.5. Lernerfolgskontrollen und Leistungsbewertung
- 3. Didaktische Konkretisierung der „Einführung in das betriebliche Rechnungswesen“
- 3.1. Erarbeitung formaler und inhaltlicher Grundlagen anhand ganzheitlicher Vorformen der doppelten Buchführung
- 3.1.1. Lektion 1. Der Kassenbericht als Grundmodell des Buch-Ist-Vergleichs
- 3.1.2. Lektion 2: Von der Inventur zur Bilanz - die monetäre Erfassung und normierte Darstellung eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt
- 3.1.3. Lektion 3: Das Unternehmen hinter der Bilanz – Modellierung der Finan- zierungs- und Leistungsprozesse und der Beziehungen zu anderen Wirtschaftseinheiten
- 3.2. Erarbeitung des Systems der doppelten Buchführung über die betriebswirtschaftliche Sicht der Leistungs- und Finanzierungsprozesse
- 3.2.1. Lektion 4: Die Hauptbuchkonten als Modell der Wertbewegungen und -bestände zwischen den Bilanzierungszeitpunkten
- 3.2.2. Lektion 5: Funktion der Bestände im Leistungsprozess und die Erfassung ihrer Veränderung
- 3.2.3. Lektion 6: Die Belastung des Konsums durch die Besteuerung des Umsatzes bei der verkaufenden Unternehmung
- 3.2.4. Lektion 7: Berichtigung des Leistungswertes bei Nichtinanspruchnahme berechneter Leistungen
- 3.2.5. Lektion 8: Leistungsaustausch über die Staatsgrenzen (innergemeinschaftlich und mit Drittländern)
- 3.3. Systematisierung und Festigung anhand der Organisation des Rechnungswesens
- 3.3.1. Lektion 9: Die Organisation der Konten im Hauptbuch und die Ergänzung des Hauptbuchs durch andere Instrumente
- 3.3.2. Lektion 10: Rationalisierung und Effektivierung der Buchführung durch Finanzbuchhaltungsprogramme
- 4. Curriculare Möglichkeiten zur Elaboration modellierter Grundstrukturen
- 4.1. Ausdifferenzierung und Erweiterung des Beschaffungs- und Absatzbereichs im Unternehmensmodell
- 4.1.1. Bezugskosten - Anschaffungsnebenkosten
- 4.1.2. Kosten des Absatzes und Nebenleistungen
- 4.1.3. Sonderformen der Bezahlung
- 4.2. Ausdifferenzierung und Erweiterung der Modellierung in der Personal Wirtschaft
- 4.2.1. Modellierung der sozial abgesicherten Arbeitsbeziehungen
- 4.2.2. Buchung der Entgeltabrechnung
- 4.2.3. Sonstige Personalaufwendungen, insbesondere Reisekostenabrechnung
- 4.2.4. Pensionszusagen und Pensionsleistungen
- 4.3. Umstrukturierung der Modellierung des Leistungsprozesses durch die Kostenrechnung
- 4.3.1. Kostenrechnung als Neumodellierung des Leistungsprozesses
- 4.3.2. Die Aufspaltung des Leistungsprozesses
- 4.3.3. Einzelkosten und Gemeinkosten
- 4.4. Ausdifferenzierung und Erweiterung im Zusammenhang mit langfristigen Finanzierungsentscheidungen
- 4.4.1. Rechtsform und Eigenkapitalveränderungen
- 4.4.2. Unternehmensaufspaltung und Beteiligungen
- 4.4.3. Ausdifferenzierung der Eigen- und Fremdfinanzierung sowie der Finanzanlagen
- 4.5. Ausdifferenzierung und Erweiterung der Modellierung im Rahmen der Anlagenwirtschaft
- 4.5.1. Anlagenwirtschaft und periodenübergreifende Modellierungen
- 4.5.2. Erster Geschäftsgang
- 4.5.3. Zweiter Geschäftsgang (Folgeperiode)
- 4.5.4. Miete und Vermietung von Anlagevermögen
- 4.6. Ausdifferenzierung, Erweiterung und Zusammenfassung im handelsrechtlichen Jahresabschluss
- 4.6.1. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte bei Anlage- und Umlaufvermögen sowie bei Schulden
- 4.6.2. Zeitliche Abgrenzung
- 4.6.3. Der vollständige Jahresabschluss (Einzelabschluss)
- 4.6.4. Der Konzernabschluss
- 5. Ausblick auf Implementation und Evaluation
- 5.1. Bisherige Schritte der Dissemination
- 5.2. Erfordernisse in der Lehreraus- und -Weiterbildung
- 5.3. Weitere Entwicklungs- und Forschungsarbeiten
- Literatur
- Sachregister