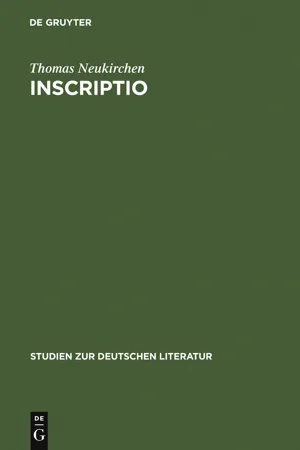
Inscriptio
Rhetorik und Poetik der Scharfsinnigen Inschrift im Zeitalter des Barock
- 304 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Inscriptio
Rhetorik und Poetik der Scharfsinnigen Inschrift im Zeitalter des Barock
Über dieses Buch
Das 17. Jahrhundert kann angesichts der Fülle inschriftlicher Phänomene in den gelehrten Künsten zweifellos als das epigraphische Jahrhundert par excellence angesehen werden, und es ist deshalb kein Zufall, daß in ihm die "Scharfsinnige Inschrift" (Inscriptio arguta) entsteht. Bei der Inscriptio arguta handelt es sich um eine spezifisch barocke Form gelehrter Literatur, die zwischen gebundener und ungebundener Rede angesiedelt ist. Sie zeichnet sich durch ihre zentrierte äußere Form, ihre argute Diktion sowie ihre gedruckten und, etwa beim höfischen Fest, ungedruckten Erscheinungsweisen aus. In der Praxis seit 1619 nachweisbar, entfaltet sich seit 1649 eine umfangreiche rhetorische und poetologische Theoriebildung im Neulateinischen (Masen, Weise, Morhof) und Italienischen (Tesauro), der eine Rezeption in der deutschen Literatur unmittelbar folgt (Harsdörffer, Birken, Weise, Riemer, Hallbauer). Beide werden detailliert nachgezeichnet. Darüber hinaus wird der Einfluß der arguten Inschriftenästhetik auf die Form und satirische Schreibhaltung von Flugschriften herausgearbeitet sowie ein Begriff der textimmanenten Inschrift entwickelt, der unabhängig von der "Scharfsinnigen Inschrift" zu betrachten ist und auf diese Einfluß ausübt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts steht die Inscriptio arguta zwar immer noch hoch im Kurs, doch wird zum einen durch die Kritik an der Argutia-Bewegung, zum anderen durch ein verändertes Verhältnis zwischen Gelehrsamkeit und Schrift in der Frühaufklärung schließlich ihr Ende besiegelt, ebenso wie Argutia-Bewegung und eine positive Bedeutung der Schrift die Entwicklung der Inscriptio arguta vorantreiben.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Beispiele
- 2. Gegenstand und Ziel der Untersuchung, Forschungsliteratur
- 3. Einführung in das Phänomen der Inscriptio arguta und des Stilus lapidarius
- II. Theorie und Praxis der neulateinischen Inscriptio arguta
- 1. Auftakt der theoretischen Erörterung: Jakob Masen und Emanuele Tesauro
- 2. Die Produktion gedruckter und ungedruckter Inscriptiones argutae: von Tesauro (1619) bis zu Christian Weise (1678)
- 3. Die Theorie der Inscriptio arguta seit Tesauros ›Cannocchiale Aristotelico‹ (1654) bis zu Christian Weise (1678)
- 4. »The classic guide-book to the new epigraphy«: Christian Weises ›De argutis inscriptionibus libri II‹ (1678/88) und die Inscriptio arguta als Darstellungsmöglichkeit des »Politischen«
- 5. Der Stilus lapidarius in der epigraphischen Flugschrift und die Argutia als Dimension der Satire
- 6. Die Inscriptio arguta bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
- III. Die Scharfsinnige Inschrift in der deutschsprachigen Literatur
- 1. Die Einführung der »Kunstquellen« und der Scharfsinnigen Inschrift in die deutsche Literatur durch Georg Philipp Harsdörffer (1656)
- 2. Die Integration der Argutia-Theorie in die deutschsprachige Rhetorik mit Hilfe der Scharfsinnigen Inschrift: Weises ›Politischer Redner‹ (1677)
- 3. Sigmund von Birken als Übersetzer des ›Mausoleum‹ (1664) Ferenc de Nádasdys und die Integration der »Stein-Schreib-Art« in die deutschsprachige Poetik (1679)
- 4. Die Scharfsinnige Inschrift als textimmanente Inschrift. Nebst einer ›Kurzen Geschichte der textimmanenten Bauminschrift‹
- 5. Systematisierungsversuche: Rhetorik, Poetik und Praxis der Scharfsinnigen Inschrift bis zu Hallbauers Sammlung ›Teutscher sinnreicher Inscriptionen‹ (1725/32)
- IV. Abgesang der Frühaufklärung auf die Scharfsinnige Inschrift
- V. »Die Schrift läst deine Zier / o Baum! verwelken nicht«: Die Inschrift als Präsenz der Schrift und Repräsentation des Schriftgelehrten in der Literatur des Barockzeitalters
- Nachbemerkung
- VI. Literaturverzeichnis
- 1. Quellen
- 2. Sekundärliteratur
- 3. Abkürzungen und Hilfsmittel
- VII. Abbildungsverzeichnis
- Namenregister