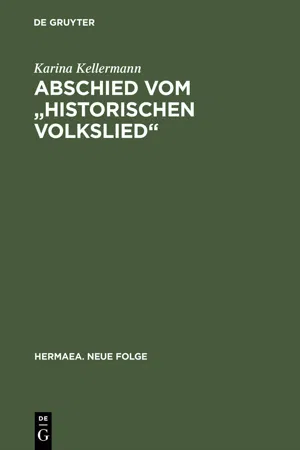
Abschied vom "historischen Volkslied"
Studien zu Funktion, Ästhetik und Publizität der Gattung historisch-politische Ereignisdichtung
- 425 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Abschied vom "historischen Volkslied"
Studien zu Funktion, Ästhetik und Publizität der Gattung historisch-politische Ereignisdichtung
Über dieses Buch
Die Arbeit untersucht ein zentrales und umfängliches Corpus spätmittelalterlicher Geschichtsdichtungen vom 14. Jahrhundert bis zur Reformation, das bis heute im toten Winkel der Geschichtswissenschaft, Publizistik und Germanistik liegt und seit 150 Jahren unter dem irreführenden Terminus 'historische Volkslieder' firmiert. Nach einer grundlegenden Revision der Texte und der Beobachtung ihrer situativen Anbindung an ein historisches Ereignis wird der Nachweis geführt, daß sinnvoll von einer eigenen Gattung auszugehen ist, die sich durch eine zweckgebundene Ästhetik, spezifische Funktionen und einen hohen Grad an Publizität auszeichnet: die historisch-politische Ereignisdichtung. Warum die propagandistischen Lieder und Reimreden zur Tagespolitik von der Forschung so konsequent ignoriert wurden, ist umso unverständlicher als diese Vernachlässigung in krassem Gegensatz steht zu dem breiten Interesse, das die spätmittelalterliche Gesellschaft an ihnen genommen hat. Übersehen worden ist bislang auch, daß schon so früh - z. T. noch vor den neuen Publikationsmöglichkeiten im Medium des Buchdrucks - an der Konstitution von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung gearbeitet wurde, Kategorien, die man immer genuin neuzeitlich definiert hat. Der spezifische Reiz dieser poetischen Manifestationen der politischen Publizistik liegt in ihrem Zeugnischarakter für die Mentalitätsgeschichte. Die von den Verfassern getroffene Wahl des aktuellen Ereignisses, ihre aggressiv polemische oder eher vorsichtig insinuierende Präsentation und die explizite Wendung an ein informiertes und hochmotiviertes Publikum gewähren Einblicke in politische Ansichten, soziale Empfindlichkeiten, Existenzängste und Glaubensnöte des spätmittelalterlichen Menschen wie kaum eine andere literarische Form oder historische Quelle der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Gegenstand und Thesen
- II. Forschungsstand und Erkenntnisinteresse
- B. Geschichte und Systematik der Gattung historisch–politische Ereignisdichtung
- I. Vorüberlegungen zur Gattungsdiskussion – Methode und Terminologie
- II. Die Gattung historisch–politische Ereignisdichtung – Merkmale und Begriff
- III. Die Materialbasis – Textsammlungen und Verzeichnis der historisch–politischen Ereignisdichtungen
- IV. Affinitäten und Oppositionen zu anderen Gattungen
- C. Exemplarische Analysen der historisch-politischen Ereignisdichtungen um den Markgrafenkrieg (1449–53)
- I. Vorbemerkungen
- 1. Die historische Situation
- 2. Die Textgruppe in der Forschung
- 3. Editionslage und –prinzipien
- II. Die Polemik des Bauernfeind gegen die Reichsstädte(›Eberhart von Vrbach jst ein mann‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- 4. Analyse
- III. Klage und Anklage des Ulrich Wiest (›O herre got, ich klag dir als mein laid‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- 4. Analyse
- IV. Maßlosigkeit und Häme in der anonymen Replik auf Wiests Lied (›Jvhileus ist vß verchünt‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- 4. Analyse
- V. Adlige Agitation durch Verketzerung der Städter (›In gotes nomen vach ich an‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- 4. Analyse
- VI. Der Nürnberger Sieg bei Pillenreuth, interpretiert als persönliche Niederlage des Markgrafen (›Man hat gesagt vnd gesvngen‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- 4. Analyse
- VII. Stolz und Schadenfreude eines Nürnbergers über den städtischen Sieg bei Pillenreuth (›Der marggraf macht,das ich von ihm muß singen‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- VIII. Die Schlacht bei Pillenreuth als mißglückter Fischzug des Markgrafen (›Dor wmb so woll wir singen vnd sagen‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textedition
- 3. Übersetzung
- 4. Gemeinsame Analyse von VII und VIII
- IX. Nürnbergs militärische, wirtschaftliche und logistische Überlegenheit, kommentiert von Hans Rosenplüt (›Ie wesender und immer leber‹)
- 1. Überlieferung
- 2. Textabdruck
- 3. Übersetzung
- 4. Analyse
- D. Annäherung an eine Funktionsgeschichte der Gattung
- I. Literaturbetrieb und Überlieferungssituation
- II. Wirkungsabsicht und Wirkungsmöglichkeit
- E. Zum ästhetischen Profil historisch-politischer Ereignisdichtung
- I. Zwischen Fiktion und Wahrheit
- II. Inszenierte Ereignisnähe
- F. Öffentlichkeit und Gemeinschaft
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Register der Texte
- Register der Personennamen
- Register der Ortsnamen