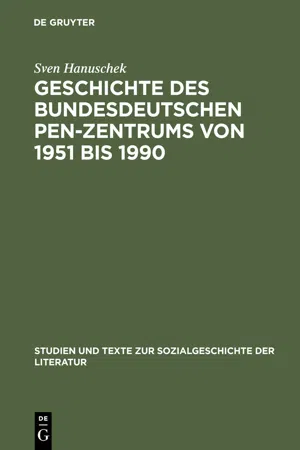
- 600 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Geschichte des bundesdeutschen PEN-Zentrums von 1951 bis 1990
Über dieses Buch
Was 1921 als freundschaftlicher Dinnerclub in London begann, ist heute die einzige internationale Schriftstellervereinigung, die es gibt. Der vorliegende Band ist eine Institutionsgeschichte des westdeutschen Clubs, von der Teilung des gesamtdeutschen Zentrums 1951 bis zur Vereinigung der deutschen Teilstaaten 1990. Die literatursoziologische Studie zeichnet auf der Grundlage von Gesprächen und mannigfaltigen Archivalien die Entwicklung vom elitären "Wohnzimmerverein" der 50er zum repräsentativen Club der 80er Jahre. PEN wird in seinen Verwicklungen in die Zeitgeschichte, in seinen Leistungen, seinem Selbstbild und seinen Selbsttäuschungen gezeigt, personifiziert anhand der Protagonisten des Clubs von Kästner, Edschmid und Neumann über Böll bis Jens, Gregor-Dellin und Amery.
Anhand der Geschichte dieser Schriftstellervereinigung und ihren repräsentativen Intellektuellen läßt sich die Geschichte der Bundesrepublik nachvollziehen: der Kalte Krieg, Mauerbau und Spiegelaffäre, das Jahr 1968 und die deutsche Einheit. Der Reiz einer umfassenden PEN-Geschichte liegt jedoch häufig nicht in der Analyse von Zeitgeist- oder Großereignissen, sondern im sprechenden, manchmal geradezu mikrogeschichtlichen Detail.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Siglen
- Vorbemerkung
- A. Der PEN (Bundesrepublik) in den 50er Jahren: Von der Gründung zur internationalen Profilierung
- I. Rekapitulation: Frieden und Freiheit
- 1. Die »Affäre« Johannes R. Becher
- 2. Trennungen über Trennungen
- 3. Die tatsächliche Trennung: Düsseldorf
- II. Über die Entstehung politischer Ereignisse
- 1. Zwei westliche Protagonisten
- 2. »Blutmäßig viel Sinn für nationale Würde«. Zur moralischen Qualifikation westlicher Aktanten
- III. Nach der Sezession: Das Zentrum muß laufen lernen
- 1. Eine erste Gründungsversammlung: Darmstadt, Dezember 1951
- 2. Internationale Anerkennung mit Ecken und Kanten: Paris, März 1952
- 3. Versuch internationaler Selbstdarstellung: Nizza, Juni 1952
- 4. Noch eine Gründungsversammlung: Darmstadt, Dezember 1952
- 5. Klärung der Bezeichnungen: Dublin, Juni 1953
- 6. Die erste ›ordentliche‹ Sitzung: München, April 1954
- IV. Beziehungen zu anderen Zentren: Ein mühsamer Aufbau
- 1. PEN International
- 2. PEN-Zentrum Ost und West
- 3. PEN-Zentrum Deutscher Autoren im Ausland
- 4. Der internationale PEN-Kongreß 1954: Deutsche Empfindlichkeiten?
- V. Der Clubcharakter in den 50er Jahren
- 1. Wohnzimmerverein
- 2. »Der PEN ist doch ein Freundschaftsclub«
- 3. Politisches Nicht-Engagement
- 4. »Schuß aus der Intrigenecke«
- VI. Internationale Akzeptanz und Binnen-Einbruch: 1955-1960
- 1. Ein kurzes Atemholen: »Bulganins Lächeln«
- 2. Nach Ungarn: »die Bereitschaft Entschliessungen zu formulieren«
- 3. Der internationale PEN-Kongreß in Frankfurt
- B. Die 60er Jahre: Das Ende der Versteinerungen
- I. Writers in Prison
- II. Der Mauerbau und die »Pflichten« des PEN
- 1. 1961 – vor der Mauer
- 2. 1961 – nach der Mauer
- III Zwischenpräsidien: 1962-1969
- 1. Der PEN und die Spiegel-Affäre
- 2. Schritte zur Koexistenz: »Den guten Willen haben wir«
- 3. Tod einer Utopie: 1968 und das Ende des Prager Frühlings
- IV. Beziehungen zu anderen Institutionen
- 1. Der ständige Verbindungsausschuß
- 2. Die PEN-Altvorderen über die Gruppe 47 und ihre »kläglichen Manifeste«
- C. Die 70er und 80er Jahre: Konstante Arbeit mit geringfügigen Pannen
- I. »Ostpolitik« auch im PEN: Rasante Politisierung
- 1. Bolls Präsidentschaft: Radikalität, Empfindlichkeit und »Kölner Lakonie«
- 2. Koch und Kesten: Organisationstalent und ›revolutionäres Kaffeehaus‹
- 3. Der Fall Amalrik: Öffentliche Konfrontation der ›jungen Linken‹ mit dem PEN-›Establishment‹
- 4. Krisenmanagement ohne Ende
- II. Angekommen: Der Clubcharakter in den 70er und 80er Jahren
- 1. Zuwahl von Politikern. Die Affäre um Hans Maier
- 2. Zur Frage öffentlicher politischer Erklärungen
- 3. Ein Abbruch: Die Mandel-Affäre 1977
- III. Versuche zur Re-Literarisierung des PEN
- 1. Von »Toleranz und Transparenz« zur Langeweile: Walter Jens’ Präsidentschaft
- 2. Agieren des Clubs im politischen Feld
- 3. Glatte Routine (1983-1988)
- IV. Beziehungen zu anderen Clubs
- 1. Die Internationalen PEN-Zentren
- 2. Das PEN-Zentrum DDR
- V. »Politische Ereignisse, die einen sprachlos sein lassen«: Der Anfang eines mühsamen Einigungsprozesses (1989-1990)
- D. Anhänge
- I. Chronik des PEN-Zentrums Bundesrepublik (1946-1998)
- II. Literaturverzeichnis
- III. Chronologische Liste der zitierten Tagespresse
- IV. Tabellen zur Mitgliederstatistik (Raphaela Tautz und Rea Triyandafilidis)
- V. Namenregister
- VI. Dank