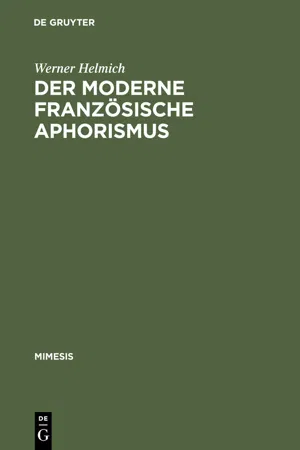
- 401 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Über dieses Buch
Keine ausführliche Beschreibung für "Der moderne französische Aphorismus" verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der moderne französische Aphorismus von Werner Helmich im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Europäische Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Gattungsprobleme, Darstellungs- und Methodenfragen
- [1] Textbefund, Kenntnisstand und Forschungslage
- [2] Bezeichnungschaos
- [3] Begriffsgeschichte von Aphorismus/aphorisme
- [4] Versuch einer Gattungsdefinition
- [5] Das Kriterium der Autorintention
- [6] Abgrenzung von Nachbargattungen
- [7] Gattungseinheit und Gattungsvielfalt
- [8] Aphoristisches Denken
- [9] Der Aphorismus als Literatur und Erkenntnis
- [10] Die sprachliche und zeitliche Abgrenzung des Untersuchungsobjekts
- [11] Aufgaben und Hindernisse
- [12] Innovation und Gattungsreflexion
- [13] Methodenkritik
- [14] Äußerer Aufbau der Untersuchung und Erkenntnisziel
- Kapitel 2: Die moralistische Maxime und ihre Umgestaltung im 19. Jahrhundert
- [1] Die moralistischen moules
- [2] Zur Moralistik-Diskussion
- [3] Die Wegbereiter der klassischen Maxime und La Rochefoucauld
- [4] Pascal
- [5] La Bruyère und Montesquieu
- [6] Vauvenargues und Diderot
- [7] Chamfort, Rivarol und die konventionelle Moralistik des 17. und 18. Jahrhunderts
- [8] Joubert
- [9] Stendhal, Balzac, Jouffroy und Vigny
- [10] Sainte-Beuve und andere Kritiker
- [11] Baudelaire und Lautréamont
- [12] Die epigonale Maxime des 19. Jahrhunderts
- Kapitel 3: Tagebuch- und Notizbuch-Aphoristik
- [1] Journal intime und Reflexionstagebuch
- [2] Aphoristische Tagebücher aus der literarischen Werkstatt: Jules Renard und die Literarästhetik des aphoristischen Tagebuchs
- [3] Vildrac und Claudel
- [4] Valéry und Barrès
- [5] Montherlant, Saint-Exupéry und Camus
- [6] Henein und Haidas
- [7] Religiös-mystische Tagebücher: Marie Noël und Reverdy
- [8] Simone Weil und Bousquet
- [9] Aphoristische Tagebücher als literarische Werke: Char
- [10] Jouhandeau und Bourbon Busset
- [11] Henri Petit und neuere Veröffentlichungen
- [12] Chronologiebezug
- [13] Anteil der Aphorismen
- [14] Charakteristika des Tagebuch- Aphorismus
- [15] Wechselwirkungen zwischen Tagebuch und Aphorismus
- Kapitel 4: Der Surrealismus und die gnomische Tradition. Der Beitrag Scutenaires
- [1] Erste Indizien
- [2] Autoren und Texte
- [3] Parodie einzelner gnomischer Modelle durch Substitution: Negation und Paronomasie
- [4] Permutation, Kontamination, Verrätselung, Parodieketten
- [5] Parodie durch Zusätze: Umwertende Fortsetzung, Anti-Pointe, Pseudo-Verfasser
- [6] Parodie von Gattungskonventionen der Maxime: Paradoxie und Pointenaussparung
- [7] Exzessiver Wortspielgebrauch
- [8] Parodie des Sprichworts
- [9] Neue Inhalte: Psychoanalytisches und Religionskritik
- [10] Aphoristische Selbstreflexion am Beispiel Scutenaire
- Kapitel 5: Die Metamorphose des Bildaphorismus. Von Jules Renard zu René Char
- [1] Die impressionistischen Bildaphorismen Jules Renards
- [2] Sartres Kritik
- [3] Neuere Analogie-Aphorismen
- [4] Robert Mallet und Saint-Pol-Roux
- [5] Malcolm de Chazal und ein Seitenblick auf die Greguería
- [6] Reverdy und die surrealistische Bildtheorie
- [7] René Char: Prosagedicht und »poetischer« Bildaphorismus
- [8] Lochac und Bousquet
- [9] Michaux, Jabès und jüngere
- [10] Die belgischen Surrealisten
- [11] Vom Dadaismus zur Computer-Aphoristik
- [12] Gattungsgeschichtliche Folgerungen
- Kapitel 6: Die Synthese von wissenschaftlicher und literarischer Aphoristik. Das Modell Valery
- [1] Bacon und die Tradition des wissenschaftlichen Aphorismus bis ins 19. Jahrhundert
- [2] Soziologie, Politik, Sozialpsychologie
- [3] Biologie
- [4] Philosophie und Theologie
- [5] Kunst- und Literarästhetik
- [6] Wissenschaft, System und Fragment in Valérys Cahiers
- [7] Von den Cahiers zu den publizierten Aphorismen
- [8] Zur Apologie von Valérys Aphorismen und Fragmenten
- [9] Aphoristische Stilmittel
- [10] Paradox
- [11] Korrektur und Parodie
- [12] Das Verhältnis zur Gattungstradition
- [13] Literarische Aphorismen zur Ästhetik und Poetik bei Valery
- [14] Bei anderen Autoren
- [15] Fazit
- Kapitel 7: Konventionelles und Epigonales
- [1] Die konventionelle Aphoristik und ihr Gattungskanon
- [2] Konventionelle Maximensammlungen
- [3] Das Vorwort der Reihe Notes et maximes
- [4] Thematische Gliederung und Gattungskontiguitäten (Maxime und Roman)
- [5] Inhaltliche Anlehnungen an die moralistische Maxime
- [6] Formale Anlehnungen
- [7] Reflexe der jüngeren Gattungsentwicklung: Neue Inhalte
- [8] Neue Ausdrucksformen
- [9] Das Bewußtsein der moralistischen Gattungstradition
- [10] Georges Wolfromms Versuch einer Ehrenrettung der Maxime
- Kapitel 8: Das Spektrum des politischen Aphorismus
- [1] Auseinandersetzung mit der Forschung und Begründung der Gliederung
- [2] Affirmative und konventionelle politische Aphorismen
- [3] Punktuelle Kritik an politischen Repräsentanten und Institutionen
- [4] Kritik am Patriotismus
- [5] Kritik am Totalitarismus und Extremismus
- [6] Kritik am Sozialismus
- [7] Bürgerkritik und moralisch begründete Sozialkritik
- [8] Kritik an der Politik als Ideologie
- [9] Grundsätzliche Demokratiekritik von rechts: Antiegalitarismus und Kult der Stärke
- [10] Rassismus, Dekadenzkritik und faschistische Aphoristik
- [11] Grundsätzliche Kritik von links: Von demokratisch-sozialistischen Positionen aus
- [12] Utopisch-revolutionäre Kritik
- [13] Ergebnisse
- Kapitel 9: Über Pascal hinaus. Zur Entwicklung der Aphoristik über metaphysische Gegenstände
- [1] Allgemeines zur zeitgenössischen Rezeption der Pensées
- [2] Bekenntnisse zu Pascal
- [3] Zitate und Anspielungen
- [4] Zu Pascal zurück
- [5] Korrekturen und Neuinterpretationen
- [6] Pascalsche Denkformen
- [7] Das ontologische Paradox als Motor der negativen Theologie
- [8] Reflexion des paradoxen aphoristischen Denkens
- [9] Die Weiterentwicklung der Seinsanalogie
- [10] Sonderformen: Liebes- und Poetologie-Metaphysik
- [11] Reflexion der Seinsanalogie
- [12] Pascal und Nietzsche
- [13] Neue Nietzsche-Bilder
- [14] Weitere Modelle: Heraklit, Laotse
- [15] Zur Reflexion eines nicht-systematischen Philosophierens
- Kapitel 10: Der souveräne Aphorismus. Cioran, Perros, Munier, Jourdan
- [1] Versuch einer Synthese der Entwicklungslinien
- [2] Vier repräsentative zeitgenössische Autoren
- [3] Ciorans Aphoristik des Leidens und des Todes
- [4] Versperrte Auswege
- [5] Erkenntnis und Verneinung
- [6] Ciorans aphoristische Ästhetik
- [7] Ciorans Sprachform
- [8] Perros’ Blick auf die condition humaine
- [9] Der Perrossche Sprachstil
- [10] Perros als Gattungstheoretiker
- [11] Essenz und Existenz in Muniers Aphoristik
- [12] Muniers Gattungsreflexion
- [13] Jourdans Sterbegnomik
- [14] Sprachform und aphoristisches Gattungsbewußtsein bei Jourdan
- [15] Gemeinsamkeiten und neue Deszendenzen
- Bibliographie
- Register