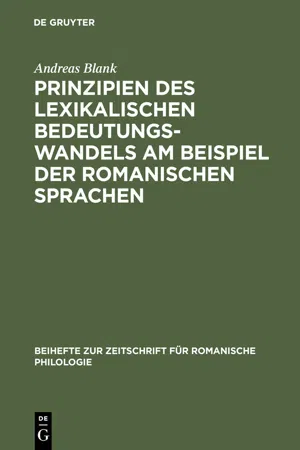
Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen
- 549 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen
Über dieses Buch
Das bis in die jüngste Zeit gültige Referenzwerk zum Bedeutungswandel, Stephen Ullmanns "Principles of Semantics", datiert aus den 50er Jahren. Die vorliegende Studie versteht sich als ein kritisch an Ullmann anknüpfender Neubeginn, mit dem Ziel einer am heutigen Erkenntnisstand der Linguistik ausgerichteten Erarbeitung übereinzelsprachlicher Prinzipien der semantischen Innovation. Als Materialbasis dient der romanische Wortschatz, ergänzt durch viele Beispiele aus dem Englischen, dem Deutschen sowie anderen Sprachen. Die reiche Forschungstradition wird dabei in die neuere kognitiv-semantische und pragmatische Forschung eingebunden. Die entwickelte Theorie fußt auf einem einzelsprachliches und konzeptuelles Wissen integrierenden sechsstufigen Modell der Bedeutung, einem analog konzipierten fünfseitigen semiotischen Modell sowie auf den drei psychologischen Assoziationsprinzipien Similarität, Kontrast und Kontiguität. Auf dieser Grundlage können die Verlaufsmöglichkeiten sowie die verschiedenen sprachlichen Verfahren des Bedeutungswandels (z.B. Metonymie, Metapher, Ellipse) beschrieben und typologisiert werden. Des weiteren werden die Motive der Sprecher für semantische Innovationen völlig neu geordnet. Schließlich wird die Polysemie als synchrones Abbild des Bedeutungswandels eingehend diskutiert. Alle behandelten Beispiele werden in einem Anhang unter Angabe des Motivs der Innovation, der zugrundeliegenden psychologischen Assoziation und des verwendeten sprachlichen Verfahrens aufgeführt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Konventionen und Abkürzungen
- Einleitung
- I. Bedeutungswandel: ein wissenschaftsgeschichtlicher Rückblick
- 1. Von Cicero bis Nyrop
- 2. Von Wundt bis Stern
- 3. Von Trier bis heute
- 3.1. Traditionelle, strukturalistische und onomasiologische Theorien
- 3.2. Die achtziger und neunziger Jahre: pragmatische, valenzielle und kognitive Theorien
- 4. Stephen Ullmann
- 4.1. Bedeutung und Bedeutungswandel in Ullmanns Verständnis
- 4.2. Den Bedeutungswandel begünstigende Faktoren
- 4.3. Die Ursachen des Bedeutungswandels
- 4.4. Das Wesen des Bedeutungswandels
- 4.5. Die Folgen des Bedeutungswandels
- 5. Zusammenfassung von Kapitel I: Probleme einer Theorie des lexikalischen Bedeutungswandels
- II. Zur Bedeutung
- 1. Vorüberlegungen
- 2. Wort und Semantik
- 3. Die Bedeutung des Wortes
- 3.1. Einzelsprachlich-sememisches Wissen
- 3.2. Einzelsprachlich-lexikalisches Wissen
- 3.3. Außersprachliches Wissen: Konnotationen und Weltwissen
- 3.4. Exkurs: Weltwissen, Prototypen und Frames: Wege zur ‹Kognitiven Semantik›
- 3.5. Ebenen des Wissens und Ebenen der Bedeutung
- 4. Bedeutung und Zeichen
- 4.1. Zeichenmodelle
- 4.2. Ein komplexes Modell der Semiose
- III. Wesen und Prozeß des Bedeutungswandels
- 1. Was ist Bedeutungswandel?
- 1.1. Neue Bedeutung oder Wandel einer Bedeutung?
- 1.2. Bedeutungswandel und die Ebenen der Bedeutung
- 1.3. Bedeutungswandel: eine Definition
- 2. Der Prozeß des Bedeutungswandels
- 2.1. Bedeutungswandel, Raumnormen und Sprechergruppen
- 2.2. Bedeutungswandel und die Ebenen des Sprachlichen
- 2.3. Beispiele für Innovationen und die Stufen des Bedeutungswandels
- IV. Psychologische Grundlagen des Bedeutungswandels
- 1. Assoziationen, Kognition und Sprache
- 1.1. Zur Verwendung von Assoziationsprinzipien in der traditionellen Historischen Semantik
- 1.2. Assoziationen und Gestaltwahrnehmung
- 1.3. Assoziationen und Sprache
- 2. Assoziationen und Bedeutungswandel
- 2.1. Die adäquate semiotische Grundlage
- 2.2. Assoziationsvorgang, Innovation und Lexikalisierung: erste Annäherung
- V. Die Verfahren des Bedeutungswandels
- 1. Bedeutungswandel auf der Basis von Similarität der Designate: die Metapher
- 1.1. Grundlagen
- 1.2. Worauf beruhen Metaphern?
- 1.3. Die kommunikative Leistung der Metapher
- 1.4. Aspekte des metaphorischen Bedeutungswandels bei einzelnen Wortarten
- 2. Bedeutungswandel auf der Basis von Similarität der Designate mit sekundärer Similarität der Zeicheninhalte
- 2.1. Similarität, Taxonomie und lexikalische Relationen
- 2.2. Bedeutungserweiterung und Bedeutungsverengung
- 2.3. Kohyponymische Übertragung
- 2.4. Zusammenfassung
- 3. Bedeutungswandel auf der Basis von Kontrast
- 3.1. Typen von Gegensätzen
- 3.2. Bedeutungswandel auf der Basis von Kontrast der Designate: die Antiphrasis
- 3.3. Auto-Antonymie (‹Innere› Antonymie): eine Illusion?
- 4. Bedeutungswandel auf der Basis von Kontiguität der Designate I: die Metonymie
- 4.1. Grundlagen und erste Annäherung
- 4.2. Semantik der Metonymie
- 4.3. Der ‹Nutzen› der Metonymie
- 4.4. Typen von Kontiguität – Typen von Metonymie
- 4.5. Aspekte des metonymischen Bedeutungswandels bei einzelnen Wortarten
- 5. Bedeutungswandel auf der Basis von Kontiguität der Designate II: die Auto-Konverse (‹Innere› Metonymie)
- 5.1. Zur Semantik lexikalischer Konversen
- 5.2. Konversen und Bedeutungswandel
- 6. Bedeutungswandel auf der Basis von Kontiguität der Zeichen: die Ellipse
- 6.1. Vorüberlegungen
- 6.2. Warum kommt es zu Ellipsen?
- 6.3. Zur Semantik der Ellipse
- 6.4. Typen von elliptischem Wandel
- 6.5. Weitere Überlegungen
- 6.6. Zusammenfassung
- 7. Bedeutungswandel auf der Basis komplexer Relationen
- 7.1. Bedeutungswandel durch Volksetymologie
- 7.2. Analogischer Bedeutungswandel
- 7.3. Mehrfacher Bedeutungswandel
- 8. Semantischer Wandel im Diasystem: Bedeutungsabschwächung und Bedeutungsverstärkung
- 8.1. Drastische bzw. expressive Bezeichnung und Bedeutungsabschwächung
- 8.2. Euphemismus und Bedeutungsverstärkung
- 9. Vermeintliche Arten des Bedeutungswandels: Bedeutungsverbesserung und Bedeutungsverschlechterung
- 9.1. Zur Problematik des axiologischen Bedeutungswandels
- 9.2. Eine Neuklassifikation des sogenannten axiologischen Bedeutungswandels
- 10. Zusammenfassung von Kapitel V
- VI. Motive des Bedeutungswandels
- 1. Vorüberlegungen
- 2. Zur traditionellen Typologie der Ursachen des Bedeutungswandels
- 2.1. Historische Gründe
- 2.2. Bezeichnungsnot
- 2.3. Lehneinfluß
- 2.4. Beziehung zwischen Konzepten
- 2.5. Psychologische Ursachen
- 2.6. Soziale Ursachen
- 2.7. Sprachliche Ursachen
- 3. Kommunikationsprinzipien und ihre Relevanz für Sprachwandel und Bedeutungswandel
- 3.1. Effizienz- und Expressivitätsprinzipien: die Theorie von Geeraerts
- 3.2. Effizienz und Expressivität beim Sprachwandel: die Theorien von Lüdtke und Keller
- 3.3. Kommunikationsmaximen bei Grice und Sperber/Wilson
- 3.4. Zusammenfassung, oder: warum es zum Sprachwandel kommt
- 4. Arten von Ursachen und verschiedene Ebenen des Bedeutungswandels
- 5. Motive des Bedeutungswandels: eine neue Typologie
- 5.1. Versprachlichung eines neuen Konzepts
- 5.2. Abstraktes oder (fernliegendes) Konzept
- 5.3. Sozio-kultureller Wandel
- 5.4. Enge konzeptuelle oder sachliche Verbindung
- 5.5. Lexikalische Irregularität
- 5.6. Emotionale Markierung eines Konzepts
- 6. Zusammenfassung von Kapitel VI
- VII. Die Folgen des Bedeutungswandels
- 1. Polysemie, oder: die ‹Synchronie des Bedeutungswandels›
- 1.1. Ein problematischer Begriff
- 1.2. Versuch einer Definition
- 2. Bedeutungswandel der ‹zweiten Art›
- 2.1. Reduktiver Bedeutungswandel
- 2.2. Sekundäre Homonymie und Wortspaltung
- 2.3. Sekundäre Polysemie
- 3. Ausblick: Die Darstellung der Bedeutungen eines Wortes
- Schluß
- 1. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2. Ausblick und generelle Schlußfolgerungen
- 2.1. Vorhersagbarkeit von Bedeutungswandel
- 2.2. Der ‹lexikalische Raum›
- 2.3. Bedeutungswandel, Diachronie und Synchronie
- Literaturverzeichnis
- Wortregister
- Anhang: Klassifikation aller Beispiele für Bedeutungswandel