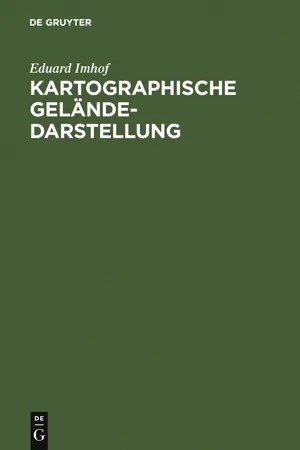
- 445 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Kartographische Geländedarstellung
Über dieses Buch
Keine ausführliche Beschreibung für "Kartographische Geländedarstellung" verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kartographische Geländedarstellung von Eduard Imhof im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Physical Sciences & Geology & Earth Sciences. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Erstes Kapitel
- Geschichtliche Entwicklungen
- Zweites Kapitel
- Die topographischen Grundlagen
- A. Die topographischen Aufnahmeverfahren
- 1. Meßtischaufnahme oder Meßtischtachymetrie
- 2. Tachymeteraufnahme
- 3. Flächennivellement
- 4. Photogrammetrie
- B. Die Genauigkeit der Aufnahme von Geländeoberflächen
- 1. Lage- und Höhengenauigkeit eingemessener Punkte
- 2. Die Genauigkeit von Kantenlinien
- 3. Die Prüfung von Höhenkurven
- 4. Fehlerarten der Höhenkurven
- 5. Die Erfahrungs- und Prüfformel von KOPPE
- 6. Einige weitere Verfahren zur Prüfung der Höhenkurven
- 7. Das Band des mittleren Lagefehlers der Höhenkurven
- 8. Genauigkeiten von Höhenkurven heutiger Aufnahmen
- C. Stand und Qualität der topographischen Kartierung der Erdoberfläche
- D. Abgeleitete Karten oder Folgekarten kleinerer Maßstäbe als Arbeitsgrundlagen
- 1. Allgemeines
- 2. Manierhafte Darstellung der Geländeformen
- Drittes Kapitel
- Weitere Grundlagen und Hilfen
- A. Topographische Gelände- und Kartenlehre
- B. Über das Landschaftszeichnen
- C. Das Luftbild und seine Interpretation
- 1. Einige phototechnische Angaben
- 2. Ergänzungen durch Feldrekognoszierung und Identifikation
- 3. Entzerrung und Photokarten
- 4. Luftbildinterpretation
- 5. Einige Wesensunterschiede von Luftbild und Karte
- D. Binokulare Betrachtung von Stereo-Bildpaaren
- a) Photographische Stereo-Geländebilder nach der Natur
- b) Photographische Stereobilder von Geländemodellen
- c) Anaglyphen photographischer Natur- und Modellaufnahmen
- d) Anaglyphenkarten
- E. Kenntnisse in Geographie und Geomorphologie
- Viertes Kapitel
- Farbenlehre
- 1. Physikalische Farbenlehre
- 2. Chemische Farbenlehre
- 3. Physiologische Farbenlehre
- 4. Psychologische Farbenlehre
- 5. Die Ordnung der Farben
- 6. Bemerkungen zur reproduktionstechnischen Farbenlehre
- a) Drei- und Mehrfarbendruck
- b) Die Kartographie, ein Sonderfall der Reproduktionstechnik
- c) Weitere Bemerkungen über die Farben linearer und flächiger Elemente
- d) Druckfarben und Farbtafeln für topographische und geographische Karten
- e) Hinweise auf einige drucktechnische Dinge
- 7. Von der Harmonie der Farben und ihrer Kompositionen
- a) Zusammenstellungen von zwei oder mehr Farben
- b) Farbige Kompositionen
- 8. Von der Symbolik der Farben
- 9. Wahl der Farben nach physiologischen Gesichtspunkten
- Fünftes Kapitel
- Die Aufgabe und ihre Besonderheiten
- 1. Formulierung der Aufgabe
- 2. Ansicht der Geländeoberfläche in der Natur
- 3. Zuflucht zur Modellvorstellung
- 4. Verschiedenartigkeit der Modellflächen
- 5. Worauf beruht das räumlich-körperliche Sehen ?
- 6. Welche der räumlich oder körperlich wirkenden Effekte lassen sich kartenzeichnerisch verwenden ?
- 7. Das Ungenügen der unmittelbar wirkenden Bildelemente
- 8. Die Formen und ihre Dimensionen sollen geometrisch erfaßbar sein. Die Fiktion des Isohypsenmantels
- 9. Weitere fiktive, mittelbare Darstellungselemente und solche gemischten Charakters
- 10. Ein Experiment
- 11. Widerstreit und Zusammenspiel der beiden Abbildungstendenzen. Vormarsch des unmittelbar Anschaulichen
- 12. Vom Dualismus und von der Eigenart der kartographischen Darstellung
- 13. Vom Generalisieren und vom Zusammenspiel der graphischen Elemente
- 14. Vielerlei Umstände, vielerlei Formen. Die zu erstrebenden Ziele
- Sechstes Kapitel
- Höhen- und Tiefenpunkte
- 1. Begriffe
- 2. Kartographische Bedeutung kotierter Punkte
- 3. Maßeinheiten
- 4. Ausgangshöhen
- 5. Kennzeichnung der Kotengenauigkeit
- 6. Anzahl oder Dichte der kotierten Punkte
- 7. Auswahl der kotierten Punkte, Allgemeines
- 8. Einige Sonderfälle
- a) Paßübergänge
- b) Kirchturmspitzen und andere Hochpunkte
- c) Gletscher und Inlandeis
- d) Bäche und Flüsse
- e) Seen
- f) Meere
- 9. Graphische Fragen
- a) Bezeichnung der Punktlage
- b) Stellung der Kotenzahl
- c) Schriftart der Ziffern
- d) Minimale Schriftgrößen für Handkarten
- e) Differenzierung der Ziffernformen nach Lage oder Art der Punkte
- f) Abstufung der Schriftgrößen der Ziffern nach der Wichtigkeit der Punkte
- g) Die Farbe der Höhen- und Tiefenzahlen
- 10. Zusammenstellung der verschiedenen Höhen- und Tiefenangaben und der Art ihrer Bezeichnung
- 11. Die Kotierung spezieller Stromkarten für die Schiffahrt
- 12. Die Kotierung der ozeanischen Schiffahrtskarten, der sog. „Seekarten" oder „nautischen Karten"
- Siebentes Kapitel
- Gerippelinien
- 1. Allgemeines
- 2. Die Gerippelinie als Konstruktionshilfe der Geländedarstellung
- 3. Die Gerippelinie als ergänzendes Element der Geländedarstellung
- 4. Die Gerippelinie als selbständige Form der Geländedarstellung
- Achtes Kapitel
- Höhen- und Tiefenkurven
- A. Begriffe und Bezeichnungen
- B. Die Vertikalabstände der Höhenkurven
- 1. Einfache Äquidistanzsysteme
- 2. Kombinierte Äquidistanzsysteme
- 3. Zwischenkurven
- C. Generalisierung der Höhenkurven
- 1. Karten in den Maßstäben 1 : 5000 und größer
- 2. Karten in den Maßstäben 1 : 10000 bis 1 : 100000
- 3. Karten in den Maßstäben kleiner als 1 : 100000
- D. Beziehungen zwischen Aufnahmegenauigkeit und Generalisierung
- E. Beziehungen zwischen Kurvengliederung und Äquidistanz
- F. Zeichnerische Normen und Formen
- 1. Zählkurven
- 2. Zwischenkurven
- 3. Unsichere Höhenkurven
- 4. Zusätzliche Orientierungshilfen
- 5. Kurvenfarben
- 6. Strichstärken, Form der Strichelungen
- G. Anschaulichkeit der Höhenkurven und die unhaltbare Theorie von einer senkrechten Beleuchtung
- FL Variationen der Strichstärken und schattenplastische Höhenkurven
- 1. Steigerung der Strichstärken mit wachsender Höhe
- 2. Schattenplastische Strichverstärkungen ohne Flächenton
- 3. Lokale Strichverstärkungen
- 4. Differenzierung der Kurvenfarbe nach Licht- und Schattenhängen
- 5. Schattenplastische Höhenkurven mit Ebenenton
- 1. Anwendungsbereich der Höhen- und Tiefenkurven
- Neuntes Kapitel
- Schummer und Schatten
- A. Allgemeines
- B. Die Böschungsschummerung
- 1. Ihre Hell-Dunkel-Abstufungen und nochmals die Theorie der senkrechten Beleuchtung
- 2. Zeichnerische Erstellung
- C. Schräglichtschummerung oder Schräglichtschattierung
- 1. Licht und Schatten im Naturbild, am Modell und in der Karte
- 2. Geometrische und topographische Modelle
- 3. Das zeichnerische Gestalten
- 4. Der Schattenton in der Ebene
- 5. Schlagschatten
- 6. Aufhellungen durch reflektiertes Licht
- 7. Glanzerscheinungen
- 8. Die Luftperspektive
- 9. Die Lichtrichtung und ihre lokalen Anpassungen
- 10. Unhaltbare Lehren
- 11. Die Südbeleuchtung
- 12. Lehrmeister LEONARDO DA VINCI
- 13. Vier ungünstige Fälle. Auf den Eindruck kommt es an
- 14. Die Genauigkeit des Schattierens
- 15. Miniaturknitterungen der Geländeflächen
- 16. Herausheben der Relief-Großformen
- 17. Generalisierung schattenplastischer Reliefformen
- 18. Schattenfarbe und Schattenstärke
- 19. Schattentöne auf Gletschern und Firnfeldern
- D. Die kombinierte Schummerung
- 1. Der Einfluß der Schattenschraffe
- 2. Die zeichnerische Gestaltung
- 3. Formverfälschungen
- E. Zeichnungsmaterial und Zeichnungstechniken
- 1. Ansprüche an die Originale
- 2. Die zeichnerischen Unterlagen
- 3. Der Zeichnungsmaßstab
- 4. Die Zeichnungsfolien
- 5. Das Arbeiten mit Zeichnungsstiften, Aquarellpinsel und Aerographen
- 6. Flächenaufhellungen
- 7. Schummerungsoriginale auf graugetönten Folien
- 8. Einheitlicher Eindruck und gute Photographier- oder Kopierbarkeit des Schummerungsoriginals
- 9. Übertragungen auf die Druckplatten
- F. Anwendbarkeit, Vorzüge und Nachteile der Schummer- und Schattentöne
- 1. Die Böschungsschummerung
- 2. Die kombinierte Schummerung
- 3. Die Schräglichtschattierung
- G. Schräglichtschattierung des Meeresgrundes
- H. Die photomechanische Schummerung
- 1. Allgemeines
- 2. Die Modell-Erstellung
- 3. Die Modell-Photographie
- 4. Vorzüge und Mängel der photomechanischen Schummerung
- Zehntes Kapitel
- Schraffen und andere Schraffuren
- A. Einige Vorbemerkungen
- B. Die Böschungsschraffe
- 1. Die fünf Konstruktionsregeln
- 2. Einige Feinheiten der Gestaltung
- 3. Das Verdunkelungsgesetz der Böschungsschraffen
- 4. Verfälschungen des Formeindruckes durch die Böschungsschraffen
- C. Die Schattenschraffe
- 1. Die fünf Konstruktionsregeln
- 2. Verfälschungen des Reliefeindruckes durch die Schattenschraffen
- D. Allgemeine Gebirgsschräffen in Karten kleiner Maßstäbe
- E. Die Farben der Schraffen
- F. Zeichnerisch-technische Erstellung
- G. Mängel und Vorzüge, Kombinationen mit anderen Elementen
- 1. Die Mängel
- 2. Vorzüge und Anwendbarkeit
- 3. Kombinationen
- H. Horizontale Schraffuren
- I. Grundrisse paralleler, schräger Geländeschnitte
- K. Eckerts Punktmethode
- Elftes Kapitel
- Felsdarstellung
- A. Entwicklungen und Möglichkeiten
- B. Einige Felsformen geomorphologisch betrachtet
- 1. Entstehung der Großformen
- 2. Abhängigkeit der Verwitterungsformen vom geologischen Bau
- 3. Erosionsfurchen und Kessel
- 4. Einige weitere Merkmale
- 5. Der Schuttmantel
- 6. Chemische Felsverwitterung, Karstformen
- 7. Winderosion
- 8. Grundrißliche Gliederungen felsiger Flächen in kleinem Maßstab
- C. Formale Analyse
- 1. Abgrenzungslinien
- 2. Grabenlinien
- 3. Kammlinien und Umrandungslinien
- 4. Gerippelinienbild der Erosions-Großformen
- D. Graphische Gestaltung
- 1. Fels-Höhenkurven
- 2. Gerippelinien
- 3. Felsschattierung
- 4. Felsschummerung nach sog. „senkrechter Beleuchtung"
- 5. Felsschattenschraffen
- 6. Felsschraffen nach dem Prinzip „je steiler, desto dunkler"
- 7. Die Farbe der Felsschraffen
- 8. Felsdarstellung durch Flächentöne
- 9. Kombinationen mehrerer Elemente
- 10. Karrenfelder, Rundhöckerfluren und felsdurchsetzte Hänge, zeichnerische Sonderfälle
- 11. Felsdarstellung in Karten kleiner Maßstäbe
- 12. Wie übt man das kartographische Felszeichnen?
- E. Hilfsmittel und Technik des Felszeichnens
- 1. Schwarzzeichnung mit Feder und Tusche auf Zeichenpapier
- 2. Schwarzzeichnung auf transparente Folien
- 3. Gravur auf schichtbedeckte Kunststoff-Folien oder auf schichtbedeckte Glasplatten
- F. Beispiele aus älteren und jüngeren Karten
- G. Beurteilung und Anwendbarkeit der verschiedenen Darstellungsarten
- 1. Pläne 1 : 5000 und größer
- 2. Pläne 1 : 10000
- 3. Karten 1 : 20000 und 1 : 25000
- 4. Karten 1 : 50000
- 5. Karten 1 : 100000
- 6. Karten zwischen 1 : 100000 und etwa 1 : 500000
- 7. Karten kleiner als 1 : 500000
- Zwölftes Kapitel
- Kleinformsignaturen und andere zusätzliche Elemente .
- Allgemeines
- 1. Künstliche Böschungen
- 2. Lehm- und Kiesgruben, Steinbrüche
- 3. Erdschlipfe, erdige Abrisse, Runsen
- 4. Dolinen und andere Karstformen, Quelltrichter usw
- 5. Geröllhalden und Schutthaufen
- 6. Bergsturzhaufen
- 7. Junge Moränenwälle
- 8. Kleinformen von Eisoberflächen
- 9. Dünen
- 10. Vulkanische Kleinformen
- 11. BRANDSTÄTTERS Vorschläge
- Dreizehntes Kapitel
- Flächenfarben
- A. Sinn und Möglichkeiten farbiger Flächentönung in der Karte
- B. Naturähnliche und symbolische Farben
- C. Die Farbtöne für Landhöhenstufen
- Typus 1: Die kontrastierende Farbfolge
- Typus 2: Abstufung nach dem Prinzip „je höher, desto heller"
- Typus 3: Abstufung nach dem Prinzip „je höher, desto dunkler"
- Typus 4: Modifizierte Spektralfarbenskala, Normalform
- Typus 5: Modifizierte Spektralfarbenskala mit Überbrückung der Gelbstufe
- Typus 6: Modifizierte Spektralfarbenskala mit grauen oder violetten Stufen für große Höhen
- Typus 7: Die Farbskala von KARL PEUCKER
- Typus 8: Weiter variierte und verlängerte Spektralfarbenskala
- Typen 9 und 10: Farbabstufungen mit optimaler Höhenplastik
- Typus 11: Die Höhenfarbenabstufung der schattenplastischen Reliefkarten großer und mittlerer Maßstäbe
- Typus 12: Abgeschwächte, modifizierte Spektralfarbenskala
- Typus 13: Höhenplastische Farbfolge für Reliefkarten kleiner Maßstäbe
- Farbfolgen für spezielle hypsometrische Karten
- Weitere Möglichkeiten
- Depressionen
- D. Die Farbtöne für Tiefenstufen unter Wasser
- E. Die Höhen der Landstufen
- 1. Äquidistante Stufen
- 2. Zwei äquidistante Stufenfolgen kombiniert
- 3. Flächengleiche Stufen
- 4. Regellos wechselnde Stufenhöhen
- 5. Stufen mit arithmetischer Progression oder additive Stufen
- 6. Stufen mit geometrischer Progression
- F. Die Tiefen der Unterwasserstufen
- G. Zuordnung der Farbtöne zu den Stufen
- H. Weitere Bemerkungen zur Höhenstufendarstellung
- 1. Konturen der Farbflächen
- 2. Zeichnerischer Entwurf und Generalisierung
- 3. Anwendbarkeit
- 4. Die Legenden der Höhenstufen
- 5. Farbtabelle für die reproduktionstechnische Wiedergabe
- Vierzehntes Kapitel
- Das Zusammenspiel der Elemente
- A. Wesen und Wirkung des Zusammenspiels
- 1. Notwendigkeit und Pflege guten Zusammenspiels
- 2. Begriffliches, graphisches und technisches Zusammenspiel
- 3. Einheitliches Generalisieren und gute Normung
- 4. Sinnvolles Dominieren und weises Maßhalten. Gegenseitige Relation der Dinge
- 5. Überdeckung, Unterbrechung, Stellvertretung
- 6. Verdrängungen, Engpässe
- 7. Tonwert-Veränderungen infolge des Kombinierens
- 8. Geländedarstellung und Beschriftung
- B. Kombination verschiedener Elemente der Geländedarstellung
- a) Kombinationen für Karten großer und mittlerer Maßstäbe
- b) Kombinationen für Karten kleiner Maßstäbe
- Fünfzehntes Kapitel
- Bemerkungen zur Herstellungstechnik
- 1. Allgemeines
- 2. Einige Bemerkungen zur Zeichnungstechnik
- 3. Die zeichnerische Reihenfolge
- a) Das Anpassen der hypsometrischen Farbbegrenzungen an die Formen der Reliefschummerung
- b) Das Koordinieren des ersten, zweiten und eventuell dritten Schummers
- 4. Berücksichtigung von Passer-Ungenauigkeiten
- 5. Die Reihenfolge des Druckens
- Sechzehntes Kapitel
- Zukünftige Entwicklungen
- 1. Heutiger Stand der topographisch-kartographischen Erschließung der Erdoberfläche
- 2. Gesteigerter Bedarf an topographischen Karten aller Maßstäbe
- 3. Ist die heutige Kartenherstellungstechnik solchen Anforderungen gewachsen?
- 4. Automation in der Kartographie
- 5. Die moderne Luftbildkarte
- 6. Vom Wesen der kartographischen Darstellung
- 7. Von der Kunst in der Kartographie
- 8. Reform der Kartengraphik
- 9. Gute Karten sind nicht immer teurer als schlechte
- 10. Der Schlüssel zum Fortschritt
- Literatur
- Register