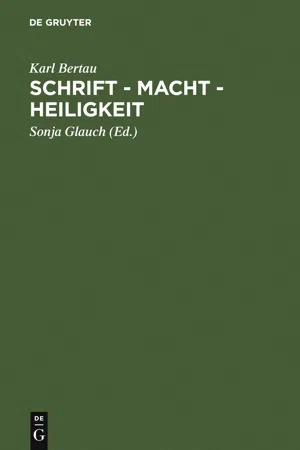
Schrift - Macht - Heiligkeit
In den Literaturen des jüdisch-christlich-muslimischen Mittelalters
- 711 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Schrift - Macht - Heiligkeit
In den Literaturen des jüdisch-christlich-muslimischen Mittelalters
Über dieses Buch
Der Gebrauch der Alphabetschrift verbindet die jüdische, christliche und muslimische Kultur des Mittelalters. Zwischen den Religionen dieser Kulturen gab es seit jeher intensive Wechselbeziehungen, u. a. durch Übersetzungen bedeutender (heiliger) Texte. Solche Kulturübertragungen bedeuteten immer auch Konflikte des Übersetzens, indem sie für Religion, Kultus und Rechtsprechung verbindliche Referenztexte einführten und dadurch andere Referenztexte ausschlossen. Als fundierende Zentraltexte verliehen sie der Macht und dem Recht von nun an Heiligkeit und Legitimität. Insofern ist nicht gleichgültig, was in der Kulturgeschichte geschrieben, übersetzt und verbreitet werden durfte, denn jede Verschriftlichung ist interessegeleitet und Ausdruck von Machtansprüchen. Schrift-, Literatur- und Kulturgeschichte lassen sich somit als Geschichte von Verbots- und Erlaubnisprozessen beschreiben.
Karl Bertau fragt nach den Gründen und Auswirkungen dieser Prozesse und untersucht die Formen kultureller Ausstrahlung im Kontext der Literatur-, Religions-, Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte. Dabei spannt sich ein Bogen von der Antike über das Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit und schließen sich Orient und Okzident ebenso wie die drei großen Buch-Religionen in ein weit ausgreifendes kulturhistorisches Panorama ein.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- 1. VORLESUNG: Alphabetschrift, Macht und Heiligkeit. Einleitung
- 1. Zusammenfassender Bericht
- 2. Alphabetschriftlichkeit und kulturelle Ausstrahlung
- 3. Simplifizieren und kritische Lektüre
- 4. Zusammenfassung
- Anmerkungen
- 2. VORLESUNG: Faktenbegriff und Verlaufsstruktur
- 1. Faktum Bibel
- 1.1 Hebräischer Tanach
- 1.2 Übersetzungen aus dem Hebräischen
- 1.3 Zwei Testamente
- 1.4 Priester-Schriftlichkeit
- 2. Strukturmuster und Geschichte
- 2.1 Das Strukturmuster der georgischen Literatur
- 2.2 Priester-Schrift oder Fremdes und Eigenes
- Anmerkungen
- 3. VORLESUNG: Jüdische und griechische Alphabetschrift-Literatur vor der Römer-Zeit
- 1. Jüdische Alphabetschrift-Literatur
- 1.1 Gottesname und Tabu-Begriff
- 1.2 Kommunikationsmuster
- 1.3 Literatur-Gattungen, Religion, Ethnie
- 1.4 Phönizier
- 2. Griechische Alphabetschrift-Literatur
- 2.1 Sakralität und Profanität
- 2.2 Recht, Lyrik, Philosophie und Mathematik
- 2.3 Öffentliche Kultur-Sakralität und private Lektüre
- 2.4 Zwischen Sokrates und Alexander
- 3. Zusammenfassung
- Anmerkungen
- 4. VORLESUNG: Römische Alphabetschrift-Literatur und hellenistisches Mittelmeer
- 1. Römische Alphabetschrift-Literatur
- 1.1 Rom – Troja – Karthago
- 1.2 Etrusker und Kolonial-Griechen
- 1.3 Hellenismus: Alexander und Braudel
- 1.4 Literarische Latinität zur Zeit der Punier-Kriege
- 1.5 Anti-Hellenismus bei Römern und Juden
- 2. Der zweite Schub der griechisch-hellenistischen Akkulturation
- 2.1 Lucilius, Caesar, Cicero, Varro, Lukrez
- 2.2 Hellenismus und Anti-Hellenismus in der jüdischen Welt
- 2.3 Pharisäer, Schriftgelehrte und die Frommen von Qumran
- 3. Zusammenfassung
- Anmerkungen
- 5. VORLESUNG: Fülle der Zeit und Fülle der Vergottungen
- 1. Vergottungen
- 2. Römischer Bereich
- 2.1 Caesar und Augustus
- 2.2 Thurinus, Octavianus, Augustus
- 2.3 Augustus-Kohorte
- 3. Jüdischer Bereich
- 3.1 Philon
- 3.2 Psalm 2
- 3.3 Jüdischer Krieg und erste Christen
- Anmerkungen
- 6. VORLESUNG: Mediterrane Literaturlandschaft mit Gewichtsverlagerung in den Osten
- 1. Literatur für die Römer, auf Latein und auf griechisch
- 2. Jüdische, christliche und häretische Sakral-Schriften
- 3. Trachten nach der Welt und Trachten nach hohen Dingen
- 3.1 Apuleius aus Karthago
- 3.2 Philosophie und Religion aus Ägypten und Syrien
- 3.3 Götterdämmerung im Imperium
- 4. Zusammenfassung
- Anmerkungen
- 7. VORLESUNG: Dogmenbildung und Alphabetschriftlichkeit
- 1. Griechische Dogmen: Zerteilung der Christenheit
- 2. Mission und Regionalschriftlichkeit im Orient – und in Irland
- 2.1 Mission aus der ägyptischen Kirche
- 2.2 Mission aus der syrischen Kirche
- Anmerkungen
- 8. VORLESUNG: Römischer Westen unter den Schwertern der Barbaren im Schatten von Byzanz
- 1. Gebildete Christen
- 2. Barbaren-Zeit
- 3. Literatur im Schatten von Byzanz 476–610
- 4. Irland und die Latein-Kultur
- Anmerkungen
- 9. VORLESUNG: Die Macht des dritten Sakraltextes
- 1. Karten
- 1.1 Geomorphologie und Geschichte
- 1.2 Von 900–600: EL und JHWH, der namenlose Wüstengott
- 1.3 Von 600–300: Unschriftliche Kult-Sakralität und schriftliche Kultur-Sakralität bei den Griechen
- 1.4 Von 300–0: Schriftlich elaborierte Kultur- und Kult-Sakralität bei den Römern
- 1.5 Von 0–300: Alphabetschriftlichkeiten und Vergottungen im römischen Imperium
- 1.6 Von 300–600: Imperiale Gottes-Schriftlichkeit im zerfallenden Imperium
- 2. Letzte Mahnung des einen Gottes in der klarsten Sprache und der schönsten Schrift
- 3. Der Islam und die beiden andern Buchreligionen
- 4. Weltreich und Schisma
- Anmerkungen
- 10. VORLESUNG: Neue Kultur-Regionen, maritim und kontinental
- 1. Griechisch-christliche Schriftlichkeit und der Vordere Orient
- 1.1 Wahres Kreuz, widerrufenes Dogma und Bilderverbot
- 1.2 Literatur unter muslimischer Herrschaft
- 2. Römisch-christliche Schriftlichkeit im insularen Norden Europas
- 2.1 Irisches Christentum und Missionierung Englands
- 2.2 Benedict Biscop und Beda Venerabilis
- 2.3 Literatur auf altenglisch
- 3. Römisch-christliche Schriftlichkeit bei den Festlandsgermanen
- 3.1 Heidnische Geblütsheiligkeit und Kirchensegen
- 3.2 Glossen, Barbaren-Rechte, mündliche Kurzepik?
- 4. Vorblick: 600–900: Neue Weltreiche der Buchreligionen
- Anmerkungen
- II. VORLESUNG: Überregionale Macht-Kulturen des zweiten und des dritten Sakraltextes 732–810
- 1. Macht und Kultur in der weströmischen Christenheit
- 1.1 Karl Martell und Pippin
- 1.2 Christianisierung der peregrinatio-Kohorte
- 1.3 Die cohortes des Aachener Hofkreises
- 2. Der fränkische Usurpator und der legitime Kaiser der Römer
- Anmerkungen
- 12. VORLESUNG: Regionalisierung in den Kulturen des maritimen Rahmens. 732–910
- 1. Kalifenhöfe in Damaskus, Bagdad, Córdoba
- 1.1 Schwerpunktverlagerung von Damaskus nach Bagdad
- 1.2 Literatur im Irak, aus dem iranischen Osten und im Judentum
- 1.3 Ägypten, Nordafrika, Andalusien
- 2. Raubüberfall und Kultur-Schriftlichkeit
- 2.1 Raubüberfall als Wirtschaftsform und Steuerwesen
- 2.2 Heidnischer Fernhandel ohne Schriftlichkeit: Waräger und Wikinger
- 2.3 Römisch-christliche Kultur-Schriftlichkeit im maritimen Norden
- Anmerkungen
- 13. VORLESUNG: Regionalisierte Macht und Kultur-Schriftlichkeiten im kontinentalen Europa
- 1. Fränkisches Römerreich
- 1.1 Aachener Hof nach Karl
- 1.2 Nitharts Zeugnis
- 1.3 Westfränkischer Hof
- 1.4 Zwischen West- und Ostreich
- 1.5 Regionalkultur im fränkischen Ostreich
- 1.6 Epilog
- 2. Korruption in Rom und Latein in Italien
- 3. Griechisch-christlich: Makedonische Renaissance
- 3.1 Orthodoxie
- 3.2 Das Drama der slavischen Kultur-Schriftlichkeit und die kontinental-maritime Kulturgrenze
- Anmerkungen
- 14. VORLESUNG: Zusammenfassungen und rückblickendes Bedenken
- 1. Nachlese zu 600 bis 900
- Verbales Grundschema der Karten
- 2. Geraffte Zeitverläufe 900 v. bis 900 n. Chr
- 2.1 Psalmist und Einstein
- 2.2 Neue Verkürzung
- 3. Raumstrukturen und Geschichte
- Anmerkungen
- 15. VORLESUNG: Historisch-funktional und inhaltlich-material definierbare Begriffe
- 1. Dilemma zwischen Wörtern und Begriffen im historischen Wörterbuch
- 2. Ordnungsbegriffe der Seins-Lehre und der materialen Wert-Ethik
- 3. Unvorhandenes Sein und ausgesagte Lebendigkeit
- Anmerkungen
- 16. VORLESUNG: Anknüpfung und Vorblick
- 1. Anknüpfung: Blickveränderungen
- 2. Vorblick 900 bis 1202
- 2.1 Kein Datum historischer Epoche: 4660, 900, 286
- 2.2 Gang der Geschichte
- 3. Kalifat und religiöse Autorität, Sacerdos und Potens
- Anmerkungen
- 17. VORLESUNG: 900–1000 (I)
- Maritimer Rahmen für semitische und lateinische Alphabetschriften
- 1. Nordmeere
- 2. Literaturschriftlichkeit in der muslimischen Welt
- 2.1 Zublick vom jungen Avicenna aus
- 2.2 Vielfalt islamischer Frömmigkeit
- 2.3 Avicenna und Firdausi
- 2.4 Fruchtbare Mißverständnisse Avicennas
- 3. Maritime Grenzüberschreitungen: Mittelmeer
- Anmerkungen
- 18. VORLESUNG: 900–1000 (II)
- Legitimitätsformen von Macht und Heiligkeit in Kontinentaleuropa
- 1. Situation
- 2. Jahrhundertanfang
- 2.1 Frankreich – Burgund – Deutschland
- 2.2 Byzanz
- 2.3 Weströmisches Papsttum
- 3. Jahrhundertende
- 3.1 Caesaren-Sakralität
- 3.2 Das Byzanz der Generäle und die Sachsenkaiser
- 3.3 West-Frankenreich, Gerbert und die Ottonen
- 3.4 Digenes-Epos, Religionsgrenzen, Basileios II
- Anmerkungen
- 19. VORLESUNG: 1000–1100 (I)
- Das frühe Jahrhundert: Kontinentaler Kern und maritime Ränder
- 1. Anknüpfung an den imperialen Bereich
- 2. Maritimer Rahmen
- 3. Nochmals Literatur im kontinentalen Imperium
- Anmerkungen
- 20. VORLESUNG: 1000–1100 (II): Jahrhundertmitte und kontinentaler Kern
- 1. Fragliche Heiligkeit und fragliche Schriftlichkeit im Kontinental-Christentum vor 1075
- 2. Türkenheere, Dichter und Philosophen
- 3. Ruhe vor dem Sturm
- Anmerkungen
- 21. VORLESUNG: 1000–1100 (III): Das ausgehende Jahrhundert
- 1. Maritimer Rand: Andalusien und Okzitanien
- 2. Nördlicher maritimer Kulturbereich
- 3. Eklat im Kontinentalkern
- 4. Maritimes Vorfeld und Hilferuf aus Byzanz?
- Anmerkungen
- 22. VORLESUNG: 1100–1200 (I): Menschenwege in Gottes Heiliges Land
- 1. Berichte von den großen Taten Gottes durch die Ritter
- 1.1 Normannisch-anglonormannischer Horizont
- 1.2 Gesta Dei per Francos
- 2. Gottestaten durch andere Leute
- 3. Reflexe von Taten der Menschen
- Anmerkungen
- 23. VORLESUNG: 1100–1200 (II)
- Geschriebene Welt nach dem ersten Kreuzzug
- 1. Die Neugier des Petrus Venerabilis
- 2. Orte der Frühscholastik
- 3. Sankt Bernhard von Clairvaux: Veränderung der geistigen und politischen Landschaften Frankreichs
- 3.1 Mönche und Mystiker
- 3.2 Aufstieg von Paris und Königtum
- 3.3 Bernhard, Abälard und Petrus Venerabilis
- 4. Imperator ergo teutonicus
- Anmerkungen
- 24. VORLESUNG: 1100–1200 (III): Literaturschriftlichkeit des römischen Kreuzzugschristentums 1137 bis 1152
- 1. Imperator ergo teutonicus
- 2. Vorort Regensburg
- 3. Literatur um Paris, am anglonormannischen und am französischen Hof nach der Heirat von 1137
- 4. Poésie sur scène IV, Cligès-Theater in Regensburg
- 5. Desaster des zweiten Kreuzzugs
- 6. Epilog
- Anmerkungen
- 25. VORLESUNG: 1100–1200 (IV). Angevinische und französische Literaturschriftlichkeit 1152 bis 1164
- 1. Der angevinische Hof
- 1.1 Erzähldichtung, zumeist in Acht-Silblern
- 1.2 Poésie sur scène V
- 2. Chansons de geste
- 3. Oppositionen von Schrift und Macht-Sakralitäten?
- Anmerkungen
- 26. VORLESUNG: 1100–1200 (V): Geschriebene Räume 1164–1184
- 1. Körperräume und Innenräume: Der Hof der Champagne
- 2. Körperräume: Archipoeta, Antichristspiel, Petachja, Benjamin
- 3. Alexander-Räume
- 4. Schrift oder Straße: Kalligraphische Räume
- 5. Notwendige Orte: Robinson und Maimonides
- 6. Verwandlung notwendiger Orte: Ortsfeste Chronik-Räume
- Anmerkungen
- 27. VORLESUNG: 1100–1200 (VI): Zwischen Mainz 1184 und Palermo 1198
- 1. Schauseite der vulgärsprachlichen Kultur-Sakralität
- 2. Rückseite der vulgärsprachlichen Kultur-Sakralität
- 3. Dritter Kreuzzug und Sizilien
- Anmerkungen
- 28. VORLESUNG: 1100–1200 (VII): Irgend etwas stimmt nicht in der okzidentalen Schriftkultur
- 1. Unsicherheiten der Kult- und Kultur-Sakralität
- 2. Ritterliche Erlösungssakralität
- 3. Einheitsmittelhochdeutsch und regionale Sonderwege
- 4. Epiphänomene
- Anmerkungen
- 29. VORLESUNG: 10. bis 12. Jahrhundert und Aufbruch ins 13. Jahrhundert
- 1. Zusammenfassender Rückblick 900–1200
- 2. Akzente
- 3. Aufbruch zum vierten Kreuzzug
- Anmerkungen
- 30. VORLESUNG: 1200–1300 (I): Schuldentilgung statt Sündenvergebung
- 1. Erster Kapitalismus
- 2. Lockruf: Zadar, Byzanz
- 3. Reflexe
- 3.1 Deutsche in Byzanz und in Akkon
- 3.2 Griechisch-byzantinische Literatur 1184 bis 1208
- 3.3 Frankophone Literaten und ein spanischer Chorherr
- Anmerkungen
- 31. VORLESUNG: 1200–1300 (II): Ketzerkriegs-Mission und neue Volgare-Schriftlichkeiten 1198–1209/1216
- 1. Pontifikat voller Unruhen
- 1.1 Auspizien des neuen Pontifikats
- 1.2 Situation voller Szenenwechsel
- 1.3 Literaturschriftlichkeit nördlich der Alpen
- 2. Innere Kriege und innere Reformen im westlichen Mittelmeer
- 2.1 Ketzermission durch Krieg
- 2.2 Laterankonzil und Bettelorden
- 3. Literarische Reflexe der mediterranen Ereignisse
- Anmerkungen
- 32. VORLESUNG: 1200–1300 (III) Konjunktur-Rhythmen in der Romchristenheit
- 1. Rückblickendes Resümee
- 2. Zahlenschrift, Bettelorden, Geldprobleme und Heiligkeit
- 3. Ordensprovinzen
- 4. Sammeln und Summen des Wissens
- Anmerkungen
- 33. VORLESUNG: 1200–1300 (IV). Literatur mit dem Rücken zur Stadt: 1209/1216–1230
- 1. Nordmeere
- 2. Vergebliche Krönungen und Kreuzzüge 1209/1216–1230
- 3. Frankreich und das Mittelmeer
- Anmerkungen
- 34. VORLESUNG: 1200–1300 (IV): Erste Konjunkturerträge 1230–1245
- 1. Der Schatten Dschingis-Chans
- 2. Gotischer Aristokratismus rund um das Westmittelmeer
- 3. Ordensschulen und Universität
- 4. Fürsten-Heiligkeit und Vielschreiberei im Regnum
- 5. In den Mendikantenprovinzen des Nordens und Ostens und eine Botschaft aus Ungarn
- 6. Stiftungsvermögen christlich und muslimisch
- Anmerkungen
- 35. VORLESUNG: 1200–1300 (VI). Temporale und sakrale Machtfelder zwischen zwei Konzilen (1245–1274) Botschaften vom Kaiser von China
- 1. Vorstellungsmodell: Ein Kern in der Kugel in der Kugel
- 1.1 Der Kern
- 1.2 Die mediterrane Schale des Kerns
- 1.3 Die äußerste Schale
- 2. Der Geldwurm im Innern der Romchristenheit
- 2.1 Akademischer Armutsstreit, unakademische Schikanen und große Theologen
- 2.2 Teutoniaprovinz
- 2.3 Anzeichen für Geld im Lande
- 2.4 Karl von Anjou, der Reiche
- 3. Lernerfolge?
- Anmerkungen
- 36. VORLESUNG: 1200–1300 (VII): Jahrhundertende
- 1. Anjou und Aragon
- 2. Interferenzen von Ritterkultur und Ostexpansion
- 3. Neue Literaturen in Italien
- 3.1 Frankoitalienisch und Novellino
- 3.2 Dolce stil novo
- 4. Machtergreifung des heiligen Geblüts
- 5. China, Islam und Abendland-Ideologie
- 5.1 Heimkehr und Bericht von der Welt
- 5.2 Christentum, Islam und China
- 5.3 Aggressivität des Christentums als Problem
- Anmerkungen
- 37. VORLESUNG: 1300–1400 (I): Romchristliche Herrschaftslegitimitäten
- 1. Frankreich hält die Hand auf der Kirche
- 2. Das Geld hält Fürsten, Kirche und Hochfinanz in der Hand
- 3. Das Reich, Böhmen, Italien (1308–1347)
- 4. Spanien: Cifar, Amadis, Juan Ruiz
- Anmerkungen
- 38. Vorlesung: 1300–1400 (II). Vom Schwarzen Meer kommt der Schwarze Tod
- 1. Avignon und Italien zwischen Rom-Idee und Pest
- 2. Die Pest
- 2.1 Befremdliche Schriftlichkeiten im Umfeld des Schwarzen Meeres
- 2.2 Die Pest in der Westchristenheit
- 3. Frankreich, zwei heilige Frauen und das Große Schisma
- 4. Kaufmannsschriftlichkeit
- Anmerkungen
- 39. VORLESUNG: 1300–1400 (III): Schismatische Alphabetschriftlichkeiten
- 1. Umfeld Avignon-Frankreichs
- 2. Von England über Böhmen und Süddeutschland nach Holland
- 3. Hansischer Norden und östliche Heidengrenze
- 4. Arabische Alphabetschriftlichkeit
- 5. Rückblick
- Anmerkungen
- 40. VORLESUNG: 1400–1500 (I): Allgemeine Unübersichtlichkeit und Sakralitäten-Inflation des 15. Jahrhunderts
- 1. Einführung in die allgemeine Unübersichtlichkeit
- 2. Orientierungsdaten
- 3. Der Wurm des Humanismus in der Paradiesfrucht der Kirche
- 3.1 Überregionalsprachliches Latein mehrfacher Observanz
- 3.2 Überregionalsprachliches Griechisch mehrfacher Observanz
- 3.3 Cusanus, Dionysius der Kartäuser und Thomas a Kempis
- Anmerkungen
- 41. VORLESUNG: 1400–1500 (II): Geistliches, volkssprachlich handschriftlich
- 1. Orientierungsdaten
- 2. Handschriftliches geistlichen Inhalts in Vulgärsprachen der Romchristenheit
- 3. Geistliche Inhalte, hand- und frühdruck-schriftlich, jenseits der lateinischen Schriftgrenzen
- Anmerkungen
- 42. VORLESUNG: 1400–1500 (III). Kultur-Sakralität I: Weltliches, volkssprachlich handschriftlich
- 1. Adelshandschriftlichkeit
- 1.1 Am Rande des Konstanzer Konzils: Wolkenstein
- 1.2 Die Länder des Hundertjährigen Krieges
- 1.3 Die Länder des Habsburger-Horizonts
- 1.4 Höfisch-Handschriftliches im Horizont der Glaubensfeinde
- 2. Berufsständische Handschriftlichkeit, weltlich in der Vulgärsprache
- 2.1 Mirakel- und Mysterienspiele
- 2.2 Hansischer Horizont und süddeutsche Geselligkeitskultur
- 2.3 Volkspädagogische Humanisten
- 3. Der Outcast: François Villon
- Nachschrift: Bordunstimme
- Anmerkungen
- 43. VORLESUNG: 1400–1500 (IV) Kultur-Sakralität II: Buchdruckzonen, Bild und Buchstabe
- 1. Buchdruckzonen in Randlage
- 1.1 Iberischer Kreis
- 1.2 Südosten
- 2. Nordalpine Buchdruckzonen
- 2.1 Schwäbisch-fränkische Zone
- 2.2 Buchdruckzone Niederrhein
- 2.3 Frankreich
- 2.4 Buchdruckzone Oberrhein
- 3. Südalpine Buchdruckzonen
- 3.1 Simon von Trient
- 3.2 Oberitalien und Venedig
- 3.3 Rätselhafte Alphabetschriften und Analphabetismus
- Anmerkungen
- 44. VORLESUNG: Kultur-Sakralität III: Schlußopposition von Druck und Handschriftlichkeit
- 1. Zwischen Druck und Privatschriftlichkeit
- 1.1 Mittelitalien: Frühdrucke, Volgare-Poesie und Autodafé
- 1.2 Radikale Privatschriftlichkeit bei Leonardo
- 2. Heiligkeit und unlitterale Gewaltschrift
- 2.1 Macht und Heiligkeit
- 2.2 Religionsschriftlichkeiten als Machtschriftlichkeiten
- 3. Unsichere Schriftlichkeit und unlitterale Gewaltschrift der Fakten
- Anmerkungen
- Epilog: Grenzen
- 1. Ähnlich wie Luftbild-Archäologie
- 2. Akzente der Darstellung
- Anmerkungen
- Abbildungsverzeichnis
- Vorlesungsdaten
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Namenregister