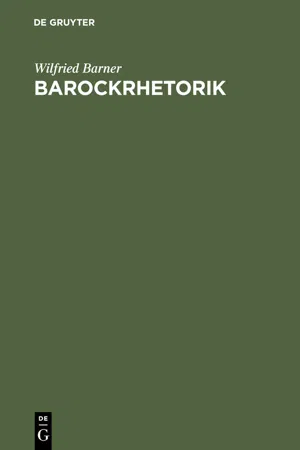
- 555 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Große Teile der deutschen Barockliteratur sind schon im 19. Jahrhundert und dann seit der Entstehung des literarischen Barockbegriffs immer wieder als "rhetorisch" bezeichnet worden, bisweilen auch mit abwertendem Beiton. Die Erforschung der antik-humanistischen Theoriegeschichte von Poetik und Rhetorik seit den 1960er Jahren hat dann zu Präzisierungen geführt. Die Untersuchungen der »Barockrhetorik« rekonstruieren die sozial- und bildungsgeschichtlichen Grundlagen im europäischen Kontext. Ein einleitendes Kapitel zu Nietzsches "Barock"-Begriff führt in die Begriffs- und Wertungsgeschichte zurück. Ein längeres Exkurs zum bekannten Bild des theatrum mundi demonstriert die Verankerung des Rhetorischen im Welt- und Menschenbild des 17. Jahrhunderts. Die institutionengeschichtlichen Untersuchungen erstrecken sich vor allem auf vier Bereiche: protestantische Gelehrtenschule, Jesuitenkolleg, Adelserziehung, Universitätsunterricht. Besondere Aufmerksamkeit gilt hierbei den vielfältigen Formen des Theaterspielens. Das System der literaturbezogenen Institutionen des 17. Jahrhunderts bildet zusammen mit der Geschichte der "Muster" (seit der Antike) und der Theorien einen neuen Bezugsrahmen zur Interpretation der Barocktexte selbst.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- ERSTER TEIL. RHETORIK UND LITERARISCHE BAROCKFORSCHUNG
- 1. Nietzsche über ›Barockstil‹ und ›Rhetorik‹
- a. Ein unzeitgemäßer Entwurf
- b. Typologische und epochale Aspekte
- c. Die Umwertung des ›Rhetorischen‹
- d. Der Versuch einer Synthese
- 2. Die Wiederentdeckung der deutschen Barockliteratur und das Rhetorische
- a. Alte Vorurteile
- b. Folgen der Barockbegeisterung
- c. Rhetorik als Zentralkategorie
- 3. ›Barock‹ und ›Manierismus‹ sub specie rhetoricae
- a. Der kritische Ansatz
- b. Die Manierismuswelle und ihre Mißverständnisse
- c. Konsequenzen für die Barockforschung
- 4. Barockrhetorik und rhetorische Tradition
- a. Die vernachlässigte Theorie
- b. Komparatistische Impulse
- c. Theorie und literarische Praxis
- d. Die Tradition der exempla
- e. Ein Beispiel: das Geleitgedicht
- 5. ›Rhetorik‹ und ›Barockliteratur‹: die Notwendigkeit einer Neuorientierung
- a. Aporien inadäquater Rhetorikbegriffe
- b. Die Kategorie des Intentionalen
- c. Literarische Zweckformen
- d. Aufgaben
- EXKURS. ›THEATRUM MUNDI‹ – DER MENSCH ALS SCHAUSPIELER
- a. Was ist die Welt?
- b. Rhetorik als theatralische Verhaltensweise
- c. Stoische und satirische Tradition
- d. Theatralik und Rollenspiel im Weltverständnis des 17. Jahrhunderts
- e. Christliche, stoizistische und satirisch-pikareske Perspektiven des barocken Welttheaters
- f. Der Hof als vollkommenes Abbild des theatrum mundi
- g. Gracián
- ZWEITER TEIL. SOZIALE ASPEKTE DER BAROCKRHETORIK
- 1. Die ›politische‹ Bewegung
- a. Ursprung und Ausweitung des Begriffs
- b. Die prudentistische Moral
- c. Die Gracián-Rezeption in Deutschland und die ›Politisierung‹ des Welttheaters
- 2. Die Rhetoriken des 17. Jahrhunderts und das ›gemeine Leben‹
- a. Äußeres aptum und soziale Isolation
- b. Die kanzlistische Tradition
- c. Muttersprachliche Rhetoriktheorie
- d. Neubeginn im Zeichen des ›Politischem‹
- e. Der Weisesche Impuls und seine Folgen
- 3. Der Werdegang eines großen Barockrhetors: Christian Weise
- a. Weise und die Geschichte der Rhetorik
- b. Schüler, Student, Magister
- c. Höfisch-politische Erfahrungen
- d. Die Professur an der Ritterakademie
- e. Rückkehr in die bürgerlich-gelehrte Sphäre
- f. Das Problem der sozialen und epochalen Zuordnung
- 4. Die gelehrte Grundlage der deutschen Barockliteratur
- a. Traditionelle Deutungen
- b. Literarische Kunstübung und ständische Basis
- c. Das gelehrte Wissen
- d. Die Lehrbarkeit der Sprachkunst
- DRITTER TEIL. DIE VERANKERUNG DER RHETORIK IM BILDUNGSWESEN DES 17. JAHRHUNDERTS
- 1. Grundzüge und geschichtliche Problematik des Rhetorikunterrichts im 17. Jahrhundert
- a. Prämissen
- b. Die Rhetorik zwischen Tradition und Opposition
- c. Traditionalismus als literarisches Problem (Latinität, Klassizismus)
- 2. Rhetorik an den protestantischen Gelehrtenschulen
- a. Rhetorik und Bildungsziel
- b. Das Rhetoriklehrbuch von Gerhard Johannes Vossius
- c. Latinität und Muttersprache
- d. Die Stellung der Rhetorik innerhalb des Lehrplans
- e. Übungstechniken des rhetorischen Unterrichts
- f. Die rhetorischen Schulactus
- g. Das Schultheater als Teil des eloquentia-Betriebs
- 3. Rhetorik an den Jesuitengymnasien
- a. Ausbreitung und Macht der Jesuitenpädagogik
- b. Humanistische Basis
- Der Jesuit als ›gelernter‹ Humanist 327 – Die Entstehung der Lehrpläne; Sturm und die Jesuitenpädagogik
- c. Der Aufbau des Rhetorikstudiums
- d. Mündlichkeit und eloquentia latina
- e. Das Jesuitentheater
- f. Funktionen der Jesuitenrhetorik
- 4. Rhetorik in der Adelserziehung
- a. Jesuiten und Protestanten
- b. Castiglione und das höfische eloquentia-Ideal
- c. Hofmeister
- d. Ritterakademien
- e. Kontakte des Adels zur bürgerlichen Gelehrtenbildung
- 5. Rhetorik an den Universitäten
- a. Ständische und konfessionelle Differenzierungen
- b. Das Disputationswesen
- c. Rhetorik als Studienfach
- d. Zur Geschichte der Rhetorik-Lehrstühle, am Beispiel Tübingens
- e. Das Bild eines Rhetorik-Professors im 17. Jahrhundert: Christoph Kaldenbach
- Schluß
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Personenregister