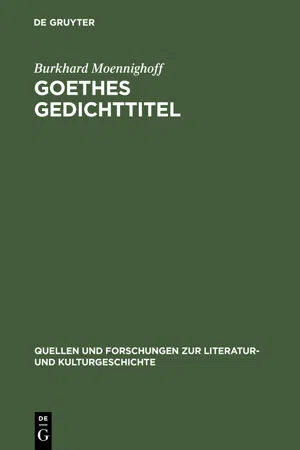
- 213 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Goethes Gedichttitel
Über dieses Buch
Die Fallstudie ist ein Beitrag zu der noch jungen Paratextforschung und erprobt ihre Fruchtbarkeit, indem sie Goethes lyrisches Œuvre im Hinblick auf seine Titelgebung neu erschließt: mit dem Ergebnis, daß Goethe die poetischen Möglichkeiten, die die schriftliche Realisation seiner Lyrik bietet, mannigfaltig nutzt, dabei aber den mündlichen Charakter vieler seiner Gedichte nicht verdeckt. Dieser Sachverhalt wird aus literatur-, kultur- und mentalitätsgeschichtlicher Sicht erklärt.
Burkhard Moennighoff sichtet Goethes Gedichttitel nach Maßgabe von Voraussetzungen, die in einem gemischt deduktiv-induktiven Vorgehen gewonnen werden. Die Beschreibung von Goethes Titelkunst orientiert sich am Leitfaden der Entwicklungsgeschichte seiner Lyrik (unter Berücksichtigung der Goethischen Gedichtsammlungen), beginnend mit den Gedichten des Knaben und endend mit den Alterslyrica. Es wird dabei gezeigt, daß sich die geschriebene Lyrik Goethes sowohl an ein lesendes als auch an ein hörendes Publikum richtet.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. BEGRIFF DES TITELS
- 1. Der Titel als Textsorte
- 1.1. Die benennende Dimension
- 1.2. Die prädizierende Dimension
- 1.3. Die räumliche Dimension
- 2. Überprüfung der Textsortenbestimmung
- 2.1. Die Geschlossenheit des Titelbegriffs
- 2.2. Einige Konsequenzen
- 2.3. Der Titel im Gattungssystem
- 3. Der mediale Status des Titels
- 4. Zur Titeltypologie
- 4.1. Thematische Titel
- 4.2. Rhematische Titel
- III. DER JUNGE GOETHE
- 1. Titel und Titellosigkeit: Ein Fallbeispiel
- 2. Erste Versuche
- 3. Stammbuchgedichte
- 4. Briefgedichte
- 5. Gedichte des Rokoko und der Anakreontik
- 5.1. Das Buch „Annette“
- 5.2. Oden an Behrisch
- 5.3. Neue Lieder
- 6. Gedichte der Genieperiode
- 6.1. Volksballaden aus dem Elsaß
- 6.2. Gedichte zwischen 1771 und 1775
- 7. Erste Weimarer Gedichtsammlung
- 8. Bilanz
- IV. WEIMAR/ITALIEN
- 1. Vermischte Gedichte (1789)
- 2. Elegien
- 3. Epigramme
- 4. Xenien
- 5. Elegien/Idyllen
- 6. Balladen
- 7. Bilanz
- V. WERKE (1815)
- 1. Ordnung und Unordnung
- 2. Lieder/Gesellige Lieder
- 3. Aus Wilhelm Meister
- 4. Sonette
- 5. Bilanz
- VI. WEST-ÖSTLICHER DIVAN
- 1. Die Erstausgabe von 1819
- 1.1. Entstehungsgeschichte und Titelgeschichte
- 1.2. Die Titelpraxis in der Erstausgabe
- 2. Zur Titelpraxis in der Ausgabe von 1827
- 3. Bilanz
- VII. DAS SPÄTWERK
- 1. Werke (1827/1828)
- 2. Letzte Gedichte
- 3. Bilanz
- VIII. GOETHES TITELPRAXIS, SCHEMATISIERT
- IX. ANHANG
- Literaturverzeichnis
- Register