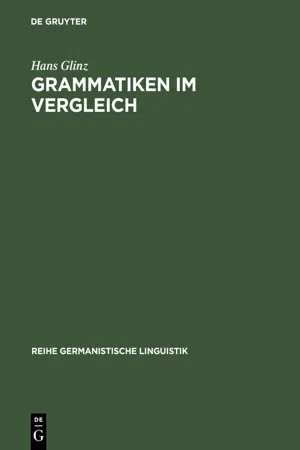
eBook - PDF
Grammatiken im Vergleich
Deutsch - Französisch - Englisch - Latein. Formen - Bedeutungen - Verstehen
- 983 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - PDF
Grammatiken im Vergleich
Deutsch - Französisch - Englisch - Latein. Formen - Bedeutungen - Verstehen
Über dieses Buch
"Grammatiken im Vergleich" ist in mehrfacher Hinsicht beeindruckend und einzigartig. Es ist die einzige Grammatik, die einen systematischen Vergleich von vier Schulsprachen vornimmt. Das Werk geht über die meisten einzelsprachlichen und auch kontrastiv angelegten Grammatiken hinaus, indem formale Strukturen, Bedeutungen und auch Verstehensprozesse in die Beschreibung einbezogen werden. Ein besonderes Verdienst liegt darin, dass es nicht bei der linguistischen Analyse und Kodifizierung "stehenbleibt", sondern einen weiteren Schritt zur unterrichtlichen Anwendung tut.« Praxis des neusprachlichen Unterrichts (1998)
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Grammatiken im Vergleich von Hans Glinz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Deutsch. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Persönliches Vorwort, Dank an viele Helfer
- Die Grundlinien der Darstellung - ganz knapp
- Einleitung, Lesehinweise, Sinn von Grammatiken, methodische Grundlagen
- 1 Die Wortarten in den vier Sprachen
- 1. I Verben - Nomen - Adjektive, samt Adjektiv-Adverbien (1.01-1.10)
- l. II Pronomen - déterminants et pronoms - determiners and pronouns (1.11-1.23)
- l. III Partikeln: Adverbien - Präpositionen - Konjunktionen - Interjektionen (1.24—1.31)
- 1. IV Übergangszonen; was nützt die Unterscheidung der Wortarten? (1.32-1.34)
- 2 Sätze und Propositionen, Satzlänge und Stil, Satzzeichen
- 2. I Aufbau von Texten aus Propositionen, Einteilung in Sätze; Auswirkungen beim Lesen und Schreiben (2.01-2.07)
- 2. II Satzzeichen innerhalb von Sätzen; Kommaregeln im Deutschen (2.08-2.16)
- 2. III Kommaregeln im Französischen und im Englischen (2.17-2.18)
- 2. IV Sätze, Propositionen und Satzzeichen im Lateinischen (2.19-2.21)
- 3 Verb-Teile - Satzglieder - Subjekte - ihre verschiedenen Stellungen
- 3. I Verben und Satzglieder in den Propositionen (clauses) (3.01-3.07)
- 3. II Verbale Wörtketten, als fertige Propositionen und in Wörterbüchern (3.08-3.11)
- 3. III Die Subjekte als besondere Satzglieder (3.12-3.24)
- 3. IV Die Stellungen der Verb-Teile und der Satzglieder im Deutschen (3.25-3.30)
- 3. V Verb-Teile, Subjekte und weitere Satzglieder im Französischen (3.31-3.36)
- 3. VI Subjekte, Verb-Teile und weitere Satzglieder im Englischen (3.37-3.40)
- 3. VII Verben, Subjekte und weitere Satzglieder im Lateinischen (3.41-3.42)
- 4 Grammatische Formen der Nomen, Pronomen und Adjektive
- 4. I Singular und Plural bei den Nomen, Pronomen und Adjektiven (4.01-4.07)
- 4. II Die grammatischen Geschlechter und die zwei natürlichen Geschlechter (4.08-4.14)
- 4. III Die vier Fälle (Kasus) im Deutschen, auch mit Präpositionen (4.15-4.31)
- 4. IV Fälle und Präpositionen im Französischen und Englischen (4.32-4.33)
- 4. V Fälle und Präpositionen im Lateinischen (4.34-4.38)
- 4. VI Die Vergleichsformen (Komparation, «Steigerung») (4.39-4.43)
- 5 Die grammatischen Formen der Verben, Tempussysteme, Konjunktive
- 5. 1 Grammatische Zeiten, generell und im Deutschen; Konjunktiv I und II; Imperativ (5.01-5.10)
- 5. II Die Lautungen aller Verbformen im Deutschen (5.11-5.19)
- 5. III Grammatische Zeiten, conditionnel, subjonctif, impératif im Französischen (5.20-5.26)
- 5. IV Lautungen und Schreibungen der französischen Verbformen - mit Lernhilfen (5.27-5.37)
- 5. V Grammatische Zeiten, simple und progressive, im Englischen; subjunctive (5.38-5.44)
- 5. VI Nur Gedachtes und nur Beabsichtigtes; die englischen Modalverben; Imperativ (5.45-5.48)
- 5. VII Die Lautungen der englischen Verbformen, unregelmäßige Verben, Lernhilfen (5.49-5.53)
- 5. VIII Die Lautungen der infiniten und finiten Verbformen im Lateinischen (5.54—5.62)
- 5. IX Grammatische Zeiten (Tempora) im Indikativ im Lateinischen; Bedeutungen, Stil (5.63-5.68)
- 5. X Verwendungsweisen des Konjunktivs, zeitliche Verhältnisse dabei; Imperativ (5.69-5.78)
- 6 Satzglieder neben dem Subjekt; Passivformen, reflexive Verben; Valenz
- 6. 1 Die formalen Satzgliedtypen neben dem Subjekt im Deutschen (6.01-6.11)
- 6. II Verben, Subjekte und weitere Satzglieder im Französischen (6.12-6.16)
- 6. III Die Satzglieder neben dem Subjekt im Englischen (6.17-6.20)
- 6. IV Die Satzglieder neben dem Subjekt im Lateinischen; Kasussyntax (6.21-6.28)
- 6. V Besondere Formen bei manchen Verben: ein Passiv neben dem «Aktiv» (6.29-6.38)
- 6. VI Reflexivkonstruktionen; Bedeutungsbeziehungen dabei (6.39-6.46)
- 6. VII Verschiedene Satzglied-Kombinationen für sachlich Gleiches (6.47-6.49)
- 6. VIII Einstieg in die höhere Grammatik: verbale Semanteme, «Valenz» (6.50-6.60)
- 7 Nichtverbale Gefüge, Formalstrukturen, Bedeutungsaufbau
- 7. I Überblick über die Möglichkeiten, am Beispiel des Deutschen (7.01-7.08)
- 7. II Gefügebildung im Französischen und die dafür vorhandenen Begriffe (7.09-7.14)
- 7. III Gefügebildung im Englischen und dafür vorhandene Begriffe (7.15-7.21)
- 7. IV Bedeutungsaufbau in Begleitgefügen, Beiträge der verschiedenen Teile, speziell der Begleitpronomen (7.22-7.28)
- 7. V Bedeutungsbeziehungen in Anschlußgefügen, Bedeutungsbeiträge der Anschlußteile (7.29-7.37)
- 7. VI Bedeutungsaufbau in Vorschaltgefügen, Beiträge von Vorschaltteil und Kern (7.38-7.40)
- 7. VII Begleitgefüge, Anschlußgefüge und Vorschaltgefüge im Lateinischen; formale Möglichkeiten, Freiheit der Wortstellung, Bedeutungsbeziehungen (7.41-7.47)
- 7. VIII Gesamtanalyse eines kurzen Sachtextes Englisch - Deutsch - Französisch (7.48-7.52)
- 8 Formalstrukturen für ganze Folgen und spezielle Paare von Propositionen/clauses, Reihung und Hauptsatz-Nebensatz-Fügung
- 8. I Formalstrukturen für die Verknüpfung von Propositionen im Deutschen (8.01-8.11)
- 8. II Formalstrukturen für die Verknüpfung von Propositionen im Französischen (8.12-8.19)
- 8. III Formalstrukturen für die Verknüpfung von clauses im Englischen (8.20-8.27)
- 8. IV Formalstrukturen für die Verknüpfung von Propositionen im Lateinischen (8.28-8.37)
- 8. V Verknüpfung von Propositionen durch Weitergeltung von Bestandteilen aus vorhergehenden oder Vorausnahme aus erst kommenden Propositionen (8.38-8.45)
- 9 Fragen - Verneinungen - Alternativen - parallele Geltung, gleichgewichtig, gegensätzlich, zusätzlich, neutral signalisiert
- 9. I Fragendes Darstellen: Grundphänomen - Arten von Fragen und ihre Zwecke - verschiedene Formen, innerhalb von Sprachen und je nach Sprache (9.01-9.09)
- 9. II Verneinungen, total oder partiell; Einschränkungen (9.10-9.23)
- 9. III Alternativen, zwingend oder frei - parallele Geltung, gleichgewichtig oder gegensätzlich oder betont zusätzlich oder einfach betontes Verknüpfen (9.24-9.34)
- 10 Bedeutungsbeziehungen, vor allem zwischen ganzen Propositionen, auf verschiedener oder auf gleicher gedanklicher Ebene
- 10. I Verteilung auf zwei verschiedene gedankliche Ebenen, dominante Teile und inhaltliche Teile, Überblicks-Tafel (10.01-10.04)
- 10. II Angeführte Rede, angeführte Gedanken und Gefühle, direkt präsentiert oder indirekt, mit Anpassung an die Wiedergabe-Situation (10.05-10.12)
- 10. III Zur Markierung von direkter und indirekter Rede, besondere Probleme im Deutschen («gemischter Konjunktiv») (10.13-10.20)
- 10. IV Unmittelbare Wahrnehmung und ihre Inhalte - Sicherheitsgrade von Information - «Modalpartikeln» - Angst, Hoffnung, Mut (10.21-10.33)
- 10. V Annahme/Voraussetzung und daran Gebundenes oder davon betont Unabhängiges - Beurteilen auf Annehmlichkeit, Wert usw. - Zuordnung zwecks Vergleich, kombiniert mit Annahme oder generell - Offenheit von Nennungen, beliebige Erstreckung (10.34-10.57)
- 10. VI Handlungsantriebe - Durchführbarkeit - Handlungsmodalitäten, Stadien, Aspekte, Erfolg, Risiko (10.58-10.74)
- 10. VII Grund-Folge-Zusammenhänge, in verschiedener Perspektive gesehen: Zwecke, Folgen, Ursachen - Steuerungshandeln und spezielleres Handeln - Abweichungen vom Erwartbaren; Erprobung an literarischem Text Deutsch - Französisch - Englisch (10.75-10.92)
- 11 Freier einfügbare Bedeutungsbeiträge, auf gleicher gedanklicher Ebene
- 11. I Einbettung in den Fluß der Zeit - Reihenfolgen - speziellere zeitliche Zusammenhänge - Einmaligkeit, Wiederholung, Häufigkeit - Zuweisung zu Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft (11.01-11.22)
- 11. II Situierung im Raum, Lagen und Bewegungen - besondere Raumqualitäten, besondere Perspektiven, verwurzelt in der Körperlichkeit des Menschen (11.23-11.38)
- 11. III Von anschaulichen zu abstrakten Räumen - Räumliches als Bildhintergrund beim Darstellen von Wissen, Gestimmtheit, Absichten, sozialen Positionen und ihren Veränderungen - Räumliches in der Herkunft von heute ganz «abstrakten» Wörtern (11.39-11.58)
- 11. IV Weitere je nach Semantem einfügbare Bedeutungsbeiträge: Ablaufstempo - Intensität - Vollständigkeit - Genauigkeitsgrad - Arten des Vorgehens Einsatz von Organen, Hilfsmitteln - gemeinsam oder allein handeln - personale Verfassung beim Handeln - Haltung gegenüber anderen - Auffälligkeit - ausdrückliches Bewerten (11.59-11.84)
- 12 Bedeutungsaufbau im Kernbestand der Propositionen, Semanteme - Einbau von Relativsätzen, eng oder locker - Kognitives hinter der Grammatik - Textaufbau, Textkohärenz
- 12. I Semanteme für Sprachverwendung, direktes Wahrnehmen, Informationsbesitz, Sicherheitsgrade dabei, personale Gestimmtheiten, Bewertungen (12.01-12.07)
- 12. II Semanteme für Antriebe, Durchführbarkeit von Handlungen, Handlungsmodalitäten, Folgebeziehungen, Einbettung in den Zeitablauf, räumliche Situierung (12.08-12.25)
- 12. III Semanteme für speziellere Handlungs- und Verhaltensweisen und Zustände: etwas herstellen, verändern - jemandem etwas geben oder nehmen - etwas fassen, ergreifen, halten - jemanden/etwas haben (12.26-12.36)
- 12. IV Semanteme mit «sein/être/be/esse» für die Darstellung grundlegender Denkakte - «sein/haben/werden, être/avoir, be/have, esse» als Gefügeverben - Namen-Gebung und Wort-Schaffung an sich (12.37-12.49)
- 12. V Darstellung von Personen oder andern Entitäten durch ganze Propositionen, Relativsätze als grammatische Elementarstruktur (12.50-12.63)
- 12. VI Blick auf die hinter den Bedeutungsbeziehungen und vielen Erscheinungen der Elementargrammatik stehenden gedanklichen Verhaltensweisen, kognitive Grundlagen der Grammatik (12.64-12.72)
- 12. VII Anteile von Grammatik und «Weltwissen» am Aufbau von Textzusammenhängen und dem nachvollziehenden Erfassen von «Textkohärenz» beim Hören/Lesen (12.73-12.81)
- A Abschlußteil: Sprachen lernen, sie im Kopf speichern, mehrere Sprachen im gleichen Kopf - Sprachverwendung, Handeln, Stabilisieren des «Ich»
- A. I Annahmen über die Speicherung von Sprachbesitz im Gehirn, Abläufe beim Sprechen und beim Hörverstehen (A.01-A.30)
- A. II Sprache und Schrift, Speicherung von Wortbildem - Abläufe beim Schreiben und beim Lesen (A.31 - 42)
- A. III Sprachen lernen, Erstsprache und Fremdsprachen - was wird getrennt eingelagert, was ineinander verzahnt, was gilt gleicherweise für alle Sprachen - wörtliches und übertragenes Verstehen, «Metaphern» (A.43-A.64)
- A. IV Sprachverwendung und Kommunikation, Arten von Kommunikation - Ziele bei der Sprachverwendung - relative Wichtigkeit von Teilbereichen, je nach Ziel - Wahrheitsansprüche, auch bei fiktionalen Texten - Komponenten beim Textverstehen - Sprachverwendung und Person-Identität - abschließende Beispiel - Analyse (A.65-A.80)
- Systematisches Register