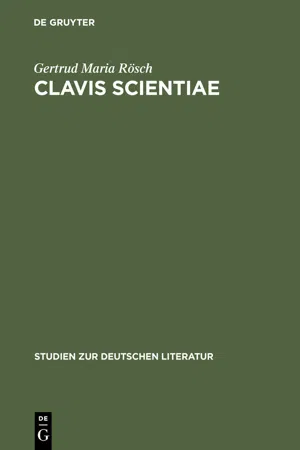
Clavis Scientiae
Studien zum Verhältnis von Faktizität und Fiktionalität am Fall der Schlüsselliteratur
- 309 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Clavis Scientiae
Studien zum Verhältnis von Faktizität und Fiktionalität am Fall der Schlüsselliteratur
Über dieses Buch
In der diachronen Studie werden Texte vom 17. bis zum 20. Jahrhundert untersucht, mit dem Ziel, die literarische Verschlüsselung als eine Form der Vermittlung von Faktizität und Fiktionalität im größeren Kontext zweier kultureller Praktiken, der kabbalistisch inspirierten Steganographie sowie der Kryptographie, zu erfassen. Am höfisch-historischen Roman (u.a. M. Opitz/J. Barclay, »Argenis«; Anton Ulrich von Braunschweig und Lüneburg, »Die römische Octavia«) wird der Verlauf der referentialisierenden Lektüre untersucht. Im 18. Jahrhundert verbindet sich das 'Prinzip Schlüssel' mit der Satire bzw. dem Pasquill (Chr.F. Hunold, »Satyrischer Roman«, Chr.M. Wieland, »Die Geschichte der Abderiten«). Entschlüsselnde Lektüre entfaltete sich im Rezeptionsprozeß der »Leiden des jungen Werthers« mit unerwarteter Direktheit. Die Rolle der Zensur für das Weiterbestehen des 'Prinzips Schlüssel' läßt sich an E.T.A. Hoffmanns Märchen »Meister Floh« zeigen; an Klaus Manns »Mephisto« erweist sich, wie das Konzept gegen den Roman instrumentalisiert werden konnte. Thomas Mann, der in allen Phasen seines Werkes mit dieser Lektüre auf Modelle und Vorbilder hin konfrontiert wurde (untersucht werden »Buddenbrooks« und »Doktor Faustus«), reagierte nicht nur mit Verteidigungen (»Bilse und ich«) und wenig zutreffender Abwehr (als er sein narratives Prinzip im »Doktor Faustus« als Montage beschrieb), sondern auch mit ironischer Gegenwehr: In »Lotte in Weimar« inszenierte er die Entschlüsselungslust der Werther-Zeitgenossen wie der späteren Philologen. Die Einzeluntersuchungen laufen darauf zu, die Referentialisierung als >legitime Form der Lektüre< herauszustellen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- I. Grundlegung
- 1. Drei Teilansichten eines Themas
- 1.1 Die Narbe des Odysseus
- 1.2 Caligula
- 1.3 Die Botschaft des entführten Jan Philipp Reemtsma
- 2. Historische Herleitung des Konzepts
- 2.1 Die alte Kunst der verrätselten Botschaft: Steganographie und Kryptographie
- 3. Methodische Grundlegung der literarischen Ver- und Entschlüsselung
- 3.1 Textexterne Strategien: Schlüssel innerhalb der Paratexte
- 3.2 Die Entschlüsselung als Applikation eines semantischen Teilpotentials
- 3.3 Textinterne Strategien: Die Explikation durch die Narration
- 3.4 Äsopisches Reden: Verschlüsselung und Zensur
- 3.5 Identität versus Ähnlichkeit: Abgrenzung zur Autobiographie
- 3.6 Zur Anlage der Studie
- II. Historische Entwicklung des Konzepts
- 1. Das 17. Jahrhundert: Politische Geschichte und Hofarkana
- 1.1 Diskursive Schlüssel als »sehr große Thore« zum Roman: ›Argenis‹ (1621/1626)
- Exkurs: Christoph Forstners Briefdiskurs über ›Argenis‹
- 1.2 Conclusio I: Die Verschlüsselung im Kontext der Romanpoetik
- 1.3 »Pro confidentioribus«: Schlüsselromane als kommunikatives Medium adliger Eingeweihter: ›Die römische Octavia‹ (1707/1714)
- 1.4 Verschlüsselung und höfische Kommunikation
- 1.5 Vorgetäuschtes Geheimwissen: ›Der Europäischen Höfe Liebes- und Heldengeschichte‹ (1705)
- 1.6 Conclusio II: Das Verschwinden der Claves und die Durchsetzung der geschlossenen Fiktionalität nach 1700
- 2. Das 18. Jahrhundert: Weiterbestehen und Ironisierung des ›Prinzips Schlüssel
- 2.1 Problemaufriß I: Verschlüsselung, Satire und Pasquill
- 2.2 Problemaufriß II: Mimesis und »mahlende Poesie« als umschreibende Konzepte
- 2.3 Der ironische Schlüssel: ›Die Geschichte der Abderiten‹ (1774/1778/1781)
- 2.4 »Nach der Natur zeichnen, um Wahrheit in das Gemälde zu bringen«: ›Die Leiden des jungen Werthers‹ (1774)
- 3. Das 19. Jahrhundert: Verschlüsselung, Zensur und Realismus
- 3.1 Verschlüsseln und Entschlüsseln in Zeiten der Zensur: ›Meister Floh‹ (1822)
- 3.2 Skizze einer verschütteten Problemlage: Verschlüsselung und Realismus
- 4. Das 20. Jahrhundert: Biographie, politische Geschichte, intertextuelles Spiel
- 4.1 Problemaufriß: Die Modellphilologie und die Durchsetzung des ›Prinzips Schlüssel vor der Jahrhundertwende
- 4.2 Verschlüsselung nach 1900 als dichterische Praxis
- 4.3 Die Rechte der empirischen Leser: ›Buddenbrooks‹ (1901)
- 4.4 Eine »erfundene Figur«: ›Mephisto‹ (1936)
- 4.5 Montage und Entschlüsselung des Schlüssels: ›Doktor Faustus‹ (1948)
- III. Konsequenzen
- Bibliographie
- 1. Quellen
- 2. Forschungsliteratur