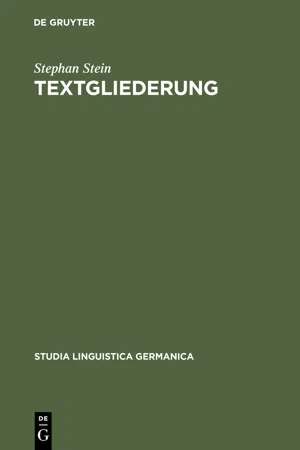
Textgliederung
Einheitenbildung im geschriebenen und gesprochenen Deutsch: Theorie und Empirie
- 500 Seiten
- German
- PDF
- Über iOS und Android verfügbar
Textgliederung
Einheitenbildung im geschriebenen und gesprochenen Deutsch: Theorie und Empirie
Über dieses Buch
Die Mittel und Verfahren für die Gliederung von Texten in Einheiten werden seit den Anfängen von Text- und Gesprächslinguistik kontrovers diskutiert. Die vorliegende Arbeit führt die Ergebnisse verschiedener Forschungsrichtungen zusammen und vergleicht anhand zahlreicher detaillierter Beispielanalysen die Gliederung geschriebener und gesprochener Texte (verschiedener Text- bzw. Gesprächssorten): Auf der Grundlage des Nähe/Distanz-Konzeptes werden für beide medialen Varietäten die Gliederungsressourcen (syntaktisch, lexikalisch-semantisch, prosodisch usw.) und die Gliederungseinheiten (Ellipse, Satz, Absatz; Äußerungseinheit, Turn usw.) systematisch aufeinander bezogen. Vorgestellt wird ein Beschreibungskonzept, das auch den Einfluss pragmatischer Faktoren auf die Äußerungsgestaltung ("pragmatische Syntax") konsequent berücksichtigt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der Übersichten
- Transkriptionskonventionen
- Wegweiser durch die Arbeit
- I Grundlagen
- 1 Vorgehen, Materialgrundlage und Transkription
- 2 Einleitung
- 2.1 Erläuterung des Themas und ein exemplarischer Blick auf Texte
- 2.2 Textgliederung als zentrales Thema der Text- und Gesprächslinguistik
- 2.3 Textgliederung vs. Textsegmentierung
- 2.4 Textgliederung und Textstrukturebenen
- 3 Forschungsgrundlagen
- 3.1 Mündliche und schriftliche Textproduktion: Produktionsbedingungen gesprochener und geschriebener Sprache
- 3.2 Fragestellungen und Erkenntnisinteressen: Weshalb Texte gegliedert sein müssen und was es heißt, Texte zu gliedern
- II Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Distanz
- 4 Grammatisch-syntaktische Textgliederung: Das Satzformat als (erwartbarer) Normalfall
- 4.1 Beispieldiskussion: Unzureichende Textgliederung
- 4.2 Satzbegriff und Satzkonzept
- 4.3 Interpunktion und grammatisch-syntaktische Textgliederung
- 4.4 Elliptische oder isolierte Texteinheiten?
- 4.5 Grammatisch-syntaktische Textgliederung: Ein Fazit
- 5 Inhaltlich-thematische Textgliederung: Der Absatz
- 5.1 Absätze: Graphische oder funktionale Einheiten?
- 5.2 Absatzbildung in der Schreibpraxis: Eine Stichprobe
- 5.3 Inhaltlich-thematische Textgliederung: Ein Fazit
- 6 Lexikalische Textgliederung: Textorganisierende Ausdrücke
- 6.1 Organisatorische Schaltstellen in Texten
- 6.2 Eigenschaften und Formen textorganisierender Ausdrücke
- 6.3 Textorganisierende Ausdrücke in der Praxis
- 6.4 Lexikalische Textgliederung: Ein Fazit
- 7 Typographische Textgliederung: Visuelle Textgestaltung
- 7.1 Zum Begriff und Stellenwert der Typographie
- 7.2 Grundprinzipien typographischer Textgliederung
- 7.3 Semantische und pragmatische Effekte typographischer Gestaltung
- 7.4 Typographische Textgliederung: Ein Fazit
- 8 Ikonische Textkonstitution und Textgliederung als Sonderfall
- 8.1 Visuell-konkrete Poesie: Literarische Texte für den Betrachter
- 8.2 Werbetexte: Gebrauchstexte für Ohr und Auge
- III Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Nähe
- 9 Die Vielfalt der Ansätze und die Frage nach der Gliederungseinheit
- 9.1 Einige Bemerkungen zur Forschungsgeschichte
- 9.2 Gliederungsebenen und Gliederungseinheiten in Gesprächen
- 9.3 Gliederungsansätze für die Binnengliederung von Sprecherbeiträgen: Gliederungseinheiten gesprochener Sprache
- 9.4 Das Erklärungspotenzial der Gliederungsansätze im Vergleich: Eine exemplarische Analyse
- 9.5 Zwischenbilanz: Kontroversen und offene Fragen der Textgliederung
- 10 Grundlagen eines integrativen Gliederangskonzeptes
- 10.1 Interpretationsprobleme: Zum Verhältnis zwischen Partnerverstehen und Beobachterverstehen
- 10.2 Modellierung der Gliederung konzeptionell gesprochener Texte
- 10.3 Das Verhältnis von Syntax und Interaktion: Begründung einer „pragmatischen Syntax“
- 10.4 Zur Bezeichnung der Gliederungseinheit
- 10.5 Grundsätze der Analysetätigkeit: Prozessorientiertheit
- 11 Konstruktionsschemata zur Bildung von Turnkonstruktionseinheiten
- 11.1 Grundpfeiler „pragmatischer Syntax“
- 11.2 Variation des syntaktischen Ausbaus: Typologie interaktiv relevanter Konstruktionsschemata
- 11.3 Projektierende Kraft syntaktischer Konstruktionsschemata
- 11.4 Grenzen syntaktischer Projektion: Ellipsen in gesprochener Sprache
- 12 Signalisierungssysteme zur Begrenzung von Turnkonstruktionseinheiten
- 12.1 Prosodie
- 12.2 Lexikalische Gliederungssignale oder Textorganisationssignale?
- 12.3 Interaktion der Signalisierungssysteme
- 13 Höreraktivitäten und Textgliederung
- 13.1 Grundsätzliches zum Hörersignalkomplex
- 13.2 Einheitenbildung durch den Hörer?
- 13.3 Exkurs: Partnerunterstützende Höreraktivitäten als Manifestationsformen der Rezeptionstätigkeit und Ausprägungen interaktiver Textkonstitution
- IV Bilanz
- 14 Zusammenfassung, Folgerungen und Ausblick
- 14.1 Zusammenfassung
- 14.2 Folgerungen
- 14.3 Ausblick
- Literatur
- Personenregister